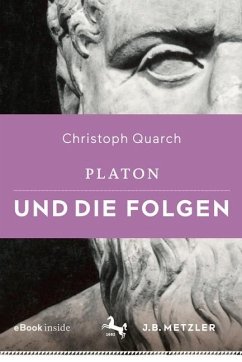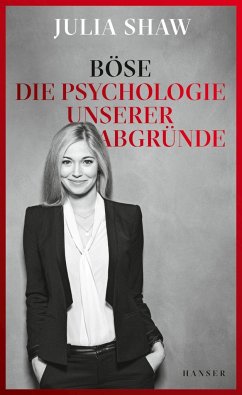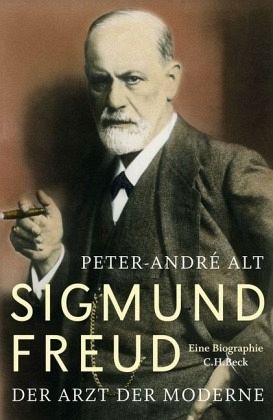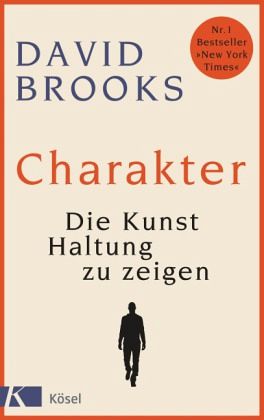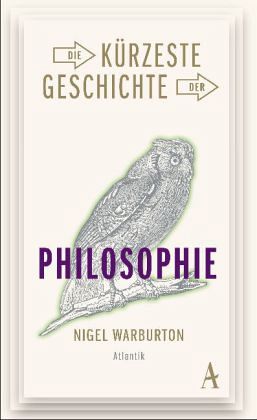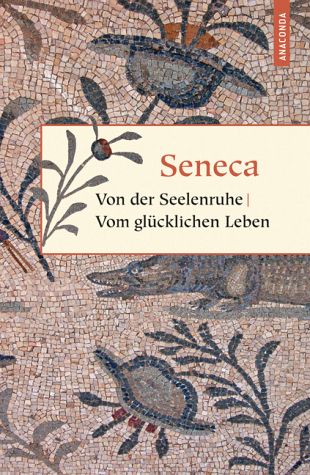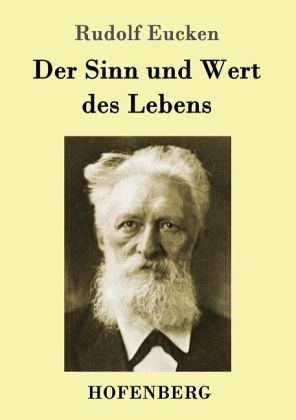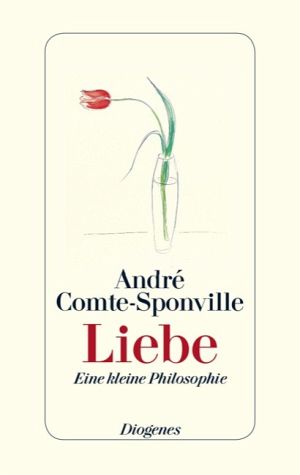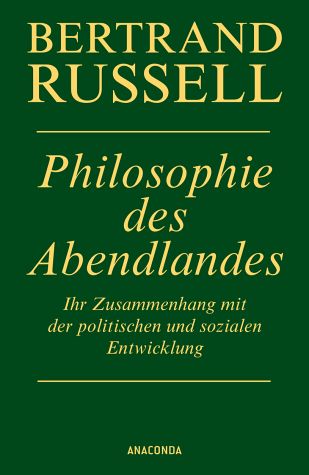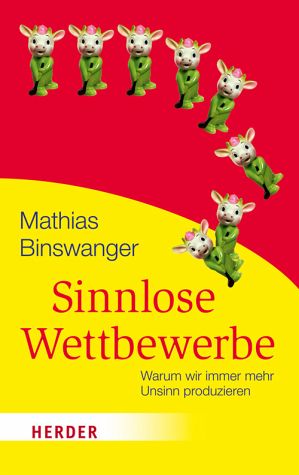Wenn der griechische Philosoph Platon (427 – 347 v. Chr.) nach dem guten Leben fragt, dann sucht der nach dem Maß des guten Lebens. Dieses Maß nennt Platon in den „Nomoi“ Gott – und verrät im gleichen Dialog, wer diese Gottheit ist, die aller phýsis, allem Sein und Leben unbedingt maßgeblich ist: die psyché bzw. die Lebendigkeit, die alles trägt und hält, durchwaltet und belebt.“ Christoph Quarch weiß: „Die psyché ist Grund und Wesen des Erscheinens und des Werdens – und es liegt in ihrer Logik, dass sie Harmonie und Stimmigkeit gebiert, wo immer sie sich in der wahrnehmbaren Welt bekundet.“ In ihr gründet auch die Ordnung eines jeden lógos, der stets dann ein wahrer lógos ist, wenn er der Logik der Lebendigkeit angemessen ist und der Dynamik ebenso wie dem Sowohl-als-auch des Lebens Rechnung trägt. Der Philosoph, Theologe und Religionswissenschaftler Christoph Quarch arbeitet freiberuflich als Autor, Vortragender und Berater.
Gut
Strafrecht ist Kommunikation und Gewalt
Thomas Fischer lotet in seinem neuen Buch „Über das Strafen“ die Wechselwirkungen von Strafrecht und Gesellschaft aus. Einer seiner hervorstechenden Thesen lautet: „Strafrecht ist Kommunikation und Gewalt.“ Denn im Strafrecht manifestiert sich erstens das Gewaltmonopol des Staates. Es steht im Fokus der politischen Bemühungen der Steuerung. Und zweitens ist die Kommunikation über das Strafrecht die Oberfläche sozialer Prozesse. Thomas Fischer vereint soziologische, philosophische und juristische Erkenntnisse zu einer so gehaltvollen wie provokativen Antwort auf die Frage nach dem Gleichgewicht von Rache und Prävention, Sicherheit und Freiheit, Affekt und Rechtsstaatlichkeit. Dabei erscheint das Strafrecht manchmal wie eine eigene Wirklichkeit, als eine mögliche, häufig sogar naheliegende Lösungsinstanz, die man aus der Unübersichtlichkeit der Lebenswelt und der gesellschaftlichen Problemlagen anrufen kann. Thomas Fischer war bis 2017 Vorsitzender des Zweiten Senats des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe.
Julia Shaw begibt sich auf die Spur des Bösen
Die Kriminalpsychologin und Bestsellerautorin Julia Shaw beschreibt in ihrem neuen Buch „Böse“ wie die Menschen jeden Tag das Böse neu erschaffen. Herausgekommen ist dabei eine Studie über Heuchelei und den ganz normalen Wahnsinn, welche die vertrauten Kategorien von Gut und Böse über den Haufen wirft. Julia Shaw sucht und findet das Böse nicht nur in den Gehirnen von Massenmördern, sondern in jedem Menschen. Und sie erläutert mithilfe psychologischer Fallstudien, wie man sich mit seiner dunklen Seite versöhnen kann. Friedrich Nietzsche, einer der bedeutendsten deutschen Philosophen des 19. Jahrhunderts, schrieb 1881: „Böse denken heißt böse machen.“ Das heißt: Nur wenn man etwas das Etikett böse verpasst, nur wenn man denkt, dass etwas böse ist, wird es auch böse. Das Böse, so argumentiert Friedrich Nietzsche, sei eine subjektive Erfahrung, nicht etwas, was einer Person, einem Objekt oder einer Handlung innewohne.
Fast alle Menschen streben nach dem Glück
Aristoteles erklärt das Glück – die „eudaimonia“, die genauer mit Glückseligkeit zu übersetzen ist – zu einem Gut, das man um seiner selbst willen anstrebt, das aber nicht in der Abstraktion oder dem Reich der Ideen zu finden ist, sondern nur in der konkreten Verwirklichung, also dem, was ein Mensch aus gutem Grund tut. Ina Schmidt fügt hinzu: „Dieses Glück ist ein „sich selbst genügendes“ Gut, das wir laut Aristoteles aber nicht im Rückzug auf uns selbst, also in einem auf das „Ich beschränkte Leben“ finden können.“ Nur in einem Leben voller Beziehungen, „in der Verflochtenheit mit Eltern, Kindern, der Frau, überhaupt den Freunden und Mitbürgern“ sei die Glückseligkeit zu erwarten, „denn der Mensch ist von Natur bestimmt für die Gemeinschaft“ so der griechische Philosoph in seiner „Nikomachischen Ethik“. Ina Schmidt gründete 2005 die „denkraeume“, eine Initiative, in der sie in Vorträgen, Workshops und Seminaren philosophische Themen und Begriffe für die heutige Lebenswelt verständlich macht.
Die individuelle Freiheit ist das höchste Gut der menschlichen Existenz
Viele Menschen in den reichen Staaten des Westens sind so frei wie nie zuvor in der Geschichte der Menschheit. Und doch fühlen sie sich oft gefangen, erdrückt von Anforderungen, getrieben durch inneren Leistungszwang. Das neue Philosophie Magazin 05/2018 versucht in seinem Titelthema die Frage zu beantworten, warum diese Menschen nicht mehr aus ihrer Freiheit machen. „Mach die Ding!“, „Lebe deinen Traum!“ – das sind die Imperative der Gegenwart. Aber wie das so ist mit großen Sehnsüchten verweisen sie umso deutlicher auf einen Mangel. Zeitnot, Stress, Beschleunigung, Angst vor der Zukunft, Burn-out. Von einem geglückten Leben scheinen die meisten Menschen nach wie vor weit entfernt. Eine Ausrede, die auf die widrigen Verhältnisse verweist, würde ein Denker wie Jean-Paul Sartre niemals gelten lassen. Denn seiner Meinung nach ist der Mensch dazu verurteilt, seine Existenz selbst zu entwerfen und sich in jeder konkreten Situation für die Freiheit zu entscheiden.
Die Angst zerstört jede Zwischenmenschlichkeit
Jeder Mensch sollte sich mit der Wirkweise der Angst auseinandersetzen. Als Faustregel gilt: Je verängstigter man ist, desto weniger differenziert kann man denken. Wird die Angst größer, nehmen Tendenzen der Pauschalisierung ebenfalls zu. Georg Pieper erläutert: „So kann ein radikales Schwarz-Weiß-Denken entstehen, bei dem man alles in Gut und Böse unterteilt. Und gegen das Böse ist, glaubt so mancher, alles erlaubt. Diese Haltung wird dann zum gesellschaftlichen Problem, denn sie gefährdet unseren Wertekanon.“ Wenn die Angst überhandnimmt, entsteht also eine große Gefahr für die Gesellschaft. Die Angst zerstört jede Zwischenmenschlichkeit. Verschiedene sozialpsychologische Untersuchungen haben gezeigt, dass die Mehrheit der Deutschen vor allem auf Fremde immer zuerst mit Vorurteilen und Ängsten reagieren. Dr. Georg Pieper arbeitet als Traumapsychologe und ist Experte für Krisenintervention.
Ohne Glauben kann kein Mensch leben
Zeiten, in denen der Glaube schwindet, geben sich gerne der Vorstellung hin, früher sei stärker und unangefochtener geglaubt worden. Deshalb hätte es damals „Glauben“ und nicht etwa nur „Willen zum Glauben“ gegeben. Rüdiger Safranski erläutert: „Dieser Wille zum Glauben gilt als ein Phänomen der aufgeklärten Spätzeit, in der die religiösen Lichter allmählich ausgehen und dem raffinierter gewordenen und von seiner eigenen Aufgeklärtheit überanstrengten Bewusstsein nicht mehr der Glaube, sondern nur noch der Wille zum Glauben bleibt.“ Diesen Ausdruck hat der amerikanische Philosoph William James Anfang des letzten Jahrhunderts geprägt. Er bezeichnet die Art, wie man sich Glauben und Religion heutzutage intellektuell allenfalls glaubt leisten zu können. Der Schriftsteller und Literaturwissenschaftler Rüdiger Safranski ist Honorarprofessor für Philosophie an der Freien Universität Berlin.
Das Über-Ich nimmt an der Figur des Vaters Maß
Das Über-Ich steuert die moralische Bestimmung des Individuums nicht von außen, sondern entspringt einer subjektiven Idealisierung mit ambivalenten Bezügen. Prägend steht dabei im Hintergrund die Figur des Vaters, an dem das Über-Ich Maß nimmt. Peter-André Alt erläutert: „Im Laufe des Erwachsenwerdens löst es sich von dieser konkreten Bindung, beim Jungen durch die Überwindung des Ödipus-Komplexes, beim Mädchen durch die Suche nach einer neuen männlichen Bezugsperson, auf die sich das Liebesbegehren richtet.“ Auch das Über-Ich bleibt im Bann libidinöser Kräfte, weil die Idealisierungsarbeit, der es seine Existenz verdankt, das Resultat einer sexuell aufgeladenen Fixierung auf den Vater ist. Es wäre daher unzutreffend, dem Über-Ich Eigenständigkeit und Freiheit zuzusprechen. Peter-André Alt ist Professor für Neuere Deutsche Literaturgeschichte an der Freien Universität Berlin.
Das Ich wird von den Mächten des Unbewussten beherrscht
Während das Ich als steuernde Instanz auf Ordnung und Organisation ausgerichtet ist, bleibt das Es unberechenbar. Der Trieb ist materialistisch und auf Verbrauch ausgerichtet. Er unterliegt weder einer sittlichen noch einer rationalen Lenkung. Sigmund Freud schreibt: „Selbstverständlich kennt das Es keine Wertungen, kein Gut und Böse, keine Moral.“ Dem Es kann man nur in Vergleichen nahekommen, denn es ist eigentlich unbenennbar, sofern es sich nicht in Träumen oder Neurosen meldet. Peter-André Alt ergänzt: „Aus diesem Grund repräsentiert es auch kein „Unbewusstes“ – einen bis heute häufige Fehlbenennung, die Sigmund Freud immer rügte –, sondern eine amorphe und unbekannte, nur über Wirkungen erfahrbare Ordnung.“ Als „Kessel voll brodelnder Erregungen“ lässt sich das Es weniger beherrschen als über Umwege sublimieren. Peter-André Alt ist Professor für Neuere Deutsche Literaturgeschichte an der Freien Universität Berlin.
Mit jeder Tugend geht ein Laster einher
Augustinus, der lateinische Kirchenlehrer der Spätantike, glaubte nicht daran, dass die Welt feinsäuberlich in die Kräfte des reinen Guten und des reinen Bösen geschieden werden könne. Vielmehr gehe jede Tugend mit einem Laster einher – Selbstvertrauen mit Stolz, Aufrichtigkeit mit Brutalität, Mut mit Leichtsinn und so weiter. Der Ethiker und Theologe Lewis Smedes beschreibt die menschliche Natur der Innenwelt wie folgt: „Unser Seelenleben ist nicht so scharf geschieden wie Tag und Nacht – mit reinem Licht auf der einen Seite und totaler Finsternis auf der anderen. Unsere Seelen sind überwiegend Schattenräume; wir leben an der Grenze, wo unsere dunklen Seiten uns Licht blockieren und einen Schatten auf unsere inneren Plätze werfen. Wir können nicht immer sagen, wo unser Licht endet und unser Schatten beginnt und wo unser Schatten endet und unsere Finsternis beginnt.“
Der größte Genuss des Lebens liegt im Denken
Viele Menschen vergessen oft die einzigartigen Freuden, die einem am Ende des Lebens noch offenstehen, und eine davon ist ganz sicher das stille, gelassene Denken. Daniel Klein hatte immer große Freude an der Art, wie Bertrand Russell (1872 – 1970) die Dinge darstellt: „Es klingt oft nach einer Mischung aus britischer Elite-Uni und der Redeweise einfacher Leute.“ Bertrand Russell ordnet sich mit seinen Statements in eine lange Reihe von Philosophen ein, die glauben, dass einer der größten Genüsse des Lebens im Denken liegt. Als John Stuart Mill, der Sozialphilosoph des 19. Jahrhunderts, das Prinzip des größten Glücks zum Grundbaustein des Utilitarismus machte, unterstrich er, dass die rein animalischen Vergnügungen seinen Anforderungen nicht gerecht werden. Daniel Klein, Jahrgang 1939, studierte Philosophie in Harvard. Zusammen mit Thomas Cathcart schrieb er „Platon und Schnabeltier gehen in eine Bar“, das in 26 Sprachen übersetzt wurde.
Friedrich Nietzsche postuliert: „Gott ist tot.“
„Gott ist tot“. Das ist der berühmteste Satz des deutschen Philosophen Friedrich Nietzsche (1844 -1900). Wörtlich genommen, wollte er nicht sagen, Gott habe zu einer bestimmten Zeit gelebt oder lebe jetzt nicht mehr, sondern eher, dass der Glaube an Gott nicht mehr vernünftig ist. Ganz anders als zum Beispiel bei Immanuel Kant, der seine Gedanken zu einem strengen System ordnete, stürmen die Gedanken bei Friedrich Nietzsche von allen Seiten auf den Leser ein. Nigel Warburton erklärt: „Viele seiner Schriften sind in der Form von kurzen, bruchstückhaften Absätzen und Aphorismen, also Merksätzen, verfasst, einige ironisch, andere ernst, viele deutlich provokant. Der Philosoph Nigel Warburton ist Dozent an der Open University. Er gibt außerdem Kurse über Kunst und Philosophie am Tate Modern Museum.
Die Freiheit erschreckt viele Menschen zu Tode
Die Freiheit ist ein wundersames Ding. Die meisten Menschen sehnen sich danach, schätzen sie als höchstes Gut. Gleichzeitig aber erschreckt sie viele zu Tode. Weil aus ihr auch Schuld resultiert. Reinhard K. Sprenger schaut sich beispielsweise an, wie in modernen Gesellschaften Verbrechen reflektiert werden: „Der Bildungsbürger führt sie auf die Gräuel desolater Familienverhältnisse, auf seelische Defekte und soziale Missstände zurück. Da müsse man ja geradezu zwangsläufig kriminell werden!“ So werden die Dinge allerdings ins Gegenteil verkehrt – aus Tätern werden Opfer. Sie sind von vornherein unmündige Personen; ihr Rechtsbruch insofern verstehbar, ein Unfall. Der Unhold gehört dann in die Gesellschaft der Kranken, Armen und Ausgestoßenen, denen fürsorglich und therapeutisch zu begegnen ist. Reinhard K. Sprenger ist promovierter Philosoph und gilt als einer der profiliertesten Managementberater und Führungsexperte Deutschlands.
Der Weise fürchtet weder die Menschen noch die Götter
Laut Seneca unterscheidet die törichte Habsucht der Menschen zwischen Besitz und Eigentum und zählt den öffentlichen Besitz nicht zum persönlichen Eigentum. Der Weise dagegen betrachtet gerade dies als den ureigensten Besitz, was er mit der gesamten Menschheit gemeinsam hat. Seneca erklärt: „Denn Gemeingut, das in seinen Teilen nicht auch jedem einzelnen gehörte, wäre auch kein richtiges Gemeingut. Gemeinsamkeit stiftet auch das, was nur zum kleinsten Teil Gemeingut ist.“ Da die wahren und wesentlichen Güter seiner Meinung nach nicht so verteilt sind, dass für die einzelnen auch nur ein winziger Bruchteil abfällt, gehört jedem einzelnen das Ganze. Zum Beispiel gehöre Frieden und Freiheit voll und ganz sowohl allen wie jedem einzelnen.
Die Sophisten waren für Platon keine Lehrer der Weisheit
Das, was einst das Wesen einer Universität ausmachte, die Freiheit in Forschung und Lehre, ist laut Konrad Paul Liessmann zu einer lästigen Randerscheinung geworden, die den Betrieb nur noch stören, nicht mehr zu befördern vermag. Der Verdacht, dass die Wissenschaft und ihre Lehre nicht mehr frei, sondern auch an staatlichen Universitäten und Hochschulen an letztlich ökonomische Kriterien und Erwartungen gebunden sind, ist für Konrad Paul Liessmann nicht unbegründet: „Das mag im Trend einer Zeit liegen, in der Messbarkeit und wirtschaftliche Effizienz zu den obersten Maximen geworden sind, aber auch Menschen, die wenig dagegen haben, dass auf dieser Erde nahezu alles käuflich ist, beschleicht ein Unbehagen, wenn die Rede davon ist, dass die Wahrheit vor Gericht, die Wahrheit in der Politik und eben auch die Wahrheit in der Wissenschaft nur eine Frage des angemessenen Preises ist. Prof. Dr. Konrad Paul Liessmann ist Professor für Methoden der Vermittlung von Philosophie und Ethik an der Universität Wien und wissenschaftlicher Leiter des Philosophicum Lech.
Gerhard Schick macht auf die Instabilität der Märkte aufmerksam
Die Instabilität der Finanzmärkte ist kein Zufall, da sie anders funktionieren als andere Märkte. Gerhard Schick erklärt: „Im Kern geht es darum, dass die Akteure an den Finanzmärkten wie eine aufgescheuchte Kuhherde in die eine und andere Richtung laufen und dabei regelmäßig erkennbar weit über die Werte hinausgehen, die ökonomisch noch als sinnvoll bezeichnet werden können.“ George Akerlof und Robert Shiller erklären solche Entwicklungen in ihrem Buch „Animal Spirits“ mit der Irrationalität menschlichen Verhaltens. Doch irrationales Verhalten gibt es überall. In normalen Märkten macht das aber nicht so viel aus, weil es Bremsmechanismen gibt. Die Kauflust wird zum Beispiel durch ein begrenztes Budget eingeschränkt. Der grüne Politiker Gerhard Schick zählt zu den versiertesten Ökonomen im Deutschen Bundestag.
Die Freiheit ist vor allem eines – großartig
Die Freiheit scheint für viele Menschen kein Glücksversprechen mehr, sondern eher ein lästiges Gut zu sein. Eine immer weiter um sich greifende Müdigkeit scheint sich breit zu machen. Rupert M. Scheule untersucht in seinem neuen Buch „Wir Freiheitsmüden“ nicht nur dieses gefährliche Phänomen, sondern erinnert auch an den Wert der Freiheit. Viele Menschen haben manchmal so viel zu tun, dass sie jedes Gefühl verlieren für den Ursprung allen Tunkönnens, nämlich die Freiheit. Auch wenn der Fall der Mauer im Jahr 1989 für die meisten Menschen nur einen Fernseherfahrung war, werden doch viele dadurch eines nicht vergessen: „Bevor Freiheit anstrengend, ermüdend und kompliziert ist, ist sie vor allem eines – großartig. Und nötigenfalls müsste man sie wohl mit Zähnen und Klauen verteidigen.“ Rupert M. Scheule ist Professor für Moraltheologie und Christliche Sozialwissenschaft an der Theologischen Fakultät Fulda.
Herbert Schnädelbach stellt den Naturalistischen Fehlschluss vor
Ein Grundgesetz in der Philosophie lautet: Man darf nicht von dem, was ist, einfach ableiten, was sein soll. Denn Tatsachenbehauptungen allein rechtfertigen keine normativen Forderungen. Laut Herbert Schnädelbach ist ein unvermittelter Übergang vom Beschreiben zum Vorschreiben, vom Deskriptiven zum Präskriptiven weder in grammatischer noch in sachlicher Form erlaubt. Herbert Schnädelbach fügt hinzu: „Warum dieses Verbot, das man allgemein David Hume als das „Hume`sche Gesetz“ zuschreibt, etwas betrifft, was angeblich naturalistisch und zudem ein Fehlschluss sein soll, liegt freilich nicht auf der Hand.“ Mit dem Sein ist für Herbert Schnädelbach, aus dem man David Hume zufolge kein Sollen ableiten kann, ja nicht nur bloß die Natur gemeint, sondern der Inbegriff aller Seinsbereiche. Die Redeweise „Naturalistischer Fehlschluss“ ist seiner Meinung nach nur historisch zu erklären. Vor seiner Emeritierung war Herbert Schnädelbach Professor für Philosophie an den Universitäten Frankfurt am Main, Hamburg und an der Humboldt-Universität in Berlin.
Die Auswahl des Essens steht unter gesellschaftlichem Druck
Im neuen Philosophie-Magazin 04/2015 setzt sich das Titelthema mit der Frage „Bin ich, was ich esse? auseinander. Dabei wird festgestellt, dass heute mehr denn je die Auswahl des Essens unter gesellschaftlichem Druck steht. Dabei bilden selbstgewählte Nahrungstabus das Zentrum der menschlichen Identität, ersetzen zunehmend religiöse und auch politische Erkenntnisse. Dr. Catherine Newmark, die am Institut für Philosophie an der Freien Universität Berlin arbeitet, schreibt: „Die damit verbundenen Haltungen pendeln zwischen lebensfroher Heilserwartung und genussferner Hypersensibilität, revolutionärer Energie und Angst vor staatlicher Überregulierung. Sie zitiert in ihrem Beitrag Friedrich Nietzsche, der einst behauptete: „Oft entscheidet ein einziger Bissen Nahrung, ob wir mit einem hohlen Auge oder hoffnungsreich in die Zukunft schauen.“ Viele Menschen sind heutzutage geradezu besessen vom Essen, und das gerade nicht, weil es so schwer zu besorgen wäre.
Rudolf Eucken erklärt die Außenwelt und die Innenwelt
Nichts treibt den Menschen laut Rudolf Eucken mit so zwingender Kraft zur Philosophie als ein Widerspruch, der sich bei ihm selbst eröffnet und ihm sein eigenes Wesen und Leben unsicher macht. Der Mensch begreift sich zunächst als sinnliches Wesen, als ein Bestandteil einer sichtbaren Welt, die ihn mit unablässigen Eindrücken und Forderungen umgibt. Zugleich lehrt den Menschen aber jede Selbstbesinnung, dass er direkt nie Dinge draußen, sondern stets nur seinen eigenen Zustand erleben, dass daher was sich ihm als eine jenseitige Wirklichkeit darstellt, von innen her entwickelt sein muss. Rudolf Eucken erklärt: „So entstehen zwei Reiche und Welten, die sich nicht unmittelbar zusammenfügen lassen, deren eine die andere unter sich zu bringen, ja möglichst ganz in sich aufzunehmen beflissen ist: die sinnliche Welt behandelt das Seelenleben als ein natürliches Erzeugnis oder auch als ein bloßes Spiegel- und Schattenbild, die seelische möchte umgekehrt die sinnliche zu einer bloßen Erscheinung herabsetzen, die den Kreis des Inneren nicht überschreitet.“
Echte Freundschaft kann man für alles Geld der Welt nicht kaufen
Michael J. Sandel stellt sich die Frage, ob es Dinge gibt, die für Geld nicht zu kaufen sein sollten. Die meisten Menschen vertreten die Ansicht, dass es solche Dinge sehr wohl gibt. Als Beispiel nennt Michael J. Sandel die Freundschaft. Die wenigsten Menschen haben schon einmal daran gedacht, sich Freunde zu kaufen. Denn ein angeheuerter Freund ist nicht dasselbe wie ein echter. Michael J. Sandel schreibt: „Irgendwie scheint das Geld, mit dem Freundschaft erkauft wird, diese aufzulösen oder sie in etwas anderes zu verwandeln.“ Als zweites Beispiel nennt Michael J. Sandel den Kauf einer menschlichen Niere. Manchen Menschen befürworten den Handel mit Organen, andere finden solche Märkte moralisch verwerflich. Michael J. Sandel ist politischer Philosoph, der in Oxford studiert hat und seit 1980 in Harvard lehrt. Seine Vorlesungen über Gerechtigkeit machten ihn zu einem der bekanntesten Moralphilosophen der Gegenwart.
Ein interessanteres Thema als die Liebe gibt es nicht
Das neue Buch „Liebe“ des französischen Philosophen und Schriftstellers André Comte-Sponville geht es wie der Titel schon verrät um die Liebe, denn ein interessanteres Thema als die Liebe gibt es nicht. Wenn jemand in einem Gespräch über die Liebe zu reden beginnt, kann er sofort mit einem gesteigerten Interesse der anderen rechnen. Auch in der Literatur und im Kino ist die Liebe in ihren verschiedenen Erscheinungsformen das bevorzugte Thema. André Comte-Sponville ergänzt: „Und für das richtige Leben gilt das – von Ausnahmen abgesehen – genauso: Was gibt es Aufregenderes, als zu lieben oder geliebt zu werden?“ Jedes andere Thema ist nur insofern von Interesse, wie Menschen ihm Liebe entgegenbringen. Die Liebe, die eigentlich eine Tugend ist, kann allerdings niemals zur Pflicht werden.
Bertrand Russell überprüft den Wert der Philosophie
Wenn die Beschäftigung mit der Philosophie überhaupt einen Wert hat, dann kann er für Bertrand Russell nur indirekt zustande kommen, durch ihren Einfluss auf das Leben derer, die sich mit ihr beschäftigen. Dennoch sind die Güter des Geistes mindestens ebenso wichtig wie die materiellen Güter. Bertrand Russell stellt fest: „Der Wert der Philosophie ist ausschließlich unter den Gütern des Geistes zu finden; und nur Menschen, denen diese Güter nicht gleichgültig sind, können davon überzeugt werden, dass die Beschäftigung mit der Philosophie keine Zeitverschwendung ist.“ Das Ziel aller Philosophie ist Erkenntnis. Eine Erkenntnis, die Einheit und System in die Gesamtwissenschaften bring und die sich aus einer kritischen Überprüfung der Gründe für die Überzeugungen, Vorurteile und Meinungen der Menschen ergibt.
Julian Baggini rät zu mehr Großzügigkeit gegenüber den Armen
Der australische Philosoph Peter Singer vertritt die Meinung, dass eigentlich die meisten Menschen zur Hilfe für Bedürftige verpflichtet sind und sehr viel mehr geben sollten, als sie dies gemeinhin tun. Sein englischer Kollege Julian Baggini teilt diese Ansicht: „Gemessen an der Tatsache, dass 50 Prozent der Menschen weltweit von weniger als 2,50 Dollar am Tag leben, gehören wir hier fast alle zu den reichsten Menschen der Welt, und die Mehrheit von uns könnte sehr viel mehr abgeben, als sie es tut und dennoch relativ reich sein und eine sehr angenehme Lebensqualität genießen.“ Der Philosoph Julian Baggini ist 1968 in Dover, Kent geboren. Er ist Mitbegründer und Herausgeber des „Philosopher`s Magazine“. Er schreibt regelmäßig für große Zeitungen und hat mehrere Bücher veröffentlicht. Eines seiner Bücher trägt den Titel „Der Sinn des Lebens“ und ist 2005 im Piper Verlag erschienen. Sein neuestes Werk trägt den Titel „Ethik“ und ist im Verlag Springer Spektrum veröffentlicht worden.
Mathias Binswanger stellt die Tücken des Marktwettbewerbs vor
Nur wenn der von der ökonomischen Theorie beschriebene Idealfall der sogenannten vollständigen Konkurrenz gilt, führt dies dazu, dass Markt und Wettbewerb zusammentreffen. So wie viele Ökonomen diesen Marktwettbewerb definiert haben, ist dort von einer aktiven Konkurrenz im eigentlichen Sinn allerdings nicht viel zu bemerken. Mathias Binswanger erläutert: „Der Marktwettbewerb erscheint eher als eine sich ewig wiederholende Routine, bei der sich alle Beteiligten brav an die durch den Markt vorgegebenen Preise anpassen.“ In dem sich aus dem Marktwettbewerb unter der Bedingung vollständiger Konkurrenz ergebenden allgemeinen Gleichgewicht sind sowohl die privaten Haushalte als auch die Unternehmen Preisnehmer. Die Marktpreise sind stabil und können durch einen einzelnen Anbieter oder Nachfrager weder erhöht noch gesenkt werden. Mathias Binswanger ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Fachhochschule Solothurn.