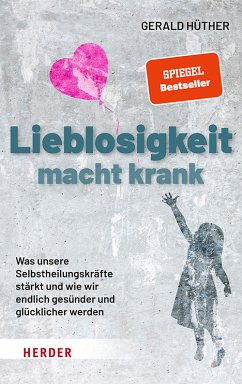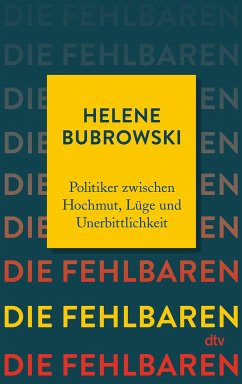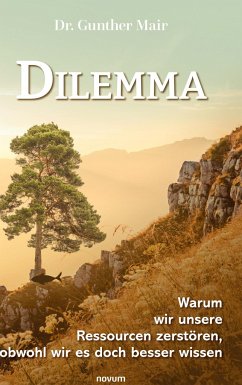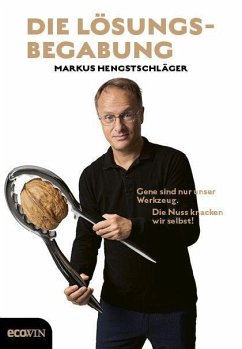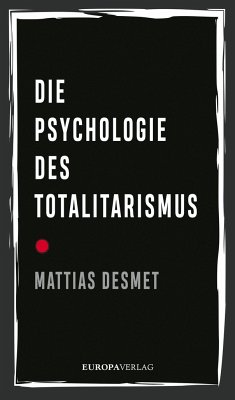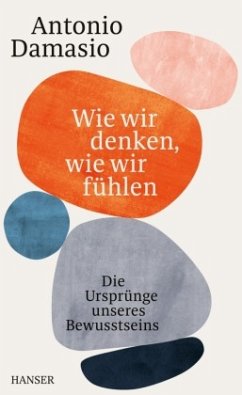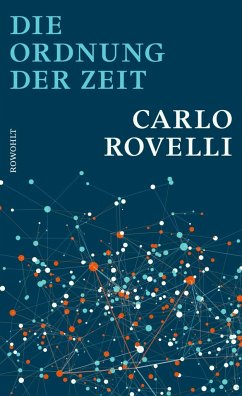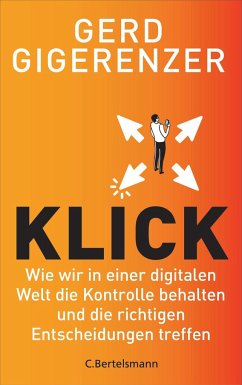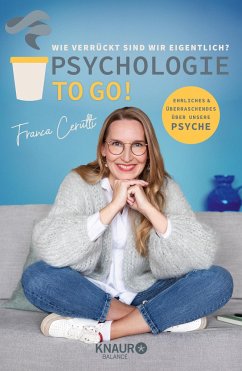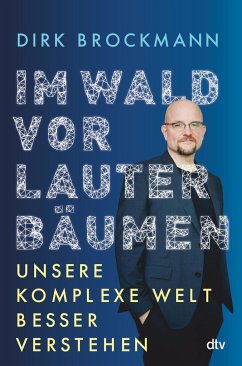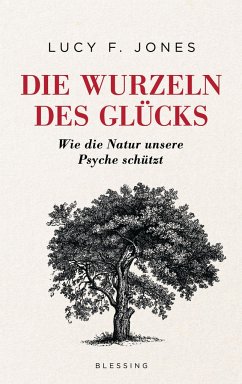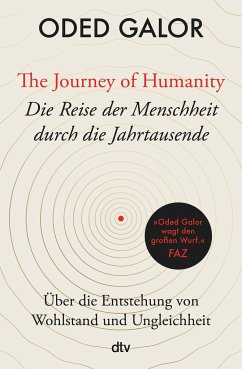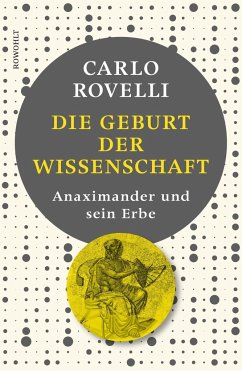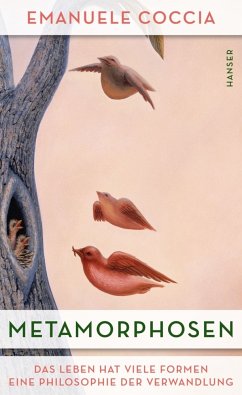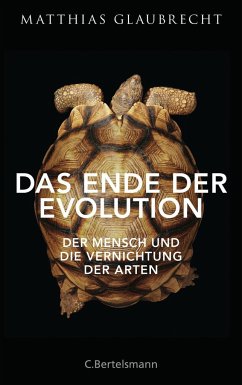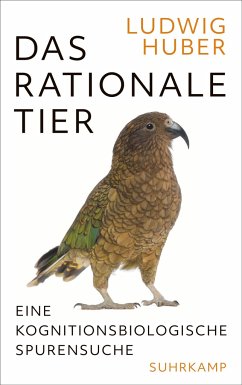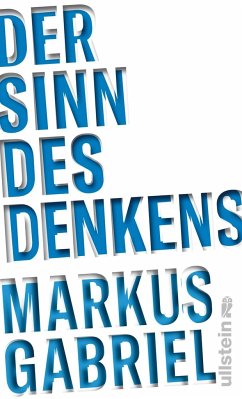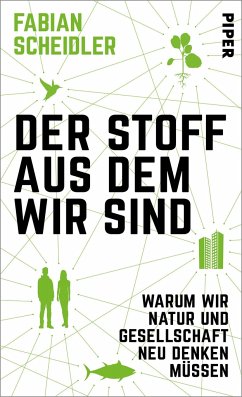Am Beispiel des Nocebo-Effektes lässt sich die krankmachende Wirkung krankmachender Vorstellungen am leichtesten verstehbar machen. Gerald Hüther weiß: „Der menschliche Organismus verfügt über Selbstheilungskräfte, die ihre Wirkung insbesondere über die im gesamten Organismus ausgebreiteten integrativen Systeme entfalten: das autonome Nervensystem, das Hormonsystem, das kardiovaskuläre System und das Immunsystem.“ Gesteuert und koordiniert wird deren Aktivität im Gehirn nicht von der Hirnrinde, sondern von neuronalen Netzwerken, die in entwicklungsgeschichtlich älteren und tiefer im Hirn gelegenen Bereiche lokalisiert sind. Diese Netzwerke dienen der Regulation der im Körper ablaufenden Prozesse. Sie sind nicht daran beteiligt, wenn sich ein Mensch etwas vorstellt oder ausdenkt. Deshalb gibt es diese Netzwerke auch schon bei den Krokodilen. Solange sie in ihren Aktivitäten und ihrem Zusammenwirken durch nichts gestört werden, ist alles gut. Gerald Hüther ist Neurobiologe und Verfasser zahlreicher Sachbücher und Fachpublikationen.
Wissenschaft
In der Luftfahrt ist die Idee des Fehlermanagements entstanden
Die Ursprünge von Fehlerkultur liegen in einem Bereich, der mit Psychogeschwätz rein gar nichts zu tun hat: in der Luftfahrt. Helene Bubrowski erklärt: „Fehler sind hier besonders gefährlich. Man möchte sich vorstellen, dass Piloten und Towerlotsen zu Menschen gewordene Präzisionsgeräte sind, denen nichts entgeht, die immer sofort und richtig reagieren.“ Auf den ersten Blick erscheint es daher paradox, dass sich gerade hier die Idee vom Fehlermanagement entwickelt hat. Aber eben nur auf den ersten Blick. Nach schweren Unfällen in der Luftfahrt machte sich die amerikanische Luftfahrtbehörde auf die Suche nach strukturellen Problemen. Ein erster Befund war, dass in der großen Mehrheit der Fälle, mehr als achtzig Prozent, der Kapitän am Steuer saß. Helene Bubrowski arbeitet als Politikkorrespondentin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung im Berliner Hauptstadtbüro.
Die Menschheit greift in die natürlichen Klimaveränderungen ein
Heute greift die menschliche Zivilisation in ihrer Gesamtheit in die natürlichen Klimaveränderungen ein, indem sie Kohlenstoff, der während Jahrmillionen der Atmosphäre entzogen wurde, innerhalb weniger Jahrzehnte verfeuert und Kalkstein unter Freisetzung von Kohlendioxid in Beton verwandelt. Worin liegt das Problem? Gunter Mair erläutert: „Kohlendioxid ist ein Treibhausgas. Es lässt die Sonneneinstrahlung zum Erdboden durch, absorbiert und reflektiert aber die langwelligere Infrarotstrahlung, die von der Erde zurückgestrahlt wird, und wirkt damit wie die Glasscheibe eines Gewächshauses.“ Seit Beginn der Ausbeutung von Kohle, Erdöl und Gas wurden global rund 2000 Gigatonnen Kohlendioxid ausgestoßen, wodurch der atmosphärische Gehalt von vorindustriellen 280 -Anteile pro Million – ppm auf heute 410 ppm stieg. Dr. Gunther Mair arbeitete als promovierter Chemiker in der chemischen Großindustrie und entdeckte dort sein Interesse für die Klimagasproblematik.
Die Bildung prägt die Persönlichkeit eines Menschen
Auf formaler Ebene fasst man Bildung einerseits als ein Produkt, als die Ausprägung der Persönlichkeit eines Menschen, auf. Und andererseits beschreibt der Begriff „Bildung“ auch den Prozess, wie diese Persönlichkeitsausprägungen vermittelt werden. Markus Hengstschläger erklärt: „Auf inhaltlicher Ebene gilt es zu fragen, welche Persönlichkeitsausprägungen gesellschaftlich wünschenswert sind. Gerade die Ansichten darüber ändern sich aber mit der Zeit.“ Es gab Zeiten, in denen abrufbares Faktenwissen dabei im Vordergrund stand. Heute wird neben fachlichen Qualifikationen immer mehr auch auf soziokulturelle Kompetenzen Wert gelegt. Unter Kompetenzen versteht man in der Regel Fähigkeiten und Fertigkeiten, die es ermöglichen zu handeln, Situationen zu bewältigen, Aufgaben auszuführen und Probleme zu lösen. Was man unter „Wissen“ versteht, ist in der heutigen Zeit oft Inhalt unendlich erscheinender Diskussionen. Professor Markus Hengstschläger ist Vorstand des Instituts für Medizinische Genetik an der MedUni Wien.
Selbst die Logik kann den Kern der Dinge nicht erfassen
Die Offenheit des Geistes, dieses treue Folgen des Verstandes, führte über eine Arbeit von mehreren Jahrhunderten zu den sublimsten Einsichten. Die großen Physiker der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bewiesen auf die konkreteste Weise, dass man den Kern der Materie nicht unabhängig vom beobachteten Subjekt betrachten kann. Denn die Beobachtung eines Subjekts verändert das Subjekt selbst. Matthias Desmet erläutert: „So zeigte Werner Heisenberg in seiner berühmten Unschärferelation, dass selbst rein materielle „Fakten“, wie die Lokalisierung von Teilchen in Zeit und Raum, nicht eindeutig bestimmbar sind.“ Die großen Geister, die der Ratio und den Fakten am treuesten folgten, kamen sogar zu dem Schluss, dass der Kern der Dinge letztlich nicht in Logik zu fassen sei. Mattias Desmet ist Professor für Klinische Psychologie an der Abteilung für Psychoanalyse und klinische Beratung der Universität Gent.
Manche Menschen sprechen mit Pflanzen
Für Menschen, die mit Pflanzen sprechen, wie Prinz Charles es angeblich tut, muss man eine besondere Schwäche haben. Man muss anerkennen, dass Gespräche mit Pflanzen nicht nur die Anerkennung wertvoller Formen nichtmenschlichen Lebens bedeuten. Sondern man muss auch den Respekt für die Idee würdigen, dass gute Pflege, ob tatsächlich oder poetisch in Form freundlicher Worte, für das Leben nichtmenschlicher Lebewesen etwas bedeutet. Das ist ein wahrhaft liebenswürdiger Gedanke. Antonio Damasio hat keine Ahnung, ob Prinz Charles wirklich etwas über Botanik im Besonderen oder über Biologie im Allgemeinen weiß. Aber es gibt für ihn viele Gründe, Pflanzen zu respektieren und zu lieben. Antonio Damasio ist Dornsife Professor für Neurologie, Psychologie und Philosophie und Direktor des Brain and Creativity Institute an der University of Southern California.
Variablen beschreiben die Welt
In der Welt herrscht Veränderung. Es gibt eine zeitliche Struktur von Beziehungen zwischen Ereignissen, die alles andere als illusorisch sind. Sie ist kein global geordnetes Geschehen. Sondern sie ist ein lokales und komplexes Ereignis, das es nicht zulässt, in Begriffen einer einzigen globalen Ordnung beschrieben zu werden. Die Dinge des Lebens an sich sind zerbrechlich, kurz und voller Illusionen. Wie funktioniert eine grundlegende Beschreibung der Welt? Carlo Rovelli antwortet: „Auf die einfachste Art. So wie wir die Welt dachten, bis Isaac Newton und alle davon überzeugte, dass eine Zeitvariable unverzichtbar sei.“ Für Carlo Rovelli jedoch ist die Zeitvariable für eine Beschreibung der Welt nicht notwendig. Seit dem Jahr 2000 ist Carlo Rovelli Professor für Physik an der Universität Marseille.
Künstliche Intelligenz hat keine Intuitionen
Schon Dreijährige begreifen, dass Menschen im Gegensatz zu Objekten Absichten und Wünsche haben. Die schließen intuitiv aus Blicken, Körperbewegungen oder Tonfällen auf die Absichten anderer Menschen. Gerd Gigerenzer weiß: „Die Fähigkeit, anderen Menschen Absichten zuzuschreiben, bezeichnet man auch als Theorie des Geistes (Theorie of Mind).“ Sie trägt beispielsweise zum sicheren Fahren im Straßenverkehr bei. Wenn ein Kind an der Bordsteinkante einer vielbefahrenen Straße steht, können menschliche Fahrer in einem Sekundenbruchteil erkennen, ob das Kind die Absicht hat, auf die Straße zu laufen oder nicht. Wenn das Kind einen Ball auf der anderen Straßenseite im Blick hat, könnte das sehr wohl passieren. Blickt das Kind dagegen eine Frau direkt neben sich an, ist das unwahrscheinlich. Das Gottlieb Duttweiler Institut hat Gerd Gigerenzer als einen der hundert einflussreichsten Denker der Welt bezeichnet.
Der Organismus ist auf Energiesparen getrimmt
Da der Homo sapiens in den Grundfunktionen noch wie ein Steinzeitmensch funktioniert, ist sein Organismus auf Energiesparen getrimmt. Franc Cerutti weiß: „Unser Gehirn will faul sein. Daher nutzt es bereits existierende Nervenverbindungen viel lieber, als sich energieaufwendig neue schaffen zu müssen.“ Vertrautes, gewohntes und alltägliches Denken gleicht dem Fahren auf einer vierspurigen Autobahn. Neues, unvertrautes und daher noch unverknüpftes Denken gleicht dahingegen eher der mühsamen Bahnung eines neuen Trampelpfads durch unwegsames Gelände. Das kostet Kraft. Das menschliche Gehirn vermeidet es lieber. Und genau das kann im Leben eines Menschen zu ausgewachsenen Problemen führen. Fast jeder kennt zum Beispiel diesen Konflikt: Man reagiert angsterfüllt, obwohl man weiß, dass es nichts zum Fürchten gibt. Franca Cerutti ist Psychotherapeutin mit eigener Praxis und Podcasterin.
Intelligenz setzt einen Geist voraus
Intelligenz, Geist und Bewusstsein stellen für Antonio Damasio drei heimtückische Begriffe dar. Denn zu klären, was sie bedeuten, ist eine nie endende Aufgabe. Intelligenz ist aus der allgemeinen Sicht aller Lebewesen die Fähigkeit, erfolgreich die Probleme zu lösen, die der Kampf ums Leben aufwirft. Allerdings liegt eine beträchtliche Wegstrecke zwischen der Intelligenz von Bakterien und der Intelligenz eines Menschen. Genauer gesagt, ist es eine Entfernung von Milliarden Jahren der Evolution. Wie nicht anders zu erwarten, sind auch das Spektrum solcher Intelligenzen und ihrer jeweiligen Errungenschaften ganz unterschiedlich. Explizite menschliche Intelligenz ist niemals einfach oder klein. Sie setzt einen Geist und die Mithilfe mit dem Geist verwandter Vorgänge voraus: Fühlen und Bewusstsein. Antonio Damasio ist Dornsife Professor für Neurologie, Psychologie und Philosophie und Direktor des Brain and Creativity Institute an der University of Southern California.
Komplexe Dinge sind vielschichtig
Der Alltag kann kompliziert sein. Das wissen fast alle Menschen. Die Beziehung. Die Bedienung des neuen Telefons. Die Steuererklärung. Im Englischen spricht man von „a lot of moving parts“. Dirk Brockmann erläutert: „Wenn also verschiedene Teile gleichzeitig in Bewegung sind, voneinander abhängen, Einfluss aufeinander üben und man schnell den Überblick verliert, dann ist etwas kompliziert.“ Aber sind komplizierte Dinge auch komplex? Und umgekehrt komplexe Systeme zwangsläufig kompliziert? Das Wörterbuch leitet „komplex“ aus dem Lateinischen ab: cum = miteinander, plectere = flechten. Es bedeutet also „verflochten, vielschichtig“. Ein komplexes System besteht aus verschiedenen Elementen, die miteinander verbunden sind. Und sie bilden wie Flechtwerk eine Struktur, die man in den Einzelelementen nicht erkennen kann. Der Komplexitätswissenschaftler Dirk Brockmann ist Professor am Institut für Biologie der Berliner Humboldt-Universität.
Die Psyche und das Gehirn sind eng verbunden
Wenn man über die Psyche spricht, spricht man auch über das Gehirn. Genauer: über das gesamte Nervensystem. Franca Cerutti weiß: „Die Trennung zwischen Psyche und Körper und die Vorstellung, als sei die Psyche etwas, was den Körper „bewohnt“, ist schlicht und einfach falsch. Wir haben keinen Körper, wir sind ein Körper.“ Menschen sind Chemie und Strom, sie sind Botenstoffe und Hormone. Gleichzeitig sind sie, wie Aristoteles schon sagte, als Ganzes mehr als die Summe ihrer Teile. Menschen sind die Magie, die sich aus dem gesamten komplexen, verzahnten Geschehen ergibt. Und wie könnte dieses ganze System stets und ständig bei jedem „normal“ laufen? Das menschliche Gehirn ist wohl das komplizierteste Organ, das sich im Laufe der Evolution entwickelt hat. Franca Cerutti ist Psychotherapeutin mit eigener Praxis und Podcasterin.
Naturverbundenheit wirkt sich positiv auf die Gesundheit aus
Mehr und mehr erkennt man, dass wichtige Zusammenhänge zwischen dem menschlichen Nervensystem, der Immunfunktion und der Stimmung gibt. Lucy F. Jones ergänzt: „Neueste Fortschritte auf dem Gebiet der Genetik zeigen, dass mit Depressionen assoziierte Gene auch Verbindungen zum Nerven- und Immunsystem haben.“ Naturverbundenheit wirkt sich positiv auf die Immunfunktion des menschlichen Körpers aus, sei es durch eine Entspannung des Nervensystems oder das Verfliegen von Ängsten und Sorgen. Sie verschafft den Menschen durch Phytonzide – die von Bäumen und Pflanzen ausgestoßenen Chemikalien, die das Immunsystem ebenfalls in Schwung bringen können – eine Atempause von verschmutzter Luft. Studien haben gezeigt, dass schon der Blick auf eine natürliche Landschaft zu einem Anstieg entzündungshemmender Zytokine führen kann. Lucy F. Jones ist Journalistin und schreibt regelmäßig zu wissenschaftlichen Themen, Gesundheit, Umwelt und Natur für die BBC, The Guardian und The Sunday Times.
Menschliche Säuglinge sind hilflos
Das Gehirn von Menschenbabys ist bei der Geburt „unausgereift“. Es benötigt Jahre der Feinabstimmung, um zur Reife zu gelangen. Deshalb sind menschliche Säuglinge hilflos. Menschen benötigen einige Jahre, bevor sie ohne Hilfe und sicher gehen, und noch viele weitere Jahre, bis sie sich materiell selbst versorgen können. Oded Galor stellt fest: „Doch ungeachtet dieser Nachteile stellt sich die Frage, was überhaupt zur Entwicklung des menschlichen Gehirns geführt hat. Forschern zufolge könnten verschiedene Kräfte gemeinsam zu diesem Prozess beigetragen haben.“ Der „ökologischen Hypothese“ nach ist die Entwicklung des menschlichen Gehirns darauf zurückzuführen, dass der Homo sapiens bestimmten Herausforderungen durch die Umwelt ausgesetzt war. Der renommierte Ökonom Oded Galor untersucht in seinem neuen Buch „The Journey of Humanity“ die Entwicklungen die zu Wohlstand und Ungleichheit führten.
Probleme sind oft schlecht formuliert
Zu allen Zeiten gab es geniale Eingebungen, die zu großen Fortschritten geführt haben. Diese entstanden jedoch nicht aus Entdeckungen neuartiger Lösungen für wohlbekannte Probleme. Carlo Rovelli betont: „Sie entstanden aus der Erkenntnis, dass das Problem schlecht formuliert war. Aus diesem Grund kann der Versuch, wissenschaftliche Revolutionen als Lösungen wohldefinierter Probleme zu erklären, nicht funktionieren.“ Die Wissenschaft macht Fortschritte, indem sie Probleme löst. Und die Lösung impliziert in den allermeisten Fällen eine Neuformulierung des Problems selbst. Anaximander löste keine offene Frage der babylonischen Astronomie. Ihm wurde klar, dass das babylonische Denken das Problem war und es galt, die Frage umzuformulieren. Er erklärte nicht, wie sich der Himmel über den Köpfen der Menschen bewegt, sondern er verstand, dass der Himmel nicht nur über den Köpfen der Menschen liegt. Seit dem Jahr 2000 ist Carlo Rovelli Professor für Physik an der Universität Marseille.
Es gibt sechs bis zehn Millionen Insektenarten
Insekten sind überall. Sie sind zahlreich. Sie unterscheiden sich so stark voneinander wie keine andere Klasse des Lebendigen. Eine erdrückende Mehrheit der tierischen Biodiversität – 90 Prozent – verdankt sich ihrem anatomischen Dandytum. Emanuele Coccia erläutert: „Man schätzt die Anzahl ihrer Arten auf sechs bis zehn Millionen. Ihr somatischer Einfallsreichtum beschränkt sich dabei nicht nur auf die Erfindung neuer, spezifischer Identitäten.“ Sie besitzen auch die Gabe, derart verschiedene Körper im Laufe eines individuellen Lebens zu bilden, dass man sie lange Zeit für magische Wesen hielt, die von einer Spezies zur anderen wechseln konnten. Die Insekten machen die Biodiversität des Planeten zu einer Frage der persönlichen Virtuosität. Emanuele Coccia ist Professor für Philosophiegeschichte an der École des Hautes Études en Sciences Sociales in Paris.
Eine gemeinsame Gegenwart im Universum gibt es nicht
Die meisten Menschen gehen von einem Bild der Zeit aus, das ihnen vertraut ist. Etwas, das gleichförmig und überall im Universum einheitlich abläuft, in dessen Verlauf sich alle Dinge ereignen. Carlo Rovelli erläutert: „Es gibt im ganzen Kosmos eine Gegenwart, ein „Jetzt“, das die Realität ist. Die Vergangenheit ist fix, geschehen und für alle dasselbe, die Zukunft offen und noch unbestimmt. Die Realität läuft von der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft.“ Mit Blick auf die Vergangenheit und Zukunft verläuft die Entwicklung der Dinge realerweise asymmetrisch. Dies, so dachten die meisten Menschen, sei die Grundstruktur der Welt. Doch dieses vertraute Bild ist zerbröckelt, hat sich als reine Näherung einer Näherung an eine komplexere Realität erwiesen. Seit dem Jahr 2000 ist Carlo Rovelli Professor für Physik an der Universität Marseille.
Das Gehirn besitzt 86 Milliarden Nervenzellen
Es mag naheliegen, die Vergrößerung seines Gehirns mit er Lebensweise des Menschen und seinen besonderen Fertigkeiten und Fähigkeiten zu verknüpfen. Und so ist auch vielfach ein Zusammenhang insbesondere mit der Ernährung, mit der Handfertigkeit, mit Werkzeuggebrauch, Sprache, Kultur und Kunst vermutet worden. Matthias Glaubrecht betont: „Und doch ist bislang nicht überzeugend geklärt, was wirklich das Gehirn zu einem solch besonderen Organ beim Menschen gemacht hat.“ Zugleich gehört es zweifelsohne zu den erstaunlichsten Paradoxien in der Natur, dass ausgerechnet Menschen als an sich anderweitig unspezialisierte Generalisten ein sehr spezielles Organ spazieren tragen. Da es in energetischer Hinsicht alles andere als verbrauchsneutral kam, muss das menschliche Gehirn einen hohen Auslesewert gehabt haben. Immerhin dienen in ihm heute 86 Milliarden Nervenzellen der Weiterleitung und Verarbeitung von Reizen. Matthias Glaubrecht ist Evolutionsbiologe, Systematiker und Wissenschaftshistoriker.
Tauben unterscheiden charakteristische Merkmale
In seiner Doktorarbeit hat Ludwig Huber Versuche mit Tauben beschrieben, die Kategorisierungen mithilfe von Wahrnehmungskonzepten vornehmen. Er konnte zeigen, dass diese Vögel sehr schnell komplexe Reizklassen nach von ihm vorgegebenen Kriterien unterscheiden und nach den von ihm festgelegten Kategorisierungsregeln einordnen konnten. Wie Ludwig Huber mit vielen weiteren Versuchen mit Tauben zeigen konnte, verfügen diese über … Weiterlesen
Zum Geist gehören die Gefühle
Ein Nervensystem ermöglicht sowohl komplizierte Bewegungen als auch letztlich die Anfänge einer echten Neuerung: des Geistes. Antonio Damasio erklärt: „Zu den ersten Phänomenen des Geistes gehören die Gefühle. Ihre Bedeutung kann man kaum zu sehr hervorheben.“ Gefühle versetzen Lebewesen in die Lage, in ihrem jeweiligen Geist die verschiedensten Dinge zu repräsentieren. Nämlich den Zustand des eigenen Körpers, der damit beschäftigt ist, die Funktionen der inneren Organe zu regulieren, damit diese die Notwendigkeit des Lebens wie Essen, Trinken und Ausscheidung erfüllen können. Zum Beispiel die Abwehrhaltung, wie sie bei Furcht oder Wut, Abscheu oder Verachtung auftritt. Dazu gehört ebenso die Zurschaustellung von Wohlbefinden, Freude und Überschwang sowie auch die Verhaltensweisen, die im Zusammenhang mit der Fortpflanzung stehen. Antonio Damasio ist Dornsife Professor für Neurologie, Psychologie und Philosophie und Direktor des Brain and Creativity Institute an der University of Southern California.
Die Zeit fließt dahin
Der britische Mathematiker und theoretische Physiker Roger Penrose ist für Carlo Rovelli einer der brillantesten Forscher, die sich mit Raum und Zeit befassten. Er kam zu dem Schluss, dass die relativistische Physik mit dem menschlichen Gefühl, dass die Zeit dahinfließt, keineswegs unvereinbar ist. Aber anscheinend ist das nicht genug. Er deutete an, dass das fehlende Element im Erklärungspuzzle das sein könnte, was in einer Quantenwechselwirkung geschieht. Alain Connes, ein herausragender französischer Mathematiker, fand eine treffende Möglichkeit, um die Rolle der Quantenwechselwirkung beim Ursprung der Zeit dingfest zu machen. Carlo Rovelli erklärt: „Wenn sich in einer Wechselwirkung der Ort eines Moleküls konkretisiert, verändert sich dessen Zustand. Das Gleiche gilt für seine Geschwindigkeit.“ Seit dem Jahr 2000 ist Carlo Rovelli Professor für Physik an der Universität Marseille.
Das menschliche Denken ist ein Sinn
Das menschliche Denken ist ein Sinn. Markus Gabriel erläutert: „Unser Denksinn setzt uns in Kontakt mit einer Unendlichkeit an Möglichkeiten und Wirklichkeiten, den Sinnfeldern.“ Das Besondere am menschlichen Denksinn besteht darin, dass man mit einer beeindruckend hohen Auflösung die Tiefenstrukturen des Universums ausloten kann. Zudem kann man die Abgründe des Geistes, die Kunstgeschichte, Kreuzworträtsel und vieles Weitere erforschen. Das gelingt den Menschen deswegen, weil die Gegenstände des Denksinns insgesamt logisch strukturiert sind. Jeder Sinn hat spezifische Sinnesqualitäten, Qualia, die er direkt aufnimmt. Menschen hören Töne, sehen Farben, fühlen Wärme, denken Gedanken und so weiter. Seit 2009 hat Markus Gabriel den Lehrstuhl für Erkenntnistheorie und Philosophie der Neuzeit an der Universität Bonn inne. Zudem ist er dort Direktor des Internationalen Zentrums für Philosophie.
Die Entstehung des Lebens ist immer noch ungeklärt
Die Geschichte des Lebens war keine gleichmäßige Entwicklung. Sondern sie war charakterisiert durch lange Phasen, oft über Hunderte von Millionen Jahren, in denen wenig Neues geschah. Plötzlich entstanden dann durch „Sprünge“ in verhältnismäßig kurzer Zeit vollkommen neue Organisationsformen. Der Evolutionsbiologe Stephen Jay Gould und der Paläontologe Niles Eldredge sprachen angesichts dieser stark schwankenden Geschwindigkeiten auch von einem „punktierten Gleichgewicht“. Fabian Scheidler weiß: „Evolutionäre Sprünge zeichnen sich oft dadurch aus, dass zuvor getrennte Elemente zu neuen integrierten Einheiten verbunden werden, die vollkommen neue Eigenschaften aufweisen.“ Diese neuen Eigenschaften lassen sich nicht aus dem Verhalten der einzelnen Teile ableiten oder auf sie reduzieren. Sie tauchen erst auf der höheren Integrationsebene auf. Der Publizist Fabian Scheidler schreibt seit vielen Jahren über globale Gerechtigkeit.
Die Forschung konstruiert ein Bild der Welt
Das explizite Ziel wissenschaftlicher Forschung ist nicht, korrekte quantitative Vorhersagen zu machen, sondern zu verstehen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Was bedeutet das? Carlo Rovelli antwortet: „Es bedeutet, ein Bild der Welt zu konstruieren. Das heißt eine konzeptuelle Struktur des Denkens über die Welt zu entwickeln, die effizient und kompatibel mit dem ist, was wir über sie wissen.“ Die Naturwissenschaften existieren, weil die Menschheit sehr wenig weiß und unzählige falsche Annahmen hegt. Wissenschaft wird aus dem geboren, was die Menschen nicht wissen und dem Bezweifeln dessen, was sie zu wissen meinen. Diese Meinung hält aber einer rationalen Überprüfung oder einer kritischen Analyse nicht stand. Seit dem Jahr 2000 ist Carlo Rovelli Professor für Physik an der Universität Marseille.
Algorithmen benötigen eine stabile Welt
Beim Online-Dating hat zwar jede Person ein Profil, aber das Profil ist nicht die Person. Gerd Gigerenzer weiß: „Die Menschen neigen dazu, ihre Profile zu schönen. Und selbst wenn sie gewissenhaft zu Werke gehen, wird das Profil nicht der Vielschichtigkeit eines Menschen gerecht.“ Allgemeiner kommt diese Erkenntnis im „Prinzip der stabilen Welt“ zum Ausdruck. Komplexe Algorithmen arbeiten am zuverlässigsten in wohldefinierten, stabilen Situationen, in denen große Datenmengen zur Verfügung stehen. Die menschliche Intelligenz dagegen hat sich entwickelt, um Ungewissheit zu bewältigen, unabhängig davon, ob Big oder Small Data vorliegen. Die Regeln von Schach oder Go sind wohldefiniert und insofern stabil, als sie heute und morgen gelten. Gerd Gigerenzer ist ein weltweit renommierter Psychologe. Das Gottlieb Duttweiler Institut hat Gigerenzer als einen der hundert einflussreichsten Denker der Welt bezeichnet.