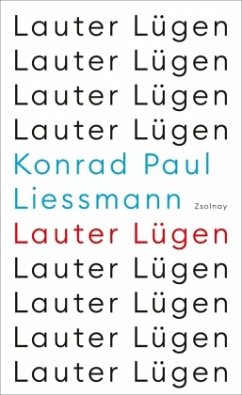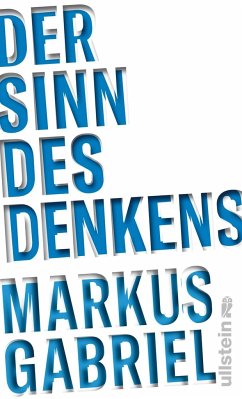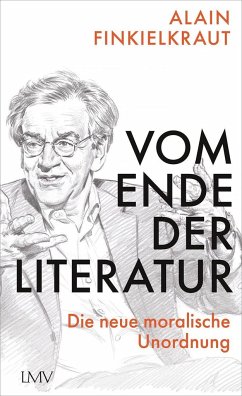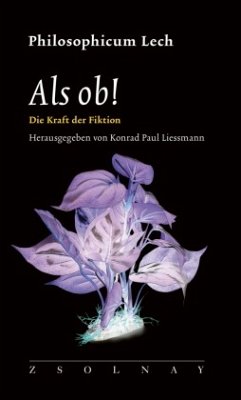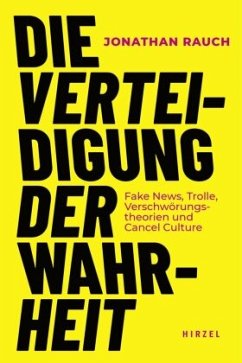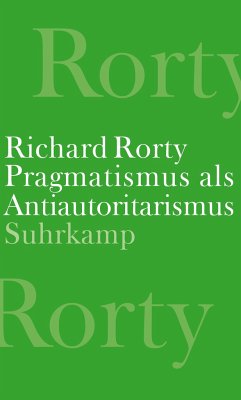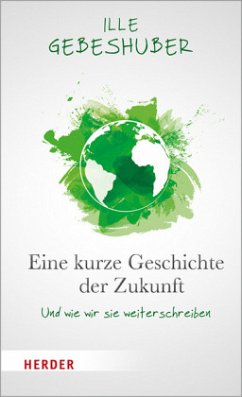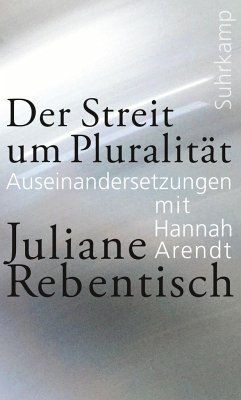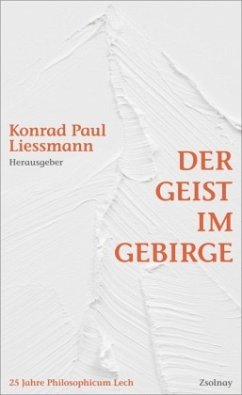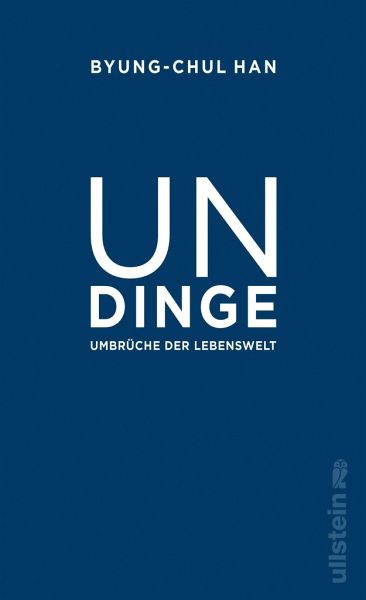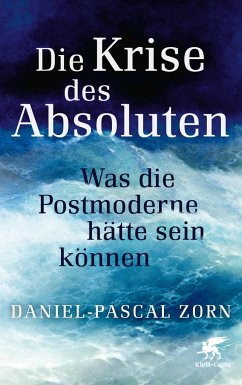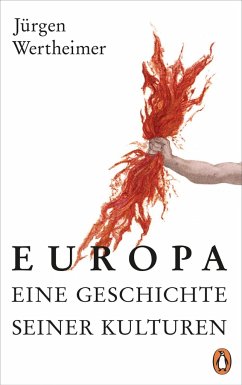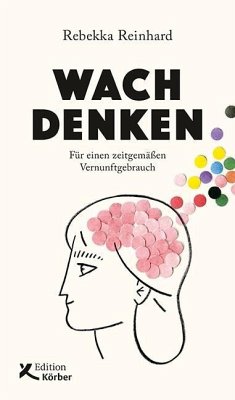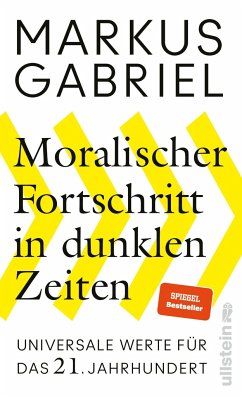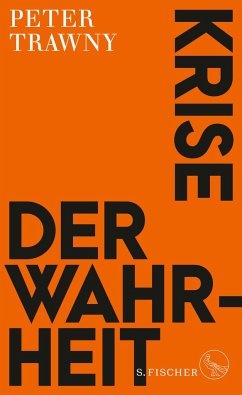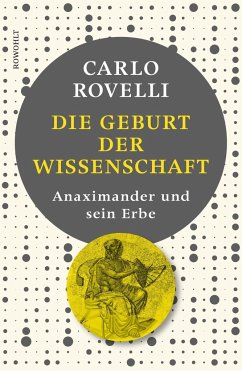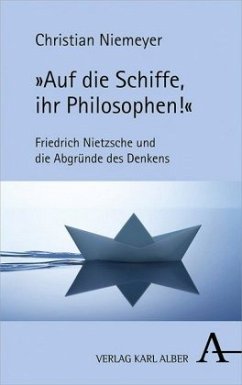Konrad Paul Liessmann stellt fest: „Es ist die angedeutete oder demonstrierte Entblößung vor allem jener Körperteile, die das Begehren und den Sex symbolisieren, die in der Öffentlichkeit das zweideutige Interesse an der Nacktheit generieren.“ Und dies nicht nur, weil der öffentliche Raum nicht der richtige Ort für intime Signale ist. Sondern vor allem deshalb, weil das Erotische selbst der vollkommenen Entblößung gegenüber höchst ambivalent ist. Das Erotische lebt von einer Gestik des Entblößens. Diese weiß, dass das Wechselspiel von Enthüllen und Verhüllen nicht nur in einem faktischen Sinn das Begehren strukturiert. Sondern sie gibt dem Eros auch seine philosophische Dignität. Denn immerhin dachte sich das Abendland die Wahrheit als ein Weib, die seiner Enthüllung harrt. Konrad Paul Liessmann ist Professor emeritus für Philosophie an der Universität Wien, Essayist, Literaturkritiker und Kulturpublizist.
Wahrheit
Ohne Gottlob Frege gäbe es heute keine digitale Revolution
Gottlob Frege gehört für Markus Gabriel zu den größten Logikern aller Zeiten. Als Mathematiker hat er maßgeblich zur Erfindung moderner symbolischer Logiken beigetragen. Das heißt, zu den mathematischen Zeichensystemen, die man heute noch verwendet, um die abstrakten Gedanken der Mathematik auszudrücken. Markus Gabriel stellt fest: „Gottlob Frege hat eine eigene Schriftsprache erfunden, um auf diese Weise die logischen Beziehungen zwischen Gedanken übersichtlicher darstellen zu können.“ Diese Schriftsprache nennt er die „Begriffsschrift“. Ohne Gottlob Freges Begriffsschrift gäbe es heute keine digitale Revolution. Er hat auch eine der wichtigsten Texte über das Denken geschrieben, seinen unscheinbaren kleinen Aufsatz „Der Gedanke“ von 1918. Markus Gabriel hat seit 2009 den Lehrstuhl für Erkenntnistheorie und Philosophie der Neuzeit an der Universität Bonn inne. Zudem ist er dort Direktor des Internationalen Zentrums für Philosophie.
Vor dem Bildschirm sitzen die Zuschauer stets in der ersten Reihe
Von den Menschen früherer Zeiten unterscheidet die heute lebenden, dass sie Zuschauer geworden sind. Alain Finkielkraut erklärt: „Wir schauen Ereignissen zu, von denen unsere Vorgänger durch mündliche Berichte oder die Lektüre erfuhren. Dieses „Wir“ kennt keine Ausnahme mehr: Ganz gleich, wo wir leben, mit dem Bildschirm sitzen wir stets in der ersten Reihe.“ Das Bild von George Floyd, dem am 25. Mai 2020 in Minneapolis gezielt die Luft abgedrückt wurde, ist um die ganze Welt gegangen, ein unerträgliches Bild. „Ich kann nicht atmen“, keuchte der Farbige, während ihm sein Peiniger ungerührt und sogar lächelnd das Knie auf den Hals drückte, bis er starb. Die Amerikaner, die danach spontan auf die Straße gegangen sind, um ihre Empörung kundzutun, versteht Alain Finkielkraut umso besser, als der Mord an George Floyd nicht der erste seiner Art war. Alain Finkielkraut gilt als einer der einflussreichsten französischen Intellektuellen.
Ein Fake verfolgt meist unlautere Absichten
Thomas Strässle stellt fest: „Die gegenwärtige Debatte über den Fake ist in erster Linie eine politische Debatte, keine philosophische oder ästhetische. Sie hat es mit einem Phänomen zu tun, das sich als manipulativer Übergang an Fiktionalität über die Faktizität beschreiben lässt.“ Solche Manipulationen können aus unterschiedlichsten Gründen und mit verschiedenen Zielen geschehen. Sie erfolgen aber meist aus unlauteren Absichten. Entsprechend trägt die Debatte auch moralische Züge. Der Fake gilt als eine Plage der Gegenwart, die mit allen Mitteln bekämpft und nach Möglichkeit wieder aus der Welt geschafft werden soll. Univ. – Prof. Dr. Thomas Strässle ist Leiter des spartenübergreifenden Y Instituts an der Hochschule der Künste in Bern. Zudem ist er Professor für Neuere deutsche und vergleichende Literaturwissenschaft an der Universität Zürich.
Die Vernunft ist die Sklavin der Leidenschaften
Seit Platon waren sich die Philosophen bewusst, dass die Sinne täuschen und Überzeugungen irregeleitet sein können. Aber sie nahmen an, dass den Menschen von Natur aus ein Drang zur Wahrheit innewohne und die Vernunft sie auf dem Weg zu ihr leiten würde. Jonathan Rauch blickt zurück: „Vor fast 300 Jahren formulierte der schottische Philosoph David Hume seine Kritik an dieser Standardauffassung.“ In seinem „Traktat über die menschliche Natur“ trug er eine der in dieser Sache entschiedensten und bekanntesten Thesen vor. Er schreibt: „Die Vernunft ist die Sklavin der Leidenschaften und sollte auch nur das sein. Auf kein anderes Amt kann sie Anspruch erheben als ihnen zu dienen und zu gehorchen.“ Jonathan Rauch studierte an der Yale University. Als Journalist schrieb der Politologe unter anderem für das National Journal, für The Economist und für The Atlantic.
Die meisten Gemeinschaften sind exklusivistisch orientiert
Richard Rorty schreibt: „Die Frage, ob es Überzeugungen und Wünsche gibt, die allen Menschen gemeinsam sind, ist ziemlich uninteressant, wenn man nicht von der Vorstellung einer utopischen, inklusivistischen Menschengemeinschaft ausgeht, die nicht mit der Entschiedenheit, mit der sie Fremde ausschließt, stolz ist, sondern auf die Verschiedenheit der Arten von Menschen, die sie willkommen heißt.“ Die meisten menschlichen Gemeinschaften sind jedoch exklusivistisch orientiert. Ihr Identitätsgefühl und das Selbstbild ihrer Angehörigen beruhen auf ihrem Stolz darauf, bestimmten Arten von Menschen nicht anzugehören. Nämlich denen, die den falschen Gott verehren, die falschen Nahrungsmittel essen oder irgendwelche anderen abwegigen, abstoßende Überzeugungen oder Wünsche haben. Richard Rorty (1931 – 2007) war einer der bedeutendsten Philosophen seiner Generation. Zuletzt lehrte er Vergleichende Literaturwissenschaft an der Stanford University.
Die Welt ist zu kompliziert geworden
Viele Menschen hoffen insgemein, der Weg in eine bessere Welt sei möglich. Doch selbst Übermorgen werden die Politiker der Welt auch keine Lösung für die Probleme der Welt finden. Ille C. Gebeshuber stellt fest: „Selbst der einfache Ansatz, dass der erste Schritt in eine bessere Welt darin besteht, dass alle die Regeln und Gesetze unserer Gesellschaft einhalten, erscheint undurchführbar.“ Die Bürger sehen, dass die Ankündigungen großer Schritte, die man nie ausführt, viel einfacher ist als das Gehen kleiner Schritte, die sofort Geld und Aufwand kosten. Zu kompliziert ist die Welt geworden und zu groß sind die Eigeninteressen einzelner. Aber man weiß einige Dinge. Zum einen weiß man, dass der Weg der globalen Gesellschaft nicht mehr lange so weitergehen kann. Ille C. Gebeshuber ist Professorin für Physik an der Technischen Universität Wien.
In der Politik wurde immer schon gelogen
Bei der Gegenwart, so kann man lesen, handelt es sich um ein postfaktisches Zeitalter. Konrad Paul Liessmann stellt fest: „Ungeniert können Populisten Lügen verbreiten, ihre Anhänger wissen das und jubeln trotzdem oder vielleicht gerade deshalb.“ Dem Wahrheitsfreund graut, zumal er ja, so muss man den erschütterten Kommentaren zur „post-truth politics“ entnehmen. Denn er ist in einer Zeit groß geworden, in der Wahrheit in der Politik noch eine entscheidende Kategorie war und sich die Wähler an den besseren und faktengetreuen Argumenten orientierten. Natürlich stimmt diese in die Vergangenheit projizierte Idylle nicht. In der Politik wurde immer schon gelogen und immer schon haben die Anhänger diese Politik das augenzwinkernd akklamiert. Konrad Paul Liessmann ist Professor emeritus für Philosophie an der Universität Wien, Essayist, Literaturkritiker und Kulturpublizist.
Nicht selten verdunkelt sich der Raum der Öffentlichkeit
Heutzutage ist nicht nur eine Abkehr von der Wahrhaftigkeit, sondern auch von der Unterscheidung zwischen Wahrheit und Unwahrheit überhaupt, zu beobachten. Juliane Rebentisch stellt fest: „Die Effekte dieser Abkehr, die mit einer offiziellen Geringschätzung der Welt und der Öffentlichkeit einhergehen, sind dramatisch.“ Denn durch diese Geringschätzung wird nicht nur die Frage, ob etwas wahr oder unwahr ist, ersetzt durch die nach den eigenen Interessen.“ Eine solche Umstellung wird vielmehr die Gemeinsamkeit der Welt, in der allein ihr Bestand gewahrt werden kann, zerfallen lassen. Hannah Arendt schreibt: „In der Geschichte sind Zeiten, in denen der Raum der Öffentlichkeit verdunkelt und der Bestand der Welt fragwürdig wird, nicht selten.“ Juliane Rebentisch ist Professorin für Philosophie und Ästhetik an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach am Main.
Die Täuschung setzt eine Rücksichtnahme auf andere voraus
Täuschungen erfüllen eine wichtige soziale Funktion. Von ihnen kann sogar eine beträchtliche zivilisierende Wirkung ausgehen. Robert Pfaller zieht eine wichtige Schlussfolgerung über die Rolle der Täuschung innerhalb der Kultur: „Die Täuschung setzt eine Rücksichtnahme auf den anderen voraus. Um jemanden täuschen zu können, müssen Sie sich ein Bild von den Wünschen und Erwartungen des anderen gemacht haben.“ Um die Wahrheit zu sagen, braucht man das hingegen nicht. Da muss man sich nur mit dem Sachverhalt beschäftigen, den man beschreibt, nicht aber mit der Person, zu der man spricht. Die Wahrhaftigkeit ist also oft nicht mehr als eine Form der Bequemlichkeit. Man erspart es sich einfach, sich mit dem anderen zu beschäftigen, mit dem man kommuniziert. Prof. Dr. Robert Pfaller lehrt Philosophie an der Kunstuniversität Linz.
Die Wahrheit stabilisiert das Leben der Menschen
Hannah Arendt hält wie Martin Heidegger an der terranen Ordnung fest. So beschwört sie oft Halt und Dauer. Byung-Chul Han fügt hinzu: „Nicht nur Weltdinge, sondern auch die Wahrheit haben menschliches Leben zu stabilisieren. Im Gegensatz zur Information besitzt die Wahrheit eine Festigkeit des Seins.“ Dauer und Beständigkeit zeichnen sie aus. Wahrheit ist Faktizität. Sie leistet jeder Veränderung und Manipulation Widerstand. So bildet sie das Fundament der menschlichen Existenz. Hannah Arendt schreibt: „Wahrheit könnte man begrifflich definieren als das, was der Mensch nicht ändern kann. Metaphorisch gesprochen ist sie der Grund, auf dem wir stehen, und der Himmel, der sich über uns erstreckt.“ Bezeichnenderweise siedelt Hannah Arendt die Wahrheit zwischen Erde und Himmel an. Die Bücher des Philosophen Byung-Chul Han wurden in mehr als zwanzig Sprachen übersetzt.
Die Postmoderne verursacht alle Übel
Die Postmoderne ist an allem schuld. Denn sie ist der Ausgangspunkt für die Übel der Gegenwart, für die vier apokalyptischen Reiter Konstruktivismus, Relativismus, Moralismus und Identitätspolitik. Daniel-Pascal Zorn erklärt: „Für die Postmoderne ist die reale Welt nur eine Konstruktion. Nämlich ein Effekt von Machtansprüchen und anonymen Strukturen, der keinen Zugriff auf eine gemeinsame Wirklichkeit mehr erlaubt: Konstruktivismus.“ Hier gibt es keine Wahrheit mehr, nur noch relative Meinungen, die versuchen, sich gegen andere Meinungen durchzusetzen: Relativismus. Weil man dabei keine verbindlichen Maßstäbe mehr akzeptiert, ersetzt man Fakten und Tatsachen durch fiktive Vorstellungen und gedankliche Konstrukte. Deshalb gelingt die Durchsetzung von Meinungen nur noch mit moralischer Erpressung: Moralismus. Daniel-Pascal Zorn studierte Philosophie, Geschichte und Komparatistik. Seit 2021 ist er Geschäftsführer des Zentrums für Prinzipienforschung an der Bergischen Universität Wuppertal.
Die Pluralität der Meinungen führt zur Wahrheit
Orientiert man sich an Sokrates, so liegt die besondere Stellung des Philosophen gerade nicht in einem gegenüber dem Feld der Meinung substanziell verschiedenen Zugang zur Wahrheit. Auch er kann schließlich die Bedingung der Endlichkeit nicht überwinden. Sie liegt vielmehr in einer Bereitschaft zur staunenden Infragestellung der eigenen Überzeugungen. Nur wenn man die Pluralität der Meinungen selbst vergleicht, kann man allein die Wahrheit erschließen. Und dies immer wieder neu. Juliane Rebentisch erläutert: „Denn in ihrer Abhängigkeit vom Abgleich der Perspektiven muss die Wahrheit geschichtlich und also als fallibel gedacht werden.“ Laut Sokrates besteht die Rolle des Philosophen nicht darin, den Staat zu regieren, sondern dessen Bürger permanent zu irritieren. Juliane Rebentisch ist Professorin für Philosophie und Ästhetik an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach am Main.
John Locke kennt keine Tabus
Kategorien wie Gerechtigkeit, Treue, Schuld, Sünde, Gewissen, alles, woran sich Menschen zu orientieren pflegen, sind nur temporäre Vereinbarungen, Verhandlungssache. John Locke behauptet das nicht einfach, sondern belegt seine These mit reichem empirischem Material. Jürgen Wertheimer erläutert: „Eine Art Gehirnforschung aus dem Geist der anthropologischen Expertise, eine Ethnophilosophie ohne Tabus und Grenzen der Schicklichkeit.“ Es beginnt ein Großreinemachen im Augiasstall der Gewohnheiten, der Vorurteile und mentalen Restbestände aller Couleur. Wenn Menschen das, woran sie zu glauben gewohnt sind, für unumstößliche Wahrheiten halten, benehmen sie sich nicht anders als Kinder, die man blindem Gehorsam lehrte. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass letztlich Gott und die Welt auf dem Spiel stehen. Jürgen Wertheimer ist seit 1991 Professor für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft und Komparatistik in Tübingen.
Freiheit ist zunächst einmal eine Fiktion
Freiheit ist vorab nichts anderes als eine Idee, eine Fiktion, eine Unterstellung. Konrad Paul Liessmann erläutert: „Es mag nun Wesen geben, denen diese Idee gefällt und die gerne danach handeln. In diesem Moment sind sie tatsächlich frei. Es ist genau so, als ob die Freiheit ihres Willens überzeugend nachgewiesen worden wäre. Oder, sehr verkürzt, aber treffend: Wir sind genau dann frei, wenn wir so tun, als wenn wir frei wären.“ Immanuel Kants Moralphilosophie und sein Kategorischer Imperativ beruhen auf diesem „Als ob“, gründen in der Fiktion der Freiheit. Alle damit zusammenhängenden Annahmen haben dieses „Als ob“, die Fiktion zur Voraussetzung. Konrad Paul Liessmann ist Professor für Philosophie an der Universität Wien. Zudem arbeitet er als Essayist, Literaturkritiker und Kulturpublizist. Im Zsolnay-Verlag gibt er die Reihe „Philosophicum Lech“ heraus.
Dem Menschen ist seine Autonomie sehr wichtig
Die Freiheit wird auch heute noch immer hochgeschätzt. Immanuel Kant schrieb einst, dass man von seiner Vernunft in allen Stücken öffentlich Gebrauch machen sollte. Aber um welche Freiheit geht es? Der amerikanische Informatiker und Künstler Jaron Lanier vergleicht moderne Menschen mit Wölfen. Wie kann das sein? Rebekka Reinhard antwortet: „Eigentlich ist der moderne, aus dem soliden Umfeld der Tradition gerissene Mensch doch ein unvergleichliches Individuum, eine Singularität. Dieser Mensch möchte kein skinnerisches Versuchstier sein. Autonomie ist ihm sehr wichtig.“ Die Computer-Logik dagegen übersetzt Vieldeutigkeit in Eindeutigkeit und kennt nur zwei Zustände: Entweder – Oder. So blitzschnell, dass sie wie aus Versehen ein Gleichheitszeichen zwischen „subjektiv“ und „objektiv“ setzt. Die Philosophin Rebekka Reinhard war, bis zur Einstellung der Zeitschrift, stellvertretende Chefredakteurin des Magazins „Hohe Luft“.
Jede Meinung ist zunächst zu gut wie jede andere
Die Idee einer parlamentarischen Demokratie ist darauf angelegt, durch Debatten einen Konsens zu erzeugen, der vorher nicht bestand. In den Konsens sollen, wie bei einem Kompromiss, verschiedene Perspektiven mit einfließen. Damit soll sichergestellt werden, dass möglichst viele Bevölkerungsgruppen, in die sich die Wählerschaft einteilt, repräsentiert sind. Markus Gabriel erklärt: „Im Raum der freien Meinungsäußerung ist somit zunächst einmal jede Meinung so gut wie jede andere.“ Ob sie auch wahr ist, spielt scheinbar keine Rolle. Deshalb führt diese Vorstellung dazu, dass man den Wert der Wahrheit in ethisch dringlichen und schwierigen Fragen durch Strategien der Kompromisslösung ersetzt. Markus Gabriel hat seit 2009 den Lehrstuhl für Erkenntnistheorie und Philosophie der Neuzeit an der Universität Bonn inne. Zudem ist er dort Direktor des Internationalen Zentrums für Philosophie.
Der Klimawandel ist eine Tatsache
Tatsachen sind Wahrheiten, so viel steht fest. Peter Trawny beginnt mit dieser weitverbreiteten Feststellung und bezieht sich dabei auf einen Streit über eine Reaktion auf die Klimakrise. Die Aktivistin Greta Thunberg sagt, dass die Menschheit „schon sämtliche Tatsachen und Lösungen“ zum Problem kennt. Sie muss nur noch „aufwachen und etwas verändern“. Deshalb fordert sie: „Ich will, dass ihr in Panik geratet.“ In Panik geraten kann man in der Tat nur, wenn eine wirkliche Gefahr schon sehr bedrohlich geworden ist. Wenn man nicht mehr daran zweifeln kann, dass man ohne unmittelbare Gegenmaßnahmen Schaden nehmen wird. Daher fügt sie hinzu: „[…] ich sage das nur, weil es wahr ist.“ Peter Trawny gründete 2012 das Matin-Heidegger-Institut an der Bergischen Universität in Wuppertal, dessen Leitung er seitdem innehat.
Die eine unabhängige Wahrheit gibt es nicht
Gotthold Ephraim Lessing war davon überzeugt, dass es die eine unabhängige Wahrheit nicht gibt. Sondern dass es Wahrheit nur durch den Vergleich der Perspektiven verschiedener Menschen geben kann. Denn im Streit der Meinungen, im Prozess des Austauschs von Gründen, ist es möglich, dass die jeweils perspektivischen Bestimmungen der Wahrheit an Allgemeinheit gewinnen. Dadurch werden sie mehr als subjektive, willkürliche Bestimmungen oder bloße Meinungen. Juliane Rebentisch erklärt: „Dennoch aber, und auch das war Lessing durchaus bewusst, kann keine Bestimmung der Wahrheit die Bedingung der Endlichkeit aufheben. Auch die jeweils als allgemein gültig akzeptierten Bestimmungen bleiben prinzipiell an die Möglichkeit ihrer Bestreitung ausgesetzt.“ Nichts, auch das, was sich als Wahrheit etablieren mag, ist vor dieser Möglichkeit sicher oder sollte es sein. Juliane Rebentisch ist Professorin für Philosophie und Ästhetik an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach am Main.
Die absolute Wahrheit gibt es nicht
Absolute Wahrheit mag ein möglicher Gedanke sein, doch er erreicht und berührt die Menschen nicht. Eben weil er in ihrer immer endlichen Perspektive – in ihrem individuellen Leben – keine sie persönlich betreffende Rolle spielt und spielen kann. 1+1=2 lässt sie vollkommen kalt. Peter Trawny ergänzt: „Selbst, wenn ein Leben ohne Rechnen denkbar ist, habe ich keine persönliche Beziehung zu ihm.“ Sind die Menschenrechte eine solche absolute Wahrheit, da sie für jeden Menschen als solchen gelten, so ist doch bis heute offenbar, wie unbedeutend sie sind. Wenn es Menschenrechte gibt, dann müssen diese mit einer Welt zusammenhängen, in der die Menschen wirklich und wahrhaftig leben. Sie müssen also Mitglieder einer Gemeinschaft sein, die für diese Menschen einzutreten in der Lage ist. Peter Trawny gründete 2012 das Matin-Heidegger-Institut an der Bergischen Universität in Wuppertal, dessen Leitung er seitdem innehat.
Es gibt nicht nur eine Wahrheit
Eine Definition der Wahrheit ist, dass sie die möglichst hohe Übereinstimmung einer Information über einen Sachverhalt mit der Wirklichkeit, also der objektiven Realität, beschreibt. Leider begegnet der Mensch in seinem Alltag nicht nur Wahrheiten. Sondern er trifft auf eine Vielzahl von Informationen unterschiedlicher Qualität. Der Verstand des Empfängers nimmt dieses Sammelsurium von Informationen auf und bewertet sie hinsichtlich Relevanz und Wahrheitsgehalt. Ille C. Gebeshuber ergänzt: „Und hier spielt das Glauben an den Wert der Information beziehungsweise an deren Quelle eine wichtige Rolle. Die subjektive Wahrheit und somit unser ganzes Wissen ergibt sich aus Informationen, an die wir glauben.“ Die Tugend der Ehrlichkeit verliert hier an Wert, denn meist stehen die Vermittler von Informationen in einer Vertrauenskette. Ille C. Gebeshuber ist Professorin für Physik an der Technischen Universität Wien.
Der Imperialismus hat die Europäer geprägt
Das Bewusstsein für die Relativität von Wertesystemen fließt heutzutage in zahlreiche historische und kulturelle Studien ein. Carlo Rovelli betont: „Es hilft uns, uns ein wenige von unserem natürlichen Provinzialismus zu lösen.“ Zudem erlaubt es, diejenige Sichtweise zu korrigieren, die der europäische Imperialismus deformierte. Diese hat die Europäer geprägt und ihnen suggeriert, dass der westliche Standpunkt der einzig vernünftige ist. Und dieses Bewusstsein hilft den Europäern auch zu verstehen, dass das, was sie wahr, schön und gut finden, von anderen anders gesehen werden kann. Wenn die Naturwissenschaften selbst keine Sicherheit bieten können, dann sollte dies umso mehr ein Grund dafür sein, nicht alles für bare Münze zu nehmen, was man für wahr hält. Seit dem Jahr 2000 ist Carlo Rovelli Professor für Physik an der Universität Marseille.
Die Logik ist eine Wissenschaft
Die Logik ist die Lehre von der Verhältnisbestimmung zwischen Gedanken. Markus Gabriel erläutert: „Das altgriechische Wort „logos“ hat eine Bedeutungsspannweite, die Verhältnis, Maß, Aussage, Sprache, Denken, Rede, Wort und Vernunft umfasst.“ Platon und Aristoteles haben die Logik als Wissenschaft etabliert. Es geht dabei um die Frage, wie verschiedene Gedanken zusammenhängen sollen, wenn man etwas Neues durch reine Gedankenverknüpfung erkennen will. Deswegen beschäftigt sich die Logik traditionell mit den drei Themen Begriff, Urteil und Schluss. Ein Begriff ist etwas, das man aus einem Gedanken herauslösen kann, um ihn für einen anderen Gedanken weiterzuverwenden. Seit 2009 hat Markus Gabriel den Lehrstuhl für Erkenntnistheorie und Philosophie der Neuzeit an der Universität Bonn inne. Zudem ist er dort Direktor des Internationalen Zentrums für Philosophie.
Wahrheit ist der Wille der Überwältigung
Für Friedrich Nietzsche bedeutet der Wille zur Wahrheit: „Ich will nicht täuschen, auch mich selbst nicht.“ Und hiermit befindet er sich auf dem Boden der Moral. Im Nachlass vom Herbst 1887 findet sich sogar noch eine Steigerungsform. Wahrheit sei ein Name „für den Willen der Überwältigung. Wahrheit hineinlegen, als ein aktives Bestimmen, nicht als Bewusstsein von etwas, das an sich fest und bestimmt wäre. Es ist ein Wort für den Willen zur Macht.“ Christian Niemeyer weist darauf hin, dass man gegen diese Pointe das Bedenken vortragen könnte, Friedrich Nietzsche moralisiere hiermit das Wahrheitsproblem. Und er verfehle die in seinem Grundansatz an sich die sehr viel zwingendere Psychologisierung des Moralbegriffs. Der Erziehungswissenschaftler und Psychologe Prof. Dr. phil. habil. Christian Niemeyer lehrte bis 2017 Sozialpädagogik an der TU Dresden.
Das Subjekt mutiert zum Objekt
Wer zu viele Fragen stellt, statt sich mit den verfügbaren Erklärungsvideos zufriedenzugeben, lebt riskant. Man verliert die Zeit, die andere nutzen, um als Erste abzuräumen. Man versäumt es, die Entweder-Oder-Taste zu drücken. Und dann? Rebekka Reinhard erläutert: „Dann steht der Erfolg, herausgerissen aus dem binären System, plötzlich als isolierte Größe da. Und es stellt sich heraus: Er repräsentiert nicht die Wahrheit, sondern die Lüge.“ Denn der Gewinn, den das vom Erfolgsheroismus infizierte, zum Objekt mutierte Subjekt einzuheimsen meint, zerrinnt ihm zwischen den Fingern. Klicks, Likes, Status, Reputation begründen keine reiche, sondern eine arme Existenz. Die Illusion eines guten Lebens. Die vermeintlichen Erfolgshelden rennen und rennen. Aber die Entwickler der Nullen-und-Einsen-Welt sind längst zehn Schritte weiter. Die Philosophin Rebekka Reinhard war bis zur Einstellung der Zeitschrift stellvertretende Chefredakteurin des Magazins „Hohe Luft“.