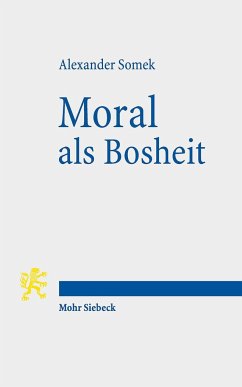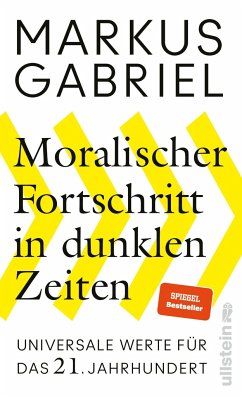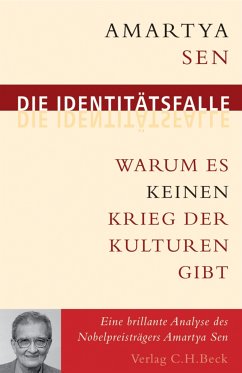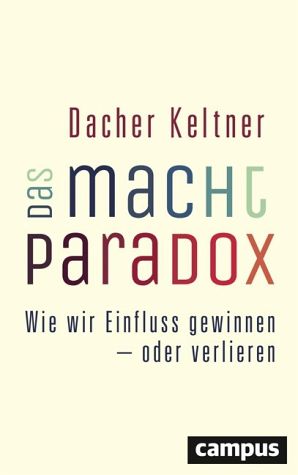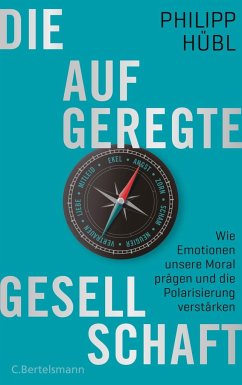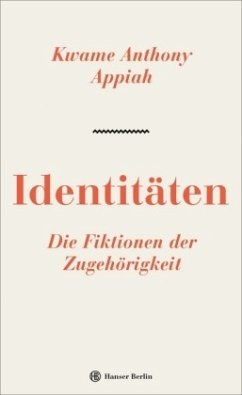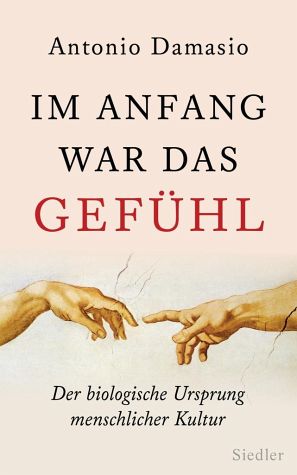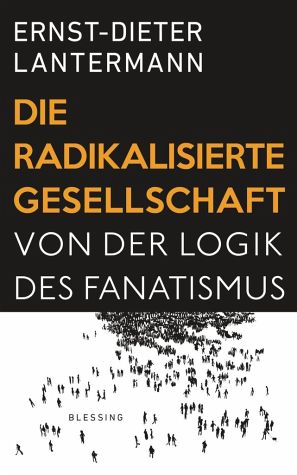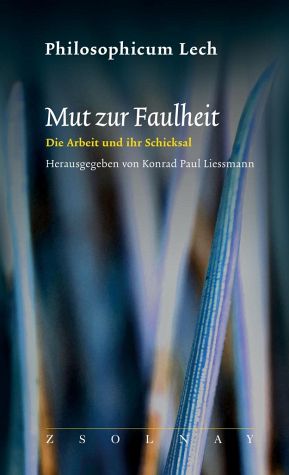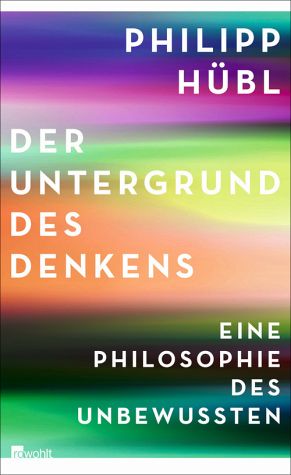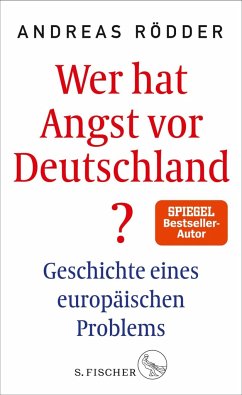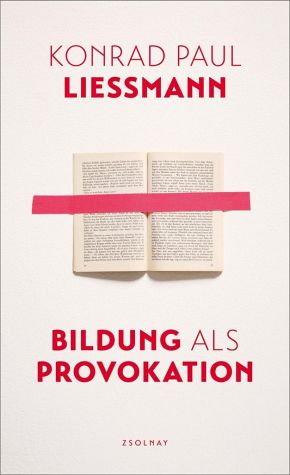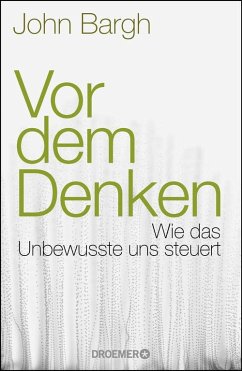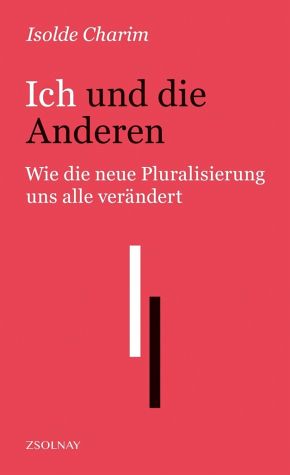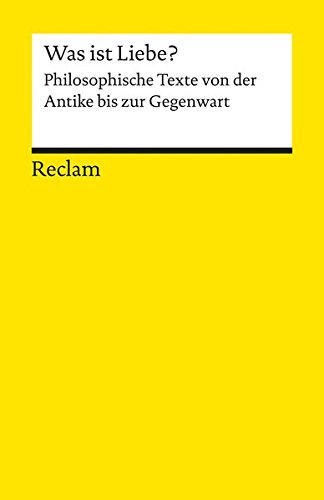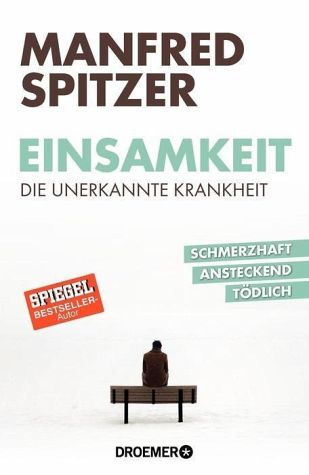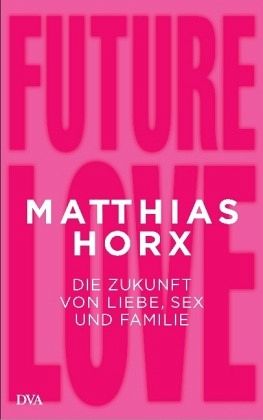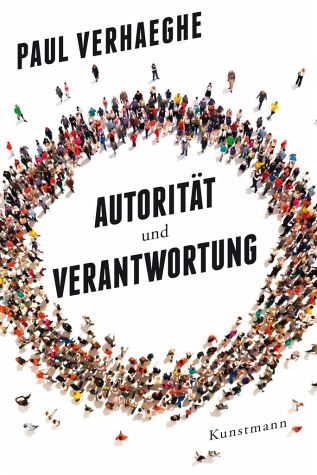Der Begriff der Diskriminierung erfreut sich gegenwärtig großer Beliebtheit und breiter Anwendung. Alexander Somek erläutert: „Das mag daran liegen, dass eine gesellschaftliche Benachteiligung, insofern es sich nicht um eine Wettbewerbsverzerrung handelt, sich als Diskriminierung darstellen lassen muss, um überhaupt normativ relevant zu sein.“ Wer nicht glaubhaft machen kann, diskriminiert worden zu sein, der gilt als wirklich weniger qualifiziert als die anderen oder bestenfalls als glückslos. Die betreffende Person hat dann entweder ihren Nachteil verdient oder schlicht Pech gehabt. Von einem Vorteil, den andere genießen, ungerechtfertigt ausgeschlossen zu sein, kann auf direkter oder indirekter Diskriminierung beruhen. Im ersten Fall misst man einem Merkmal Relevanz zu, obwohl es eigentlich irrelevant ist. Alexander Somek ist seit 2015 Professor für Rechtsphilosophie und juristische Methodenlehre an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien.
Gruppe
Der Neue Moralische Realismus klärt auf
Markus Gabriel stellt die ethischen Grundbegriffe der neuen Aufklärung vor, die sich aus einigen Kernthesen ergeben. Die Kernthesen des Neuen Moralischen Realismus lauten wie folgt. Erstens gibt es von den Privat- und Gruppenmeinungen unabhängige moralische Tatsachen. Diese bestehen objektiv. Zweitens sind die objektiv bestehenden moralischen Tatsachen durch den Menschen erkennbar, also geistabhängig. Sie richten sich an Menschen und stellen einen Moralkompass dessen dar, was man tun soll, tun darf oder verhindern muss. Sie sind in ihrem Kernbestand offensichtlich und werden in dunklen Zeiten durch Ideologie, Propaganda, Manipulation und psychologische Mechanismen verdeckt. Seit 2009 hat Markus Gabriel den Lehrstuhl für Erkenntnistheorie und Philosophie der Neuzeit an der Universität Bonn inne. Zudem ist er dort Direktor des Internationalen Zentrums für Philosophie.
Identität kann auch töten
Ein Identitätsgefühl kann eine Quelle nicht nur von Stolz und Freude, sondern auch von Kraft und Selbstvertrauen sein. Es überrascht Amartya Sen nicht, dass die Idee der Identität so allgemeine Zustimmung erfährt. Vom Grundsatz der Nächstenliebe bei den kleinen Leuten bis hin zu den anspruchsvollen Theorien des sozialen Kapitals und der kommunitaristischen Selbstdefinition. Und dennoch kann Identität auch töten und zwar hemmungslos töten. Ein starkes und exklusives Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gruppe kann in vielen Fällen mit der Wahrnehmung einer Distanz und Divergenz zu anderen Gruppen einhergehen. Amartya Sen weiß: „Solidarität innerhalb der Gruppe kann Zwietracht zwischen Gruppen verstärken.“ Amartya Sen ist Professor für Philosophie und Ökonomie an der Harvard Universität. Im Jahr 1998 erhielt er den Nobelpreis für Ökonomie.
Zwänge schränken Freiheiten ein
Viele kommunitaristische Denker neigen zu folgender Ansicht: Eine dominierende gemeinschaftliche Identität sei lediglich eine Sache der Selbsterkenntnis, nicht aber der Wahl. Für Amartya Sen ist es jedoch schwer zu glauben, dass ein Mensch wirklich keine Wahl hat, zu entscheiden, welche relative Bedeutung er den verschiedenen Gruppen beimisst, denen er angehört. Und dass er seine Identitäten lediglich zu entdecken braucht, so als handle es sich um ein rein natürliches Phänomen. In Wirklichkeit treffen alle Menschen ständig Entscheidungen über die Prioritäten, die sie ihren verschiedenen Zugehörigkeiten und Mitgliedschaften beimessen. Die Freiheit, über die persönlichen Loyalitäten und Gruppen, denen man angehört, selbst zu entscheiden, ist eine besonders wichtige Freiheit. Amartya Sen ist Professor für Philosophie und Ökonomie an der Harvard Universität. Im Jahr 1998 erhielt er den Nobelpreis für Ökonomie.
Die Macht fühlt sich wie eine lebendige Kraft an
Ausbeuterisches, selbstsüchtiges und gewalttätiges Handeln vernichtet den Zusammenhalt starker Gruppen. Gruppen wissen das und kennen auch Geschichten von Menschen, die die Macht missbraucht haben und habgierig und unbeherrscht handelten. Dacher Keltner erklärt: „Gruppen verleihen daher die Macht an die, die Begeisterung verbreiten und freundlich, zielorientiert, ruhig und offen sind. Mit dem Ansehen, dass sie einer Person verleihen, zeigen sie an, dass diese fähig ist, für das Wohl der Gruppe zu handeln.“ Gruppen verlassen sich auf den Ruf, wenn es darum geht, zusammenzuarbeiten, zu kooperieren, Bündnisse zu schließen und starke Bindungen einzugehen. Sie erhöhen den Ruf derer, die bereit sind, zu teilen. Und sie schädigen mit deftigen Klatschgeschichten den Ruf derer, die selbstsüchtig sind und sich als Machiavellisten aufführen. Dacher Keltner ist Professor für Psychologie an der University of California in Berkeley und Fakultätsdirektor des UC Berkeley Greater Good Science Center.
Macht verändert den Status anderer
Wenn die Sozialwissenschaften dazu tendieren, Macht über Geld, militärische Stärke und politische Teilhabe zu definieren, tun sie das aus gutem Grund. Denn Aktivitäten, die sich darauf stützen, können die Welt erheblich verändern. Dacher Keltner ergänzt: „Durchdringt aber Macht jegliche Art der sozialen Dynamik, müssen wir sie neu definieren. Um damit zu zeigen, wie Menschen die Welt verändern, ohne auf Geld, militärische Aktivitäten und die Politik zurückzugreifen.“ So definiert, ist Macht die Fähigkeit, den Status anderer zu verändern. Mit Status meint Dacher Keltner die Stellung einer Person oder einer Gruppe im weitersten Sinne. Der Status kann also viele Bereiche betreffen: den Stand des Bankkontos, den Glauben, die Emotionen, die Gesundheit und so weiter. Dacher Keltner ist Professor für Psychologie an der University of California in Berkeley und Fakultätsdirektor des UC Berkeley Greater Good Science Center.
Die Asylfrage dominierte die Politik
Seit dem Fall der Mauer ist die Zahl der in Deutschland Asylsuchenden kontinuierlich gestiegen. Hinzu kommen Spätaussiedler aus den ehemaligen Sowjetrepubliken und Flüchtlinge aus dem jugoslawischen Bürgerkrieg. Die Union aus CDU und CSU sowie die rechten Splitterparteien hatten schon Ende der Achtzigerjahre die Angst vor den Asylsuchenden als zentrales politisches Thema besetzt. Philipp Hübl blickt zurück: „Die deutschen Wähler hielten damals die Asylfrage für politisch wichtiger als die Wiedervereinigung oder die Arbeitslosigkeit.“ Mit der Flüchtlingssituation von 2015 parallel zur Willkommenskultur kam es auch verstärkt zu fremdenfeindlichen Aktionen. Mit der Ankunft der Fremden nahm die Gewalt zu. Allein im Jahr 2017 gab es mehr als 2.000 Angriffe gegen Flüchtlinge und ihre Unterkünfte. Philipp Hübl ist Philosoph und Autor des Bestsellers „Folge dem weißen Kaninchen … in die Welt der Philosophie“ (2012).
Dacher Keltner definiert einen neuen Begriff der Macht
Seit Niccolò Machiavelli und der Renaissance hat sich die Gesellschaft dramatisch verändert, und zwar in einer Weise, die es erforderlich macht, die ausgediente Definition von Macht fallenzulassen. Dacher Keltner erklärt: „Es wird uns eher gelingen, das Macht-Paradox zu überlisten, wenn wir unser Denken erweitern und Macht als die Fähigkeit definieren, etwas in der Welt zu verändern, insbesondere, indem wir mit Hilfe der Macht andere in unseren sozialen Netzen aufrütteln.“ Nach dieser neuen Definition ist Macht nicht auf ganz besondere Menschen beschränkt, also weder auf grausame Diktatoren noch hochrangige Politiker oder die Reichen und Berühmten des Jet-Sets, die in der Öffentlichkeit stehen. Dacher Keltner ist Professor für Psychologie an der University of California in Berkeley und Fakultätsdirektor des UC Berkeley Greater Good Science Center.
Hass kann sich zu einem Flächenbrand ausweiten
Oscar Wilde stellte die rätselhafte Behauptung auf: „Die meisten Menschen sind jemand anderes.“ Er begründete seine Ansicht sehr überzeugend: „Ihre Gedanken sind die Meinungen anderer, ihr Leben ist Nachahmung, ihre Leidenschaften sind Zitate.“ Amartya Senn stimmt dieser Auffassung zu: „Tatsächlich werden wir in erstaunlichem Maße von Menschen beeinflusst, mit denen wir uns identifizieren.“ Sektiererischer Hass kann sich, wenn er aktiv geschürt wird, zu einem Flächenbrand ausweiten. Amartya Sen nennt als Beispiele den Kosovo, Bosnien, Ruanda, Timor, Israel, Palästina und den Sudan. Das Gefühl der Identität mit einer Gruppe kann, entsprechend angestachelt, zu einer mächtigen Waffe werden, mit der man anderen grausam zusetzt. Amartya Sen ist Professor für Philosophie und Ökonomie an der Harvard Universität. Im Jahr 1998 erhielt er den Nobelpreis für Ökonomie.
Die modernen Identitäten sind von sozialer Natur
Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts hätte niemand, der nach der Identität eines Menschen fragte, die Kategorien race, Gender, Nationalität, Region oder Religion erwähnt. Früher war die Identität etwas ganz Besonderes und Persönliches. Kwame Anthony Appiah vergleicht dies mit der Gegenwart: „Die Identitäten, an die wir heute denken, haben wir dagegen meist mit Millionen oder Milliarden anderen Menschen gemeinsam. Sie sind von sozialer Natur.“ In den sozialwissenschaftlichen Theorien des frühen 20. Jahrhunderts sucht man nach solchen Identitäten vergebens. In seinem 1934 veröffentlichten Buch „Mind, Self, and Society“ skizzierte George Herbert Mead eine einflussreiche Theorie des Selbst als Produkt eines „Ich“, das auf die sozialen Anforderungen der anderen reagiert und durch deren Verinnerlichung das „Mich“, wie er dies nannte, herausbildet. Professor Kwame Anthony Appiah lehrt Philosophie und Jura an der New York University.
Kultur ist die Summe intellektueller Errungenschaften
Dass das Wort „Kultur“ auf das Universum der Ideen angewandt wird, hat die Menschheit Cicero und dem alten Rom zu verdanken. Cicero beschrieb mit dem Wort das Heranziehen der Seele – „cultura animi“; dabei dachte er offensichtlich an den Ackerbau und sein Ergebnis, die Vervollkommnung und Verbesserung des Pflanzenwachstums. Was für das Land gilt, kann demnach genauso auch für den Geist gelten. Antonio Damasio schreibt: „An der heutigen Hauptbedeutung des Wortes „Kultur“ gibt es kaum Zweifel. Aus Wörterbüchern erfahren wir, dass Kultur eine Sammelbezeichnung für Ausdrucksformen intellektueller Errungenschaften ist, und wenn nichts anderes gesagt wird, meinen wir damit die die Kultur der Menschen.“ Antonio Damasio ist Professor für Neurowissenschaften, Neurologie und Psychologie an der University of Southern California und Direktor des dortigen Brain and Creative Institute.
Fremdenfeindlichkeit gedeiht vor allem in unsicheren Gesellschaften
Fremdenfeindliche Einstellungen und Überzeugungen gedeihen besonders gut in einer Gesellschaft, die ihres Zusammenhalts nicht mehr gewiss ist und daher ihren Mitgliedern keinerlei Sicherheitsversprechen mehr anbieten kann. Dieter-Lantermann fügt hinzu: „So muss jeder selbst für seine eigenen Sicherheiten sorgen, ohne Netz und doppelten Boden, ohne die Gewissheit einer festen sozialen Verortung, ohne selbstverständlich geltende Normen, Verhaltensregeln und Handlungsorientierungen, die das Miteinander in der Gesellschaft verlässlich und berechenbar organisieren und leiten. Menschen, die sich ihrer sozialen und gesellschaftlichen Zughörigkeit, Wertschätzung und sozialen Identität unsicher geworden sind, neigen häufig zu zugespitzten fremdenfeindlichen Haltungen, von denen sie sich neue soziale und persönliche Sicherheiten versprechen. Auf die Frage worin der „Sicherheitsgewinn“ solcherart radikaler Haltungen gegenüber Zuwanderern aus fremden Ländern und Kulturen liegt, weiß Ernst-Dieter Lantermann eine Antwort. Ernst-Dieter Lantermann war von 1979 bis 2013 Professor für Persönlichkeits- und Sozialpsychologie an der Universität Kassel.
Die Polarisierung von Konsum und Arbeit ist nicht mehr angemessen
Lange Zeit wurde Konsum mit Verschwendung, Müßiggang und Passivität assoziiert und als das Gegenteil von Arbeit angesehen. Wolfgang Ullrich erläutert: „Es galt: Konsumiert werden kann nur, was zuvor produziert wurde, und allein deshalb ist unproduktiv, wer konsumiert.“ Konsum zerstört sogar, was durch Arbeit hergestellt wurde. In der gegenwärtigen Wohlstandsgesellschaft – so Wolfgang Ullrichs These – ist diese Polarisierung von Konsum und Arbeit nicht mehr angemessen. Vielmehr wird Konsum sogar als Arbeit erfahren und Arbeit gerade auch beim Konsumieren geleistet. Die Schrift „Theorie der feinen Leute“ von Thorstein Veblen ist aus dem Gegensatz zwischen Müßiggang und Verschwendung einerseits und produktiver Arbeit andererseits entwickelt. Prof. Dr. Wolfgang Ullrich war bis 2015 Professor für Kunstwissenschaft und Medientheorie an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe. Seither arbeitet er als freier Autor, Dozent und Berater.
Die meisten Menschen beherrschen die Kunst der Verstellung
Wenn Fehleinschätzungen der eigenen Fähigkeiten und Gründe oft und systematisch auftauchen, dann stellt sich für Philipp Hübl die Frage, wie sie evolutionär von Vorteil gewesen sein können. Als Antwort darauf gibt es mehrere Vorschläge. Der Evolutionsbiologe Robert Trivers nimmt an, dass Selbsttäuschung sich im Dienste der sozialen Täuschung entwickelt hat. Friedrich Nietzsche hat diese soziobiologische Grundidee schon 150 Jahre früher so zusammengefasst: „Der Intellekt, als ein Mittel zur Erhaltung des Individuums, entfaltet seine Hauptkräfte in der Verstellung. Im Menschen kommt diese Verstellungskunst auf ihren Gipfel: hier ist die Täuschung, das Schmeicheln, Lügen und Trügen, das Hinter-dem-Rücken-reden, das Repräsentieren, das im erborgten Glanze Leben, das Maskiertsein, die verhüllende Konvention, das Bühnenspiel vor anderen … die Regel und das Gesetz.“ Philipp Hübl ist Juniorprofessor für Theoretische Philosophie an der Universität Stuttgart.
Nationen gründen sich oftmals auf Mythen und Erzählungen
Nationen sind, so die klassische Definition von Ernest Renan, keine materiellen Phänomene, sondern geistige Prinzipien. Sie beruhen darauf, dass eine Gruppe von Menschen sich aufgrund bestimmter Merkmale wie Staatsangehörigkeit, gemeinsamer Sprache, Kultur oder Geschichte als zusammengehörig begreift. Andreas Rödder ergänzt: „Der Realitätsgehalt dieser Vorstellungen gemeinsamer Geschichte und Kultur ist in der Regel begrenzt, vielmehr beruhen sie oftmals auf Mythen und Erzählungen.“ Der amerikanische Politikwissenschaftler Benedict Anderson hat Nationen daher als „vorgestellte“ oder gar „erfundene Gemeinschaften bezeichnet – was freilich nichts an der durchschlagenden Wirkung dieser Idee in der Geschichte der westlichen Moderne ändert. Denn Gemeinschaften, die sich als Nation verstanden, wollten im 19. Jahrhundert auch in einem Staat zusammenleben. Andreas Rödder zählt zu den profiliertesten deutschen Historikern und Intellektuellen. Seit 2005 ist er Professor für Neueste Geschichte an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz.
Die politischen Parteien sind in eine Krise geraten
Der Bürger, das war einmal der Angehörige eines definierten sozialen Standes mit bestimmten Interessen, Lebensformen und Werten, die sich in einer politischen Partei artikulierten und ausdrücken sollten. Konrad Paul Liessmann fügt hinzu: „Und der Bürger ist das Mitglied einer politischen Gemeinschaft, das je nach Lebenslage, Herkunft, Sozialisation und Perspektiven unterschiedliche, oft divergierende und rasch wechselnde Interessen, Präferenzen und Lebenskonzepte vertritt, die sich nur noch schwer im Angebot einer Partei fassen lassen und zu einer Fluktuation im Bekunden politischer Vorlieben führt.“ Traditionelle Weltanschauungsparteien mit starken Wurzeln in einer bestimmten sozialen Schicht werden mit den offenen und sich rasch wandelnden Konzepten einer Multioptionsgesellschaft konfrontiert. Prof. Dr. Konrad Paul Liessmann ist Professor für Methoden der Vermittlung von Philosophie und Ethik an der Universität Wien und wissenschaftlicher Leiter des Philosophicum Lech.
Beim Vertrauen handelt es sich um eine angeborene Neigung
Die Natur hat den Menschen mit Eigenschaften ausgestattet, um beurteilen zu können, wem er vertraut und mit wem er kooperieren kann. Dabei handelt es sich um ein Erbe der fernen stammesgeschichtlichen Vergangenheit, in der die Menschen einander die gefährlichsten Wesen waren. Diese Eigenschaften beziehen sich darauf, ob die anderen Menschen einem selbst ähneln oder nicht. In den letzten 50 Jahren wurden auch auf dem Feld der Sozialpsychologie zahllose Forschungen zum dem Themenbereich Eigengruppe versus Fremdgruppe und die Konsequenzen aus dieser Unterscheidung durchgeführt. John Bargh kennt die Ergebnisse: „Sie belegen, dass wir schon von sehr jungen Jahren an auf die Unterscheidung von Eigengruppe und Fremdgruppe eingestellt sind, was wiederum darauf schließen lässt, dass es sich um eine angeborene Neigung handelt.“ Prof. Dr. John Bargh ist Professor für Psychologie an der Yale University, wo er das Automaticity in Cognition, Motivation, and Evaluation (ACME) Laboratory leitet.
Die eigene Identität ist nicht mehr selbstverständlich
Fast jeder Mensch erlebt heute seine Identität im Wissen, dass der Andere, der Nachbar eine andere Identität hat. Diese Erfahrung nimmt der Identität ihre Selbstverständlichkeit. Es schränkt sie ein. Sie weiß, dass sie nur eine Option unter anderen ist. Isolde Charim ergänzt: „In diesem Sinne schreibt sich Pluralisierung eben als Minus, als Weniger, als Abzug von unserer jeweiligen Identität in uns alle ein. In diesem Sinn muss sich jeder – schon von klein auf – seiner prekären Identität versichern.“ Trotzdem lassen sich die Veränderungen des Kapitalismus, den man unter den Begriff „Neoliberalismus“ fasst, nicht einfach gleichsetzen mit den psychopolitischen Veränderungen der gesellschaftlichen Identität. Die Philosophin Isolde Charim arbeitet als freie Publizistin und ständige Kolumnistin der „taz“ und der „Wiener Zeitung“.
Die Liebe ist ein bevorzugter Ort der Utopie
Die ewige Macht der Liebe lässt sich, wenn auch nur teilweise, aus der Tatsache erklären, dass die Liebe ein bevorzugter Ort utopischer Erfahrung ist. Eva Illouz fügt hinzu: „In den kapitalistischen Gesellschaften enthält die Liebe eine utopische Dimension, die sich nicht einfach auf „falsches Bewusstsein“ oder auf den angeblichen Einfluss der „Ideologie“ auf die menschlichen Sehnsüchte reduzieren lässt.“ Im Gegenteil, die Sehnsucht nach einer Utopie, die den Kern romantischer Liebe bildet weist tief reichende Affinitäten zur Erfahrung des Heiligen auf. Wie Durkheim gezeigt hat, ist diese Erfahrung nicht aus der säkularen Gesellschaft verschwunden, sondern hat sich aus der Sphäre der Religion auf andere kulturelle Bereiche verlagert. Einer dieser Bereiche ist die romantische Liebe. Die Soziologin Eva Illouz ist seit dem Jahr 2006 Professorin für Soziologie an der Hebrew University in Jerusalem.
Vertrauen vermindert das Gefühl der Machtlosigkeit
Soziale Kompetenzen stellen eine wichtige innere Ressource für die Bewältigung von Unsicherheit dar. Menschen mit hohen sozialen Kompetenzen können leicht Beziehungen zu anderen Menschen anknüpfen, aufrechterhalten und befriedigend gestalten und haben kein Problem damit, andere Menschen um Hilfe oder Unterstützung zu bitten, wenn es die Lage erfordert. Auch andere Eigenschaften einer Persönlichkeit helfen dabei, sich angesichts unsicherer Ereignisse und Anforderungen zu behaupten. Ernst-Dieter Lantermann nennt als Beispiele das Bedürfnis nach kognitiver Geschlossenheit und die Vorliebe für erregende Ungewissheit. Eine weitere bedeutsame Ressource für einen gelingenden Umgang mit unsicheren Anforderungen stellen unterschiedliche Dimensionen von Vertrauen dar. Vertrauen mindert das Gefühl von Machtlosigkeit und Unkontrollierbarkeit in unübersichtlichen, ungewissen und unsicheren Situationen. Ernst-Dieter Lantermann war von 1979 bis 2013 Professor für Persönlichkeits- und Sozialpsychologie an der Universität Kassel.
Klatsch kann Menschen schwer verletzen und demütigen
Gruppen bestrafen diejenigen, die das Gemeinwohl der Gemeinschaft mit Klatsch untergraben. Für viele gehört Klatsch sogar zu den Todsünden. Der Heilige Paulus ordnete „üble Nachrede“, Überheblichkeit und Hochmut zusammen mit Mord und Unzucht unter die Laster ein, die schärfste Strafen verdienen. Dacher Keltner fügt hinzu: „Lehrer fordern ihre Schüler immer wieder auf, keine Gerüchte und Klatschgeschichten zu verbreiten und nicht verschwörerisch mit ihren Freunden zu flüstern.“ Dafür gibt es einen guten Grund: Klatsch kann in einer Weise verletzen und demütigen, die sogar das Leben verkürzt. Kein Wunder, dass sich die meisten Menschen dagegen sträuben, für ein Klatschmaul gehalten zu werden. Dacher Keltner ist Professor für Psychologie an der University of California in Berkeley und Fakultätsdirektor des UC Berkeley Greater Good Science Center.
Eine gute Handlung fördert das Gemeinwohl
Die Idee des Gemeinwohls ist aus einer philosophischen Bewegung des 18. Jahrhunderts, dem Utilitarismus, hervorgegangen. Francis Hutcheson, Jeremy Bentham und später John Stuart Mill setzten damals auf Messungen und Quantifizierung, um zu bestimmen, ob eine Handlungsweise gut ist. Dacher Keltner kennt ihr Ergebnis: „Eine Handlung ist in dem Maße gut, in dem sie das Gemeinwohl fördert, also das, was man heute als kollektives Wohlergehen eines sozialen Netzwerks bezeichnen würde, oder auch das Vertrauen in eine Gesellschaft oder ihre Stärke.“ Francis Hutcheson hat es so formuliert: „Diejenige Handlung ist die beste, die das größte Glück der größten Anzahl zeitigt, die schlechteste ist die, welche in gleicher Weise Unglück verursacht.“ Dacher Keltner ist Professor für Psychologie an der University of California in Berkeley und Fakultätsdirektor des UC Berkeley Greater Good Science Center.
Manfred Spitzer beschreibt die Generation Ich
Als Angehörige der Generation der Babyboomer kann sich Manfred Spitzer noch gut daran erinnern, dass der Drang nach Freiheit und Autonomie, die Ablehnung vermeintlich „verstaubter“ Werte, die Kritik am „System“ etc. in der damaligen Jugendkultur eine bedeutende Rolle gespielt haben. Manfred Spitzer ergänzt: „Unser Verhalten wird den damals schon etwas Älteren wahrscheinlich egozentrisch und wenig einfühlsam vorgekommen sein.“ Damals war man in der Regel als Gruppe unterwegs – man ging gemeinsam demonstrieren und belegte Gruppenseminare zur Selbstfindung. Niemand fand das damals paradox. Man redete damals nächtelang über Probleme, man studierte, wohnte und lebte zusammen. Das war wichtig. Auf die Generation der Babyboomer folgte die Generation X. Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer leitet die Psychiatrische Universitätsklinik in Ulm und das Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen.
Einseitige Liebe kann niemals zur Intimität führen
Die Soziologin Eva Illouz wird in ihren Büchern nicht müde, darauf hinzuweisen, dass das Problem der modernen Liebe im Übergriff des Kapitalismus auf die Gefühle besteht. In der hyperkapitalisierten Welt von heute lasse sich keine Intimität mehr herstellen, ohne dass diese andauernd von Konkurrenzangeboten bedroht werde. Die Liebe will die Menschen, wie der Psychoanalytiker Erich Fromm es bereits in seinem 1956 erschienenen Buch „Die Kunst des Liebens – ausdrückte, vom „Schrecken der Getrenntheit“ erlösen. Matthias Horx ergänzt: „Intimität ist dabei ein wichtiger Schlüssel.“ Ziyad Marar beschreibt in seinem Buch „Intimacy“ die Intimität als Erleben in vier Dimensionen, in „vier Spiegeln“. Sie ist demnach immer gegenseitig, verschwörerisch, emotional und freundlich. Intimität ist die Errichtung eines nach außen abgeschlossenen Raumes, einer mentalen und emotionalen Blase. Matthias Horx ist der profilierteste Zukunftsdenker im deutschsprachigen Raum.
Der Nationalismus ist eine typische Ausformung des Populismus
Wo Autorität schwindet, tritt Macht an ihre Stelle. Die aktuelle politische Weltlage zeigt diese Gefahr anschaulich. Die Gefahr kommt aus verschiedenen Richtungen. Die politische Ordnung ist immer weniger demokratisch, besitzt kaum noch Autorität und regiert auf Basis von Macht – häufig genug ist das Ohnmacht, doch das ändert nichts daran. Paul Verhaeghe erklärt: „Die Wähler sehen das, interpretieren es jedoch zu Unrecht als ein Scheitern der Demokratie an sich.“ Das birgt das größte Risiko, das David Van Reybrouck sehr treffend als neue Epidemie beschrieben hat: DES, das demokratische Erschöpfungssyndrom. Der Bürger glaubt nicht mehr an Demokratie, er ist bereit für zwei „Lösungen“, die schlimmer sind als die Krankheit selbst. Paul Verhaeghe lehrt als klinischer Psychologe und Psychoanalytiker an der Universität Gent.