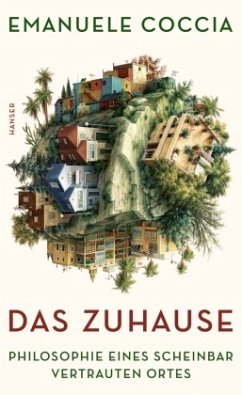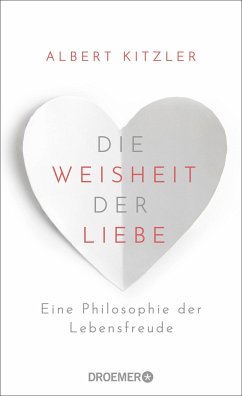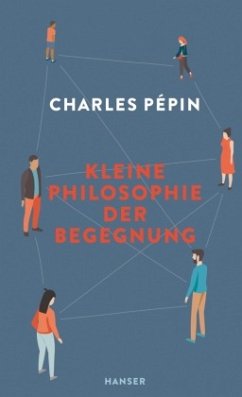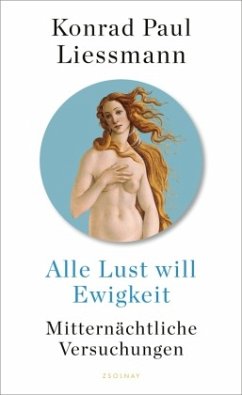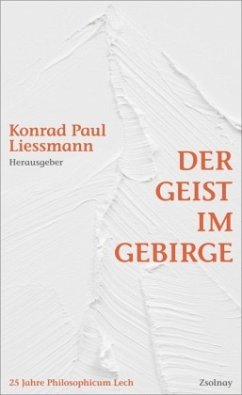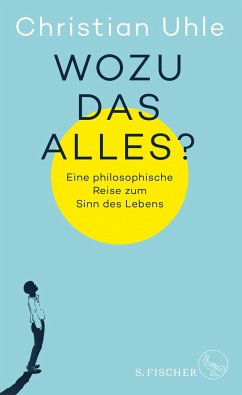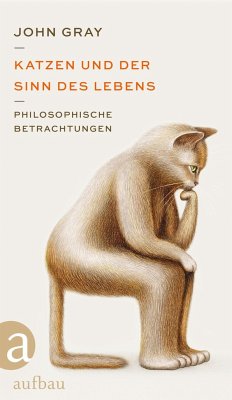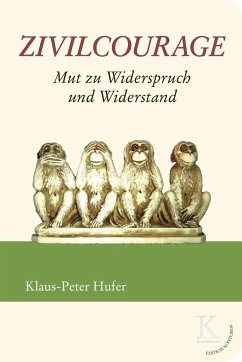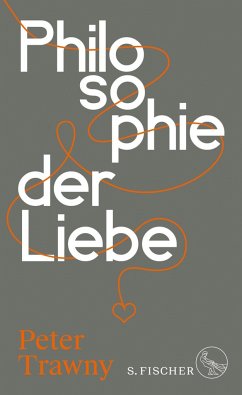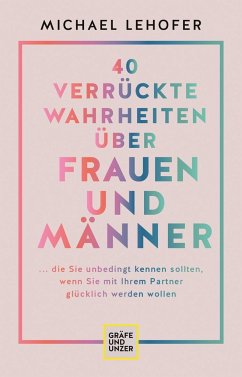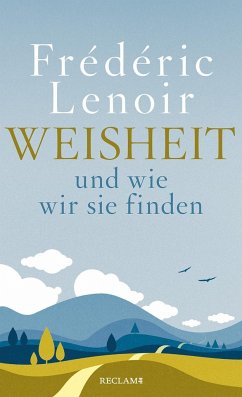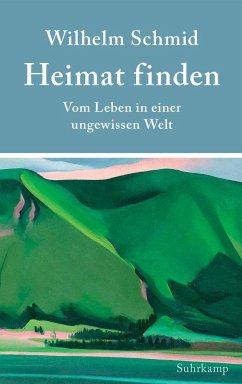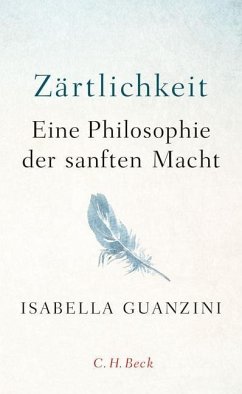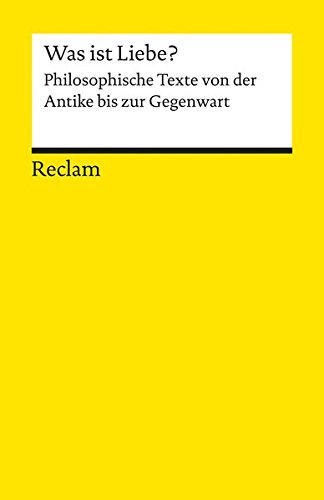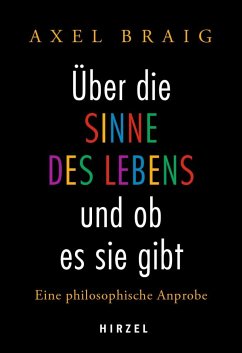Emanuele Coccia weiß: „Dass es so schwer ist, über die Liebe – und damit über das Zuhause – nachzudenken, liegt allerdings nicht nur an der Zerbrechlichkeit und moralischen Blindheit unserer Kultur. Vielmehr ist die Liebe schon aufgrund ihrer Beschaffenheit das schwarze Loch aller moralischen Überlegungen.“ Denn sie ist der ethische Raum, in dem sich das Leben nicht auf Vorschriften, Gesetze oder Gewissheiten stützen kann. Der Grund dafür ist jedoch nicht ihr vermeintlich anarchisches Wesen, denn in Wahrheit gibt es nichts Strukturierteres als die Erfahrung der Liebe. Aber es ist eine besondere Struktur. In der Antike bezeichnete man moralische Kategorien wie diese üblicherweise als „Mysterien“, als Bereiche der Existenz also, in denen man sich nicht auf Wissen oder Gesetzmäßigkeiten verlassen kann, sondern in die man eingeweiht werden muss. Emanuele Coccia ist Professor für Philosophiegeschichte an der École des Hautes Études en Sciences Sociales in Paris.
Liebe
Die Liebe und der Tod verleihen allem Bedeutung
„Die Liebe und der Tod sind die Themen überhaupt, das A und O unserer Erzählungen, weil sie uns wie nichts anderes erschüttern.“ Mit diesem Satz leitet Lorenz Jäger sein neues Buch „Die Kunst des Lebens, die Kunst des Sterbens“ ein. Dabei ist der Tod nicht irgendein Thema unter anderen, sondern der letzte Probierstein des Denkens. Der Kontrast zwischen dem höchsten Lebensglück und der Vernichtung treibt den Umriss von beiden erst heraus. So allgegenwärtig die Verbindung von Liebe und Tod in der Literatur und Dichtung ist, ja eigentlich die Literatur erst ermöglicht, so merkwürdig spät erscheint sie in der Philosophie. Lorenz Jäger schreibt: „Die Liebe und der Tod verleihen allem Bedeutung, was in ihren Bereich tritt, mit ihnen erst sind wir Menschen.“ Seit 1997 arbeitete Lorenz Jäger als Redakteur im Ressort Geisteswissenschaften der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, das er zuletzt leitete.
Nicht jeder Mensch beherrscht die Kunst der Liebe
Man verkennt das Wesen der Liebe, wenn man meint, dies sei nichts weiter als ein Gefühl, das sich einstellt oder nicht und auf das man wenig Einfluss hat. Albert Kitzler ist ganz anderer Ansicht: „Liebe ist eine Kunst, die keineswegs jeder Mensch von Natur aus beherrscht, sondern von den meisten gelernt werden muss, soll ihr Leben gelingen.“ Würden die Menschen die Kunst des Liebens beherrschen, würden die Menschheit in einer anderen Welt leben. Man würde sich dann nicht gegenseitig persönlich angreifen und verletzen, sondern miteinander respektvoll, mitfühlend und verständnisvoll umgehen. Die Völker würden sich nicht bekriegen, ausbeuten und unterdrücken, Gläubige würden Andersgläubige nicht verfolgen, ausgrenzen und töten. Der Philosoph und Medienanwalt Dr. Albert Kitzler gründete 2010 „Maß und Mitte – Schule für antike Lebensweisheit und eröffnete ein Haus der Weisheit in Reit im Winkl.
Geliebt zu werden ist ein Glück
Die Erfahrung der Andersheit zeigt früher oder später Wirkung. Charles Pépin erläutert: „Durch die Berührung mit dir entdecke ich nicht nur deine Sichtweise, ich verändere mich auch. Ich habe einen neuen Weg eingeschlagen, habe einige meiner Gewohnheiten und auch einige Einstellungen geändert. Meine Vorlieben haben sich gewandelt und in manchen Situationen reagiere ich nicht mehr wie früher, kurzum, ich habe mich verändert.“ Ob zum Besseren oder nicht, ist unwichtig. Der fühlbarste Beweis dafür, dass man einem anderen begegnet ist, besteht darin, dass man sein Leben anders als vorher führt. Ein Don Juan dagegen verändert sich nicht: Er verführt alle Frauen, aber keiner begegnet er. Charles Pépin ist Schriftsteller und unterrichtet Philosophie. Seine Bücher wurden in mehr als zwanzig Sprachen übersetzt.
Das Herz gilt als Metapher des Begehrens
Die zweite Zeile von Friedrich Nietzsches „Mitternachtslied“ lautet: „Was spricht die tiefe Mitternacht?“ Der Mensch in all seiner Vielgestaltigkeit und Unbestimmtheit ist nicht nur der einfache Adressat dieses Anrufs, er ist auch in diesem „Was“ unbedingt angesprochen. Konrad Paul Liessmann erläutert: „Die Stimme der Mitternacht verspricht Auskunft über die existenzielle Befindlichkeit, über die individuellen Nöte des Menschen. Denn diese Mitternachtsglocke hat, wie Zarathustra seinen Gefährten erläutert, die „Herzens-Schmerzens-Schläge“ im Hintergrund.“ Der Herzschlag synchronisiert sich mit dem Glockenschlag. Und beide verdichten sich zu einem Schmerz, der sich weniger auf ein organisches Leiden als vielmehr auf eine fundamentale Grundbefindlichkeit des Menschen bezieht. Konrad Paul Liessmann ist Professor für Philosophie an der Universität Wien. Zudem arbeitet er als Essayist, Literaturkritiker und Kulturpublizist. Im Zsolnay-Verlag gibt er die Reihe „Philosophicum Lech“ heraus.
Das Böse geht der Menschheit nicht verloren
In der griechischen Mythologie sind die Menschen ihren Ursprüngen entkommen, wie man einer Katastrophe entgeht. Aber sie brauchen sich nicht darum zu sorgen, dass ihnen das Böse verloren gehen könnte. Rüdiger Safranski stellt fest: „Es kehrt stets wieder – in veränderter Gestalt. Wie bei den Göttern, gibt es auch beim Bösen einen Gestaltwandel.“ Das „Böse“ ist kein Begriff. Nur ein Name. Ein Name wofür? Für vielerlei: für das Barbarische, die Gewalt, Realitätszerstörung. Aber neuerdings auch für das Chaos, den Zufall, die Entropie, die undurchschaubare und unberechenbare Komplexität. Was das Entscheidende ist: Das „Böse“ hat aufgehört, lediglich ein Name zu sein für das im engeren Sinne Moralische. Rüdiger Safranski arbeitet seit 1986 als freier Autor. Sein Werk wurde in 26 Sprachen übersetzt und mit vielen Preisen ausgezeichnet.
In Krisen sind Menschen emotional verunsichert
Vielleicht basieren viele kleine und große Krisen auf völlig falschen Perspektiven. Christian Uhle fügt hinzu: „Vielleicht erkennen Menschen in solchen Situationen keine tiefere Wahrheit, sondern sind emotional verunsichert. Vielleicht ist das Leben durch und durch sinnvoll, nur manchmal sehen wir das nicht und verlieren unser Gefühl für den Sinn.“ Fakt ist, dass die meisten Menschen im Laufe ihres Lebens mit Empfindungen von Sinnlosigkeit umgehen müssen. Wie kann ein Mensch solche Erfahrungen besser verstehen? Ebenso wie die Liebe zu den eigenen Eltern ganz anders ist als die stürmische Verliebtheit am Anfang einer romantischen Beziehung, so hat auch das Gefühl der Sinnlosigkeit tausend Gesichter. Wie die Liebe lässt es sich nicht präzise beschreiben, sondern nur umkreisen. Das Anliegen des Philosophen Christian Uhle ist es, Philosophie in das persönliche Leben einzubinden.
Katzen sind sehr betörend
Ein gewichtiger Grund, warum Menschen Katzen in ihren Häusern akzeptierten, ist, dass die Katzen die Menschen lehrten, sie zu lieben. Das ist die wahre Basis der Haustierwerdung von Katzen. John Gray erläutert: „Katzen sind so betörend, dass oft geglaubt wurde, sie seien nicht von dieser Welt. Und Menschen brauchen noch etwas anderes als nur die menschliche Welt, um nicht verrückt zu werden.“ Der Animismus, die älteste und universalste Religion, befriedigte dieses Bedürfnis, indem er nichtmenschliche Tiere als den Menschen spirituell ebenbürtig, ja überlegen anerkannte. Durch Anbetung dieser anderen Geschöpfe waren die Vorfahren der heutigen Menschen in der Lage, mit einem Leben jenseits ihres eigenen zu interagieren. John Gray lehrte Philosophie unter anderem in Oxford und Yale. Zuletzt hatte er den Lehrstuhl für Europäische Ideengeschichte an der London School of Economics inne.
Mahatma Gandhi kämpft gegen Ungerechtigkeit
Mohandas Karamchand Gandhi (1869 – 1948) kam als Sohn hinduistischer Eltern im westlichen Indien zur Welt. Später bekam er den Ehrentitel „Mahatma“. Klaus-Peter Hufer fügt hinzu: „Er studierte in London Jura, wurde Anwalt und arbeitete zunächst in Südafrika.“ Dort setzte er sich gegen die Rassendiskriminierung und für die Rechte der indischen Einwanderer ein. Dort entwickelt er das „Satyagraha“ („Macht der Wahrheit“), womit er den passiven Widerstand und den zivilen Ungehorsam gegen Ungerechtigkeit begründete. „Satya“ bedeutet Wahrheit und Liebe. Beides sind Attribute der Seele. „Agraha“ ist Stärke oder Kraft. „Satyagraha“ ist also Stärke, die aus Wahrheit, Liebe und Gewaltlosigkeit geboren ist. Klaus-Peter Hufer promovierte 1984 in Politikwissenschaften, 2001 folgte die Habilitation in Erziehungswissenschaften. Danach lehrte er als außerplanmäßiger Professor an der Uni Duisburg-Essen.
Liebe berührt eine Person im Innersten
Liebe ist ein wichtiger Teil der Intimität eines Menschen. Das, was eine Person im Innersten berührt, was sie im Innersten mit sich selbst und dem oder der Geliebten auszuhandeln haben, entzieht sich der öffentlichen Welt von Arbeit und Unterhaltung. Obwohl Intimität nicht schon mit dem Privaten übereinstimmt, möchte Peter Trawny zunächst einräumen, dass alles, „was unsere Liebe betrifft, unter uns bleibt“. Hannah Arendt hat das vielfach behauptet. Die „Eigenschaften des Herzens“ bedürfen der „Dunkelheit und des Schutzes gegen das Licht der Öffentlichkeit.“ Nur so können sie sich entfalten und bleiben was sie sind. Nämlich die innersten, verborgenen Antriebe, die sich zur öffentlichen Schaustellung nicht eignen. Peter Trawny gründete 2012 das Matin-Heidegger-Institut an der Bergischen Universität in Wuppertal, dessen Leitung er seitdem innehat.
Liebe macht das Leben reizvoll und süß
In seinem neuen Buch „40 verrückte Wahrheiten über Frauen und Männer“ stellt Michael Lehofer die These auf, dass Liebesbeziehungen mit einer immensen Heilserwartung verbunden sind. Das macht sie so attraktiv. Dennoch scheitern Menschen in ihrem Leben in der Regel an nichts so sehr wie an nicht gelungenen Liebesbeziehungen. Im Groben kann man sagen: Die einen werden süchtig, die anderen resigniert. Mit beiden versuchen die Betroffenen zu kompensieren, was unersetzlich ist: die Liebe. Michael Lehofer schreibt: „In der Liebe flutscht das Leid des Lebens gleichsam durch uns durch. Resignation und Süchtigkeit hingegen bewirken, dass sich das Leid quasi in uns staut. Liebe mach das Leben auf angenehme Weise reizvoll und süß, Resignation und Süchtigkeit verbittern es.“ Univ.-Prof. Dr. med. Dr. phil. Michael Lehofer ist ärztlicher Direktor und Leiter der einer Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie am Landeskrankenhaus Graz II.
Im Zuhause verwirklicht sich der Mensch
Das neue Buch „Das Zuhause“ von Emanuele Coccia handelt von dem Ort, der für das menschliche Glück eine entscheidende Rolle spielt. Der Autor analysiert das Zuhause als einen Raum, in dem Menschen ihre Beziehung zu sich selbst und zur Welt verwirklichen. Emanuele Coccia schreibt: „Genau das ist ein Zuhause: der erste und niemals fertige Entwurf einer Überlappung unseres Glücks mit der Welt.“ Menschen sind Lebewesen, die alles um sich herum manipulieren und verändern müssen, um glücklich zu sein. Es genügt ihnen nicht, die Welt zu kennen und das moralische Gesetz in sich zu befolgen. „Zuhause“ ist für Emanuele Coccia nur ein Name für eine Ansammlung von Anpassungstechniken, die den Menschen helfen, auf der Erde zurechtzukommen. Emanuele Coccia ist Professor für Philosophiegeschichte an der École des Hautes Études en Sciences Sociales in Paris.
Der Liebende liebt das Schöne
In Platons „Symposion“ heißt es: „Der Liebende liebt das Schöne. Das Schöne findet sich nicht nur an einem Menschen.“ Also liebt er nicht nur viele. Nein, als Philosoph muss er sogar viele lieben, weil er sonst eben den allgemeinen Charakter der Schönheit nicht erkennt. Daraus lässt sich für Peter Trawny die Aufforderung ablesen, mit der Ansicht aufzuhören, es gäbe nur einen schönen Körper, nämlich den des gerade Geliebten. Da kann dann die Ehe nur stören. Wie dem auch sei. In Zeiten, in denen die Scheidung zu einer gewöhnlichen Angelegenheit geworden ist, ist ein Lob der Ehe fragwürdig, wenn nicht befremdlich. Peter Trawny vermutet: „Heute schein es nicht nur die Philosophen zu sein, die den allgemeinen Charakter der Schönheit erkannt haben und ihm zusprechen.“ Peter Trawny gründete 2012 das Martin-Heidegger-Institut an der Bergischen Universität in Wuppertal, das er seitdem leitet.
Frédéric Lenoir kennt den Weg zur Weisheit
Wie Sokrates bemerkt, beginnt der Weg zur Weisheit mit der Selbsterkenntnis. Er fordert: „Stell Dir die Frage: Wer bin ich?“ Damit ist nicht nur die biologische Art und Familienangehörigkeit gemeint. Gemeint sind auch nicht nur die kulturelle Zugehörigkeit und auch nicht die soziale. Nein, jeder soll sich nach seiner tiefen inneren Identität fragen. Nur dann wird man laut Frédéric Lenoir herausfinden, dass das Bild, das andere von einem haben und das man anderen vermitteln möchte, seinem echten Wesen vielleicht nicht entspricht. Dass man nicht voll und ganz dem eigenen Selbst entspricht. Diese Selbstbefragung ist sehr wichtig, denn keine Suche nach der Weisheit kann auf der Grundlage eines „falschen Selbst“ gelingen. Die Unkenntnis seiner selbst, seiner inneren Natur sowie seiner wahren Sehnsüchte verhindert den Weg zur Weisheit. Frédéric Lenoir ist Philosoph, Religionswissenschaftler, Soziologe und Schriftsteller.
Die Weisheit zählt die Liebe zu den höchsten Tugenden
Die Weisheit, um mit Epiktet zu sprechen, lädt die Menschen ein zu unterscheiden, was von ihnen abhängt und was nicht. Wenn einem Menschen etwas passiert, das er sich nicht ausgesucht hat, liegt es dennoch an ihm, wie der damit umgeht. Eine schwere Krankheit kann man beispielsweise als Herausforderung ansehen oder sich von ihr niederdrücken lassen. Ein Weiser akzeptiert seine Krankheit, anstatt sie zu verleugnen. Dann versucht er, in Bezug auf das, was er beeinflussen kann, zu handeln. Zum Beispiel gute Medikamente zu finden und so positiv wie möglich mit der Situation umzugehen. Frédéric Lenoir ergänzt: „Schließlich, wenn wir trotz all unserer Anstrengungen nicht gesund werden, müssen wir uns erneut in das Unausweichliche fügen, da wir es nicht vermeiden können: die chronische Krankheit oder den Tod.“ Frédéric Lenoir ist Philosoph, Religionswissenschaftler, Soziologe und Schriftsteller.
Charles Pépin entwirft eine Philosophie der Begegnung
Charles Pépin hat sein neues Buch „Kleine Philosophie der Begegnung“ vor allem deshalb geschrieben, um zu zeigen, dass man den Zufall zu seinem Verbündeten machen kann. Er schreibt: „Er entscheidet nicht über unser Schicksal, sondern wir führen ihn vielmehr herbei.“ Man muss nur den Mut haben, sich auf Unvorhergesehenes einzulassen. Das setzt allerdings voraus, dass man sich über den Mechanismus und die Kraft der Begegnung im Klaren sein muss. Dazu befragt Charles Pépin die großen Denker des 20. Jahrhunderts. Und zwar diejenigen, die in der Nachfolge Hegels die Beziehung zum Anderen und die fundamentalen Bindungen, die sich zwischen zwei Wesen knüpfen können, untersucht haben. Sigmund Freud, Martin Buber, Emmanuel Lévinas, Jean-Paul Sartre, Simone Weil und Alain Badiou stehen bei der Skizzierung einer Philosophie der Begegnung Pate. Charles Pépin ist Schriftsteller und unterrichtet Philosophie. Seine Bücher wurden in mehr als zwanzig Sprachen übersetzt.
Peter Trawny kennt die unglückliche Liebe
Der Selbstmord in der Liebe ist ein bekanntes Ende. Vertraut ist auch, dass in einer spezifischen philosophischen Sicht der Selbstmord Ausdruck urmenschlicher Freiheit und damit von Souveränität ist. Peter Trawny weiß: „Doch die Autoren, die einen solchen Freitod proklamieren – zum Beispiel Seneca – denken in einem anderen Kontext. Man bringt sich um, weil man in einer politisch ausweglosen Lage steckt, weil man unheilbar krank ist, weil man restlos verarmt ist, aber nicht weil man unglücklich liebt. Die Unendlichkeit ist das Ein und Alles der Liebe. Im Augenblick der Vereinigung schwindet Zeit und Ewigkeit entfaltet sich. Eine andere Erfahrung der Zeit stellt sich ein. Doch das Leben sieht anders aus. Peter Trawny gründete 2012 das Martin-Heidegger-Institut an der Bergischen Universität in Wuppertal, das er seitdem leitet.
Die Frage nach dem Sinn eines Kindes wird lauter
In Zeiten der Unsicherheit, genauer der unsicheren Zukunft, wird die Frage nach dem Sinn eines Kindes lauter. Peter Trawny ergänzt: „Solche Zeiten können die eines drohendes Krieges oder einer schwierigen Wirtschaftslage sein. Heute behaupten die Kinder selbst, dass ihnen die prognostizierte ökonomische Katastrophe der Erderwärmung die Zukunft raubt.“ Der Sinn des Kindes scheint auf dem Spiel zu stehen. Steht er immer auf dem Spiel? Schon an der Formulierung wird deutlich, dass das Thema schwierig ist. Aber eine Philosophie der Liebe kommt an ihm nicht vorbei. Warum? Weil Liebe Fruchtbarkeit ist. Das ist eine Aussage, die man begründen muss. Sie wird – Peter Trawny wagt das zu behaupten –, was das Kind betrifft, reserviert betrachtet werden. Peter Trawny gründete 2012 das Martin-Heidegger-Institut an der Bergischen Universität in Wuppertal, das er seitdem leitet.
Heimat kann Geborgenheit vermitteln
Wilhelm Schmid stellt fest: „Liebende, die in einer Waldwiese versinken, folgen der Logik der Gefühle, die sie in sich verspüren. Vielleicht folgen sie jedoch auch der Logik der Landschaft, die sie zu Gefühlen ermuntert.“ Entgegen dem äußeren Anschein ist eine Umgebung nicht einfach nur da. Denn sie ruft auch Gedanken und Gefühle wach, regt etwa ein Verweilen an oder hält davon ab. Sie kann befremden oder die Geborgenheit einer Heimat vermitteln, sei es für die Liebe oder andere Tätigkeiten und Seinsweisen, momentan oder anhaltend. Manche Menschen halten Landschaft für völlig überwertet, nichts als Kulisse, aber es gibt kein Entrinnen. Leben ist immer Leben in einer Landschaft. Heimat ebenso. Die jeweilige Umgebung zu ignorieren dient allenfalls dazu, eine eventuelle Belastung durch sie abzumildern. Wilhelm Schmid lebt als freier Philosoph in Berlin.
Jeder Ort macht die Liebe zur Heimat
Alle Liebenden kennen Landschaften, die unauflöslich mit ihrer Geschichte verquickt sind. Wilhelm Schmid behauptet: „Jeder Ort macht die Liebe zur Heimat.“ In der Momentheimat, die durch das intensive Erleben entsteht, vergessen die Liebenden die Zeit und interessieren sich nicht mehr dafür, wo sie sind. Just die Erfahrung der Zeitlosigkeit markiert jedoch einen Einschnitt in der Zeit, den sie nicht mehr vergessen werden. Es ist wie ein Gongschlag, der noch lange nachklingt. Die Erfahrung stellt eine Beziehung zum Ort her und hebt seine Fremdheit auf, sodass Vertrautheit entsteht. Fast so schön wie die Erfahrung ist die spätere Reflexion. Sie dient dazu, das Erlebte länger auszukosten, ihm nachzusinnen und gewonnene Ereignisse auch künftig für die Kunst des Liebens zu nutzen. Wilhelm Schmid lebt als freier Philosoph in Berlin.
Die Liebe fordert nie etwas
Jacques Lacan schlägt eine ebenso kryptische wie verblüffende Definition der Liebe vor: „Liebe ist die Gabe dessen, was man nicht hat, an jemanden, der es nicht will.“ Die Liebe fordert tatsächlich nie etwas, sie ist nicht Bedürfnisbefriedigung oder Objekthunger. Isabella Guanzini fügt hinzu: „Sie schenkt uns kein Bild – kein idealisiertes Selbstbild –, keine Begabung und auch keine Nahrung.“ Die Liebe gibt nichts oder, besser gesagt, etwas, was jenseits der Dimension von Haben oder Nichthaben liegt. Es befindet sich nämlich im Bereich des Symbolischen, in der Anerkennung des Namens. Man schenkt nicht das, was man hat, sondern das, was man ist. Anders gesagt, die eigene Nichtallmacht und Zerbrechlichkeit, die Leere, die ein Subjekt im anderen eröffnet, sobald es geliebt wird. Isabella Guanzini ist Professorin für Fundamentaltheologie an der Universität Graz.
Ein glückliches Leben muss kein gutes sein
Sokrates hat eine fundamentale Unterscheidung zwischen einem glücklichen und einem guten, das heißt einem rechtschaffenen, Leben eingeführt. Frédéric Lenoir erläutert: „Man kann ein egoistisches Glück suchen, ohne sich allzu sehr um die anderen zu kümmern, oder sich sogar explizit ungerecht verhalten.“ Fast jeder kennt einzelne Personen, die ihr Leben nach dem Motto „Nach mir die Sintflut!“ führen. Sie denken nur an sich selbst oder ihren Clan und interessieren sich nicht im Geringsten für das Gemeinwohl. Im Übrigen glaubt Frédéric Lenoir nicht, dass sie im Innersten glücklich sein können. Denn tiefes Glück ist seiner Meinung nach gebunden an Liebe, Altruismus und ein gerechtes Verhältnis zu anderen. Wie auch immer, sie streben nach dem Glück, aber ohne nach den Regeln des Anstands zu leben. Frédéric Lenoir ist Philosoph, Religionswissenschaftler, Soziologe und Schriftsteller.
Das Wort „Liebe“ kennt viele Bedeutungen
Für Robert Spaemann gibt es kein Wort – außer dem Wort „Freiheit“ vielleicht –, das ein solches Sammelsurium an Bedeutungen in sich vereinigt, und zwar von einander diamentral entgegengesetzten Bedeutungen, wie das Wort „Liebe“. Es bezeichnet Gefühle, die Eltern ihren Kindern, Kinder ihren Eltern, Freunde ihren Freunden entgegenbringen. Robert Spaemann ergänzt: „Aber auch und vor allem das berühmte und nie genug gerühmte Gefühl, das einen Mann und eine Frau miteinander verbindet und das in den heiligen Büchern der Juden und der Christen ebenso wie bei vielen Heiden als Metapher zur Beschreibung des Verhältnisses zwischen Gott und seinem Volk oder zwischen Gott und den Frommen dient.“ Und dann gibt es noch den Begriff der „Vaterlandsliebe“. Robert Spaemann lehrte bis zu seiner Emeritierung Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Die Liebe ist für Max Scheler ein Urakt
Max Scheler vertritt eine Aktphänomenologie, für die das Fühlen als intentionaler Akt eine zentrale Rolle einnimmt. So etwa beim Erfühlen von Werten in seiner bekannten Schrift „Der Formalismus in der Ethik und die materielle Wertethik“. Mit welcher er sich nicht nur gegen die kantische Pflichtethik wendete. Sondern mit der er auch die Grundlegung einer bis heute einflussreichen Position der Wertethik vorlegte. Es verwundert daher nicht, dass in einer Theorie, die das Fühlen derart aufwertet, auch der Liebe eine wichtige Rolle zugeschrieben wird. Max Scheler postuliert einen Primat des Emotionalen im geistigen Geschehen. Dabei versteht er die Liebe als den „Urakt“ menschlicher Geistestätigkeit. Er geht hier von einem christlichen Liebesgedanken aus, wobei er stark an augustinische Gedanken anknüpft. Max Scheler (1874–1928) war ein deutscher Philosoph, Psychologe, Soziologe und Anthropologe.
Die große Wahrheit gibt es nicht
Axel Braig entdeckte durch die Lektüre der „Essays“ von Michel de Montaigne, wie hilfreich philosophische Literatur bei der Auseinandersetzung mit den Fragestellungen des eigenen Lebens sein kann. Auf der Suche nach einer alltagstauglichen Philosophie begegnet der Philosoph, Arzt und Musiker Axel Braig in seinem Buch „Über die Sinne des Lebens und ob es sie gibt“ ganz unterschiedlichen Denkern. Dabei setzt er Epikur, Albert Camus, Ludwig Wittgenstein, Emmanuel Lévinas und viele andere in ein Verhältnis zu ganz konkreten Lebensfragen und Lebenslagen. Ohne ein geschlossenes System zu bilden, fügten sich deren Konzepte mit der Zeit für den Autor zu einem zwar lockeren, aber hilfreichen Geflecht. Statt der einen großen Wahrheit baut Axel Braig auf viele Wahrnehmungen. Damit stimmt er in das philosophische „Lob des Polytheismus“ ein, welches der moderne Skeptiker Odo Marquard gesungen hat.