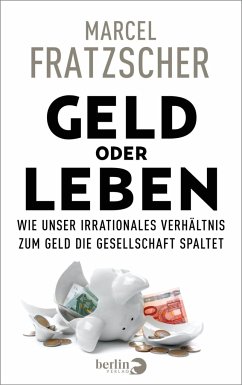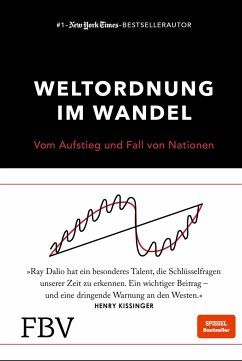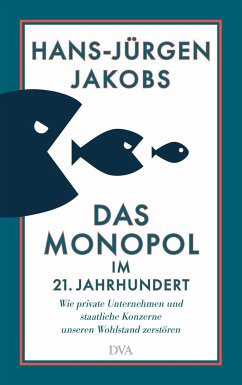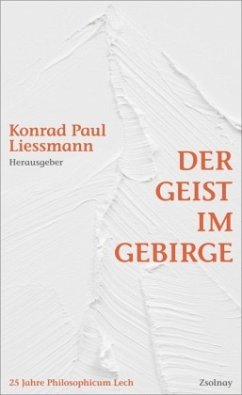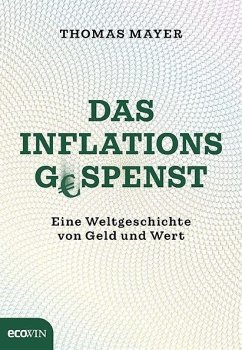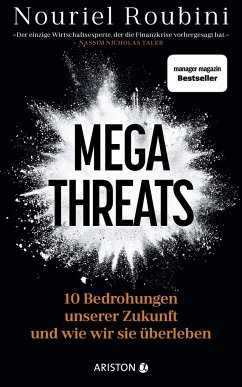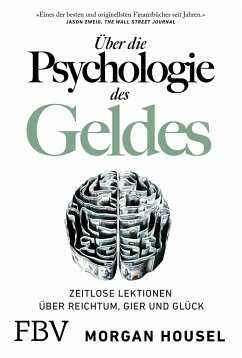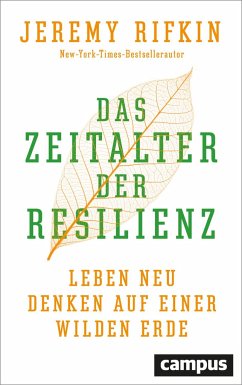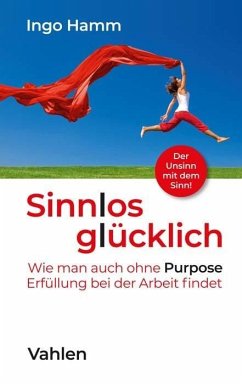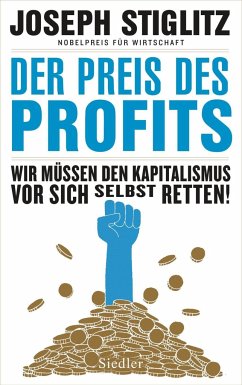Es gibt viele Beispiele, bei denen Schulden von Privatpersonen weder moralisch noch ökonomisch verwerflich erscheinen. Marcel Fratzscher nennt Beispiele: „Schulden für Investitionen in die eigene Qualifikation oder die Bildung der Kinder, für das Eigenheim oder das eigene Unternehmen sind in den meisten Fällen gute Investitionen.“ Nun mag man einwenden, dass selbst solche Schulden nicht immer sinnvoll sein müssen, vor allem nicht dann, wenn die Schuldner sie langfristig nicht zurückzahlen können. Es gibt also verschiedene Facetten, wann und unter welchen Umständen Schulden sinnvoll und notwendig sind und wann nicht. In zahlreichen Fällen sind höhere Schulden kurzfristig notwendig und richtig, um sie langfristig schneller abbauen zu können. Marcel Fratzscher ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) und Professor für Makroökonomie an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Wirtschaft
Langfristig führt der Kapitalismus zur Überschuldung
Evolutionäre Lernprozesse und Produktionssteigerungen sind durchaus bedeutsam. Aber sie lösen keine abrupten Veränderungen daran aus, wer über Wohlstand und Macht verfügt. Ray Dalio weiß: „Die heftigen, unvermittelten Brüche ereignen sich durch Auf- und Abschwünge, Revolutionen und Kriege, denen in erster Linie Zyklen zugrunde liegen. Und diese Zyklen werden ihrerseits durch logische Kausalzusammenhänge angetrieben.“ Im Zeitverlauf ist die Erfolgsformel ein System, in dem sich gut ausgebildete Menschen, die zivilisiert miteinander umgehen, Innovationen einfallen lassen. Sie finanzieren sich über die Kapitalmärkte und besitzen Mittel, durch die ihre Erfindungen Ressourcen produzieren und zuweisen und sich für sie in Form von Gewinn auszahlen. Auf lange Sicht führt der Kapitalismus jedoch zu einem Wohlstands- und Chancengefälle und zur Überschuldung. Ray Dalio ist Gründer von Bridgewater Associates, dem weltgrößten Hedgefonds. Er gehört mit zu den einflussreichsten Menschen der Welt.
Bürokratie in kleinen Unternehmen und bei Selbstständigen
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Selbstständige sehen sich häufig mit einer Vielzahl bürokratischer Herausforderungen konfrontiert. Diese reichen von der Buchhaltung über die Abrechnung bis hin zu Compliance-Fragen. Trotz der Komplexität dieser Aufgaben gibt es jedoch zahlreiche Services, die dabei helfen können, den bürokratischen Aufwand zu reduzieren und effizienter zu gestalten. Buchhaltung: Das Rückgrat der … Weiterlesen
Geld kam mit der Abtretung von Eigentum auf die Welt
Die Ökonomen Gunnar Heinsohn und Otto Steiger vertreten die These, dass Geld mit der Abtretung von Eigentum auf die Welt kam. Thomas Mayer ergänzt: „Die Entstehung von Eigentum ist aus dieser Sicht also die Voraussetzung für die Entstehung von Geld und Zins, die wiederum eine Quelle für wirtschaftliche Effizienz ist.“ Mit ihrer Theorie widersprechen auch Heinsohn und Steiger Adam Smith und stimmen David Graebers These vom Geld als Maß für Schuld zu. Allerdings vertreten sie eine völlig andere Position als David Graeber bei der Einschätzung der Rolle des privaten Eigentums. Während dieses für Heinsohn und Steiger grundlegend für die Geldwirtschaft ist, ist privates Eigentum bei Graeber der Stachel im Fleisch einer harmonischen menschlichen Gemeinschaft. Thomas Mayer ist promovierter Ökonom und ausgewiesener Finanzexperte. Seit 2014 ist er Leiter der Denkfabrik Flossbach von Storch Research Institute.
Der Abstieg eines Landes vollzieht sich zunächst allmählich
Die Niedergangsphase eines geht normalerweise auf interne Konjunkturschwäche im Zusammenspiel mit innenpolitischen Konflikten zurück – oder auf kostspielige außenpolitische Konflikte oder beides. Ray Dalio weiß: „Im Regelfall vollzieht sich der Abstieg eines Landes zunächst allmählich und dann abrupt.“ Innenpolitisch nehmen die Schulden überhand und es kommt zu einem Konjunkturabschwung. Wenn das Land sich nicht länger das nötige Geld leihen kann, um seine Schulden zurückzuzahlen, führt das zu großen internen wirtschaftlichen Schwierigkeiten und zwingt es, sich zwischen einem Staatsbankrott und dem Anwerfen der Druckerpressen zu entscheiden. In dieser Situation entschließt sich das Land fast immer dazu, eine Menge neues Geld zu drucken – erst nach und nach und schließlich mit aller Kraft. Ray Dalio ist Gründer von Bridgewater Associates, dem weltgrößten Hedgefonds. Er gehört mit zu den einflussreichsten Menschen der Welt.
Die Regierung des Geldes verhindert blutige Gewalt
Norbert Bolz vertritt folgende These: „Geld entlastet die Gesellschaft von Menschlichkeiten wie Hass und Gewalt.“ Man kann leicht zeigen, dass sich Zivilität und Urbanität der Kultur der Geldwirtschaft verdanken. Wo Geld die Welt regiert, bleibt Menschen der Terror von nackter Faust und guter Gesinnung erspart. So könnte ein Wirtschaftsliberaler mit guten Gründen argumentieren, dass das weltweite Netzwerk der vielgescholtenen multinationalen Konzerne mehr für den Weltfrieden tun als die Vereinten Nationen. Wo Geld die Welt regiert, herrschen eben nicht: fanatische Ideologie und blutige Gewalt. Die monetarisierte Habsucht zähmt die anderen Leidenschaften. Auf die Liebe zum Geld ist Verlass – hier entfaltet sich ein ruhiges Begehren nach Reichtum. Univ.-Prof. Dr. Norbert Bolz lehrte bis zu seiner Emeritierung als Professor für Medienwissenschaft an der Technischen Universität Berlin.
Thomas Mayer stellt David Ricardo vor
Zum besseren Verständnis des Aufstiegs Großbritanniens zu Supermacht sollte man David Ricardo kennenlernen. Er kam am 18. April als drittes von 17 Kindern zur Welt. Die Familie stammte ursprünglich aus Portugal und war erst kurz zuvor aus den Niederlanden nach London gekommen. Thomas Mayer weiß: „Davids Vater war Börsenmakler und galt als einer der reichsten Männer seiner Zeit. Er führte seinen Sohn im Alter von 14 Jahren in seinen Beruf ein und ließ ihn an der Londoner Börse arbeiten.“ Die Ricardos waren Juden. Doch David verliebte sich im Alter von 21 Jahren in eine Christin, trat zum Christentum über und heiratete sie. Thomas Mayer ist promovierter Ökonom und ausgewiesener Finanzexperte. Seit 2014 ist er Leiter der Denkfabrik Flossbach von Storch Research Institute.
Nouriel Roubini sagte die Immobilienblase in den USA voraus
Im Frühjahr 2006 war der Immobiliensektor der Vereinigten Staaten wie im Rausch. Nouriel Roubini erläutert: „Private Immobilien gingen weg wie warme Semmeln, und wer auf eigenen Beinen in eine Bank gehen konnte, galt schon als kreditwürdig.“ Häuser wurden in der Annahme gekauft, dass die steigenden Preise auch diejenigen Kreditnehmer retten würden, die sich verhoben hatten. In den Augen von Nouriel Roubini war das eine Blase, und das sagte er auch so. In jenem Jahr nahm er in Las Vegas an einer Konferenz über hypothekenbesicherte Wertpapiere teil. Die brandgefährlichen Ramschhypotheken waren nicht zu übersehen. Nouriel Roubinis Untersuchungen zeigten, dass günstige Kredite und laxe Anforderungen eine Immobilienblase nährten. Nouriel Roubini ist einer der gefragtesten Wirtschaftsexperten der Gegenwart. Er leitet Roubini Global Economics, ein Unternehmen für Kapitalmarkt- und Wirtschaftsanalysen.
Sparen ohne Ziel sorgt für Flexibilität und Selbstbestimmung
Sparen ohne Ziel verschafft dem Sparer Zeit zum Nachdenken. Es erlaubt, den Lauf der Dinge zu den eigenen Bedingungen zu ändern. Jedes bisschen Ersparte entspricht einem Dollar beziehungsweise Euro in der Zukunft, der jemand anderen gehört hätte und den man sich selbst zurückgibt. Morgan Housel stellt fest: „Diese Flexibilität und Selbstbestimmung sind eine unsichtbare Rendite auf dein Vermögen.“ Welche Rendite bringt Geld auf dem Konto, das Menschen die Option eröffnet, früher in Rente zu gehen oder sie einfach nur ruhig schlafen lässt. Morgan Housel hält diese Möglichkeit für unschätzbar wertvoll, und zwar in zweierlei Hinsicht: Erstens ist der Nutzen von Reserven so groß, dass sich ihm gar kein Preis zumessen lässt. Morgan Housel ist Partner bei der Risikokapitalgesellschaft The Collaborative Fund.
Anpassung erhöht die Widerstandsfähigkeit
Effizienz ist ein zeitlicher Wert, Resilienz ein Zustand. Eine Effizienzsteigerung geht oft auf Kosten der Widerstandsfähigkeit, doch das Gegenmittel ist nicht mehr Effizienz, sondern Anpassungsfähigkeit. Jeremy Rifkin erläutert: „Die Anpassungsfähigkeit hat große Ähnlichkeit mit dem Konzept der „Harmonisierung“ der Natur, das für östliche Religionen und Philosophien typisch ist.“ Die Effizienz zielt auf die Beseitigung von Reibungsverlusten. Dabei handelt es sich um Redundanzen, die Geschwindigkeit und Optimierung von wirtschaftlichen Aktivitäten bremsen könnten. Während die Effizienz eine zeitliche Größe ist, handelt es sich bei der Produktivität ganz einfach um das Verhältnis von erzielten Erträgen und den eingesetzten Mitteln. Damit sind vor allem technische Mittel und innovative Unternehmenspraktiken gemeint. Jeremy Rifkin ist einer der bekanntesten gesellschaftlichen Vordenker. Er ist Gründer und Vorsitzender der Foundation on Economic Trends in Washington.
Beim Einkommen ist die Ungleichheit in Deutschland sehr hoch
Marcel Fratzscher stellt fest: „Deutschland ist zweifellos eines der reichsten Länder der Welt mit der höchsten Produktivität der Beschäftigten und Unternehmen. Die Löhne und Einkommen sind daher im internationalen Vergleich hoch. Aber die Lebenshaltungskosten sind ebenfalls hoch. Und sie sind durch steigende Mieten gerade in den Städten in den vergangenen Jahren für Beschäftigte mit geringen Einkommen nochmals deutlich gestiegen. Ungewöhnlich viele Menschen können also nicht sparen, weil sie ihr komplettes monatliches Einkommen für ihren Lebensunterhalt benötigen. Bei den Markteinkommen, also den monatlichen Einkommen vor Steuern und Abgaben, ist die Ungleichheit in Deutschland im internationalen Vergleich recht hoch. Sie liegt im oberen Drittel aller Industrieländer. Marcel Fratzscher ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) und Professor für Makroökonomie an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Die Tech-Giganten haben in den USA mehr als 1.000 Firmen gekauft
Ein Erfolgsfaktor der neuen Monopole aus den USA ist das geglückte Ansinnen, über hemmungslose, ehrgeizige Akquisitionen von Firmen in neue Märkte einzudringen – und sich anschließend dort dauerhaft festzusetzen. Hans-Jürgen Jakobs weiß: „Insgesamt haben Google, Apple, Facebook, Amazon und Microsoft in den vergangenen zehn Jahren mehr als eintausend Unternehmen erworben. In manchen Fällen geschah das aus einem einzige Grund: Die Zukäufe sollten helfen, den Markt abzusichern – und den potenziellen Aufstieg neuer Konkurrenten beizeiten zu verhindern.“ Am geeignetsten dafür: „Killer acquisitions“. Das „nächste Amazon“ oder das „nächste Google“ konnte mit dem Wegkaufen von Start-ups vermieden werden. Besonders kompromisslos ging Mark Zuckerberg mit Facebook – heute: Meta Platforms – vor. Zwischen 2005 und 2021 kaufte er allein 92 Unternehmen auf, darunter finden sich Namen wie Gowalla oder Caffeinated Mind, die heute niemanden mehr etwas sagen. Hans-Jürgen Jakobs ist Volkswirt und einer der renommiertesten Wirtschaftsjournalisten Deutschlands.
Deutschland ist nicht „überschuldet“
Finanzielles Sparen ist die Kehrseite von Verschuldung. Marcel Fratzscher erklärt: „Als Individuum kann ich nur dann finanziell sparen, wenn jemand anders gewillt ist, dieses Geld anzunehmen, also direkt oder indirekt mir gegenüber in die Schuld zu gehen.“ Deshalb muss jeder Sparer wollen, dass es ausreichend Schuldner gibt, welche die Ersparnisse nutzen und verlässlich in der Zukunft zurückzahlen können. Je mehr Schuldner und je größer die Nachfrage nach Ersparnissen, desto höher kann auch der Zins sein, also desto lohnender das Sparen. In Einzelfällen mag Überschuldung existieren, in der Gesamtheit kann es sie jedoch nicht geben. Oft wird davon gesprochen, dass Deutschland „überschuldet“ sei. Marcel Fratzscher ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) und Professor für Makroökonomie an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Bescheidenheit erhört die Sparquote
Wenn man Geld ausgibt, müssen erst einmal die körperlichen Grundbedürfnisse erfüllt sein. Morgan Housel weiß: „Danach gönnen wir uns gern ein wenig Bequemlichkeit, darüber hinaus geben wir unser Geld für Unterhaltung und Selbstverwirklichung aus.“ Und weiter? Oberhalb eines recht niedrigen materiellen Niveaus spiegeln die meisten Ausgaben nur noch wider, dass das Ego mit dem Einkommen mitwächst. Das heißt, man gibt Geld aus, um seiner Umgebung zu zeigen, was man hat beziehungsweise hatte. Man sollte diese Erkenntnis bedenken, denn dann merkt man: Eine der besten Methoden, die Sparquote zu erhöhen, besteht nicht darin, das Einkommen zu steigern, sondern die Bescheidenheit. Sobald man Ersparnisse als den Abstand zwischen Ego und seinem Einkommen begreift, wird klar, warum so viele Menschen mit ansehnlichem Einkommen so wenig sparen. Morgan Housel ist Partner bei der Risikokapitalgesellschaft The Collaborative Fund.
Besonnene Verschuldung kann das Leben besser machen
Nouriel Roubini betont: „Besonnene Verschuldung im Zusammenspiel mit Wirtschaftswachstum kann das Leben besser machen, ohne künftige Generationen zu belasten.“ Es ist in Ordnung, auch in schlechten Zeiten Kredite aufzunehmen, etwa um eine Rezession abzuschwächen, wenn in guten Zeiten ein Haushaltsüberschuss erwirtschaftet wird, um die Schuldenquote zu stabilisieren und abzubauen. In den sieben Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg herrschte ein überwiegend positives Umfeld vor, das die Zusammenarbeit der Industrienationen begünstigte. Robustes Wirtschaftswachstum half diesen Staaten, die im Krieg angehäuften Schulden abzubauen. Doch seit den 1970er-Jahren begannen sich unter dieser friedlichen Oberfläche die Anreize zu verschieben. Die Veränderungen setzten langsam ein, doch sie beschleunigten sich unter dem Banner der Globalisierung. Nouriel Roubini ist einer der gefragtesten Wirtschaftsexperten der Gegenwart. Er leitet Roubini Global Economics, ein Unternehmen für Kapitalmarkt- und Wirtschaftsanalysen.
Die Sinnsuche im Job hat epidemische Ausmaße angenommen
Ingo Hamm schreibt: „Wir alle haben keine Sklavenjobs. Niemand von uns muss auf der Galeere rudern oder im Steinbruch Brocken klopfen. Auch verdienen die meisten von uns – hier in der westlichen Welt – ganz ordentlich.“ Es reicht um Leben und es reicht gut, auch wenn viele auf hohem Niveau, sprich mit schönem Häuschen und Drittwagen für den studierenden Filius, klagen. Die meisten Menschen können also zufrieden sein. Im Großen und Ganzen. Nur sie sind es definitiv nicht. Die Sinnsuche im Job hat inzwischen epidemische Ausmaße angenommen wie auch das generelle „Unbehagen in der Arbeitskultur“, wie es Sigmund Freud betiteln würde. Findige Arbeitgeber spüren natürlich dieses brodelnde Unbehagen – eventuell auch und gerade bei sich selbst. Dr. Ingo Hamm ist Professor für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Darmstadt.
Auf dem Höhepunkt eines Landes beginnt schon sein Abstieg
Auf dem Höhepunkt kann ein Land die Erfolge, denen es seinen Aufstieg verdankte, aufrechterhalten. Ray Dalio warnt: „Doch im Lohn des Erfolgs, liegt der Ursprung des Abstiegs begründet. Mit der Zeit wachsen die Verbindlichkeiten und zerstören die sich selbst verstärkenden Rahmenbedingungen, die dem Aufstieg Nahrung gaben.“ Wenn die Menschen in einem Land, das mittlerweile reich und mächtig ist, mehr verdienen, sind sie als Arbeitnehmer teurer und weniger wettbewerbsfähig als Menschen in anderen Ländern, die bereit sind, für weniger Geld zu arbeiten. Gleichzeitig kopieren die Menschen aus anderen Ländern die Methoden und Technologien einer Führungsmacht, was deren Wettbewerbsfähigkeit weiter unterhöhlt. Ebenso gilt: Werden die Menschen in einem führenden Land reicher, arbeiten sie in aller Regel nicht mehr so hart. Ray Dalio ist Gründer von Bridgewater Associates, dem weltgrößten Hedgefonds. Er gehört mit zu den einflussreichsten Menschen der Welt.
Effizienz ist nicht die einzige wirtschaftliche Tugend
Als der wirtschaftliche Flächenbrand im März 2020 begann, schrieb William Galston in einem Leitartikel im „Wall Street Journal“: „Effizienz ist nicht die einzige wirtschaftliche Tugend.“ Er meinte, es könne etwas nicht stimmen mit einem Wirtschaftssystem, das außerstande ist, während einer Gesundheitskrise, wie sie in einem Jahrhundert nur einmal vorkommt, die Grundbedürfnisse der Bevölkerung zu decken. Jeremy Rifkin erläutert: „Galston legte dar, dass der Erfolg der Globalisierung darauf beruht, die Produktion von alltäglichen Gütern und Dienstleistungen in diejenigen Weltregionen zu verlagern, in denen sich durch niedrige Lohnkosten und nicht vorhandene Umweltschutzgesetze effiziente Skaleneffekte erzielen lassen.“ Diese Produkte werden dann mit Containerschiffen und Flugzeugen aus fernen Ländern in die reichen Länder transportiert. Jeremy Rifkin ist einer der bekanntesten gesellschaftlichen Vordenker. Er ist Gründer und Vorsitzender der Foundation on Economic Trends in Washington.
Es gibt circa 18 Messgrößen für die Stärke eines Landes
Die Kerngröße für Wohlstand und Macht entspricht in etwa dem Durchschnitt aus 18 Messgrößen für die Stärke eines Landes. Zu den zentralen Werten zählt Ray Dalio Bildung, Wettbewerbsfähigkeit, Innovation und Technologie, Wirtschaftsleistung, Anteil am Welthandel, militärische Stärke, Bedeutung als Finanzzentrum und Reservewährungsstatus. Die gängige Reservewährung – ebenso wie die Weltsprache – hatte in aller Regel noch Bestand, als der Niedergang eines Imperiums bereits eingesetzt hatte. Denn man verwendete sie auch noch weiter, als die Stärken, die zu dieser breiten Verwendung geführt hatten, schon geschwunden waren. Ray Dalio hebt noch einmal hervor, dass all diese Messgrößen für Stärke eines Imperiums erst zu- und dann abnehmen. Ray Dalio ist Gründer von Bridgewater Associates, dem weltgrößten Hedgefonds. Er gehört mit zu den einflussreichsten Menschen der Welt.
Die Zukunft steckt voller Ungewissheiten
Planung ist wichtig. Aber der wichtigste Teil jedes Plans besteht darin, für den Fall zu planen, dass nicht alles nach Plan verläuft. Wie heißt es so schön? „Willst du Gott zum Lachen bringen, erzähl ihm deine Pläne.“ Natürlich sind Finanz- und Anlagepläne wichtig, weil sie aufzeigen, ob das eigene aktuelle Verhalten sich im Rahmen des Vernünftigen bewegt. Morgan Housel weiß: „Doch die wenigsten Pläne überleben den Kontakt mit der Wirklichkeit lange.“ Ein Plan hilft nur, wenn er den Kontakt mit der Wirklichkeit überlebt. Alle Menschen müssen mit einer Zukunft voller Ungewissheiten leben. Ein guter Plan täuscht darüber gar nicht hinweg. Er lässt bewusst Raum für Irrtümer. Je dringender man auf bestimmte Elemente des eigenen Plans angewiesen ist, desto mehr wackelt die persönliche finanzielle Zukunft. Morgan Housel ist Partner bei der Risikokapitalgesellschaft The Collaborative Fund.
Viele Deutsche halten Schulden für moralisch verwerflich
Viele Deutsche haben ein schwieriges Verhältnis zu Schulden. Sie halten Schulden für moralisch verwerflich, wie schon der zugrunde liegende Begriff „Schuld“ suggeriert. Marcel Fratzscher erläutert: „Schulden zu machen, wird als unsolide Lebensführung betrachtet, ein Leben über die eigenen Verhältnisse.“ Denn muss man nicht zuerst mit der eigenen Hände Arbeit Vermögen schaffen, bevor man es konsumiert? Andere verstehen Schulden als ein Leben zulasten anderer, die für diese Schulden im Notfall aufkommen müssen. Vor allem zukünftige Generationen, denen man kein Vermögen und keine guten Startchancen hinterlässt, sondern Verpflichtungen ihrer Eltern und Großeltern. Aber stimmt diese Wahrnehmung? Wann sind Schulden sinnvoll, und welches Ausmaß ist für einen Staat, ein Unternehmen oder eine Privatperson nachhaltig? Marcel Fratzscher ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) und Professor für Makroökonomie an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Geld entstand als Maßeinheit für Kredit
David Graeber wurde 1961 in New York geboren und war nach eigenen Aussagen seit seinem 16. Lebensjahr Anarchist. Er studierte an der State University of New York und der Universität von Chicago. Dort promovierte er im Jahr 1996. Thomas Mayer ergänzt: „Zwei Jahre später wechselte er an die Yale University, wo er als Assistant and Associate Professor tätig war.“ Im Jahr 2005 entschied sich der Fachbereich Anthropologie dieser Universität David Graebers Lehrauftrag nicht zu verlängern. Dadurch konnte er keine ordentliche Professur erhalten. Dies führte zu erheblichen Protesten von Studenten, Aktivisten und Fachkollegen, die jedoch keinen Erfolg hatten. Nach mehreren viel beachteten Vorträgen erhielt David Graeber 2007 einen Lehrauftrag am Goldsmith College der Universität von London. Thomas Mayer ist promovierter Ökonom und ausgewiesener Finanzexperte. Seit 2014 ist er Leiter der Denkfabrik Flossbach von Storch Research Institute.
Immer wieder stehen Staaten am Abgrund des Bankrotts
Glückliche Schuldner, die ihre Schuld begleichen, kommen voran. Wenn unglückliche Schuldner ihre Schuld nicht begleichen, sind ihre Gründe so vielfältig wie die unseligen Projekte, mit denen sie sich übernehmen. Nouriel Roubini stellt fest: „Das gilt nicht nur für Einzelpersonen, sondern auch für Staaten. Wenn diese am Abgrund des Bankrotts stehen, benötigen sie jemanden, der sie auffängt und ihnen wieder Halt gibt.“ Dazu sind internationale Einrichtungen wie der Weltwährungsfonds und die Weltbank da. Diese sind stark genug, um die hohen wirtschaftlichen Kosten von Fehleinschätzungen, politischen Irrungen und Ungemach zu tragen. Auch wenn die Welt heute wohlhabender ist als je zuvor, ist ein starker Arm immer schwieriger zu finden. Nouriel Roubini ist einer der gefragtesten Wirtschaftsexperten der Gegenwart. Er leitet Roubini Global Economics, ein Unternehmen für Kapitalmarkt- und Wirtschaftsanalysen.
Amazon entwickelte sich zu einem Monopol
Ein Monopol hat man nicht einfach, ein Monopol muss man wollen. Was hier zählt, ist zum einen der unbedingte Wille zur Skalierung, zum Groß-und-immer-größer-Werden, koste es, was es wolle. Hans-Jürgen Jakobs ergänzt: „Ein geradezu manisches Aufwärts-Vorwärts-Streben, das Investoren und Analysten begeistern muss. Üblicherweise rechnen diese Spezialisten haargenau die Zehntel beim Abweichen von den Prognosen aus.“ Das kann prompt zu Liebesentzug führen. Bei Welteroberungsplänen jedoch sind sie tolerant. Wie sonst ist zu erklären, dass sie den Visionen des einst hochdefizitären Online-Buchhändlers Jeff Bezos hingebungsvoll glaubten. Amazon entwickelte sich zu einem Monopol. Denn es wollte sich aus der Masse der ordentlich, nach den Regeln der Analysten vor sich hin verdienenden Unternehmen abheben. Hans-Jürgen Jakobs ist Volkswirt und einer der renommiertesten Wirtschaftsjournalisten Deutschlands.
Werte beeinflussen die Wirtschaft
Der Drohung mit einem Handelskrieg liegen einige grobe Missverständnisse im Welthandelssystem zugrunde. Diese betreffen nicht nur diejenigen, die aufgrund der Art und Weise wie man es managte, Wohlstandseinbußen erlitten. Joseph Stiglitz stellt fest: „Viele Verfechter der Globalisierung nahmen an, einem Freihandelssystem könnten Länder mit völlig unterschiedlichen Wertesystemen angehören. Werte beeinflussen unsere Wirtschaft – und unseren komparativen Vorteil – in tiefgreifender Weise.“ Es kann sein, dass eine weniger freie Gesellschaft auf einem bedeutenden Gebiet, etwa Künstliche Intelligenz, überlegen ist. Big Data ist hier sehr wichtig, und China hat weniger Hemmungen, Daten zu sammeln und zu nutzen. Als die USA und Europa vor rund 25 Jahren ihren Handel mit China ständig ausweiteten, hoffte man, dass dadurch der Prozess der Demokratisierung beschleunigt würde. Joseph Stiglitz war Professor für Volkswirtschaft in Yale, Princeton, Oxford und Stanford. Er wurde 2001 mit dem Nobelpreis für Wirtschaft ausgezeichnet.