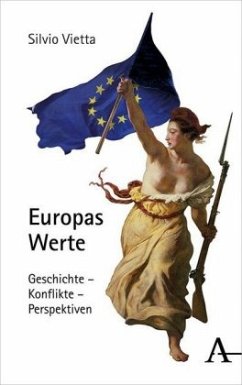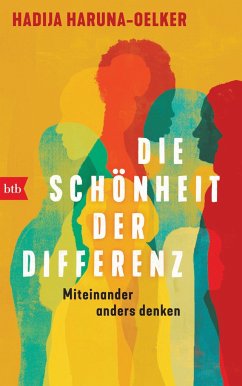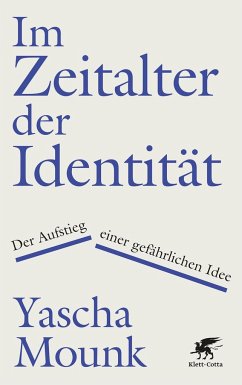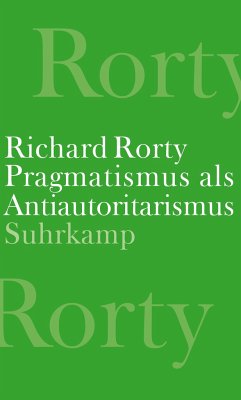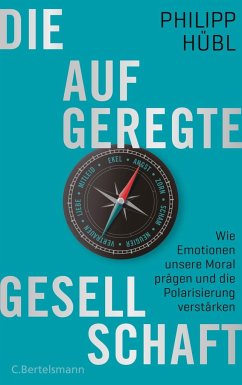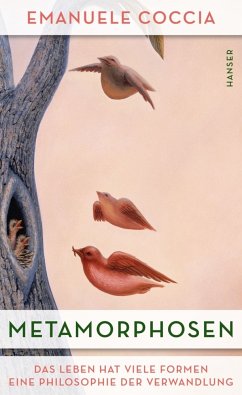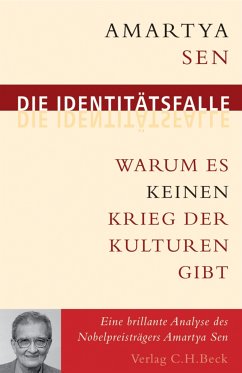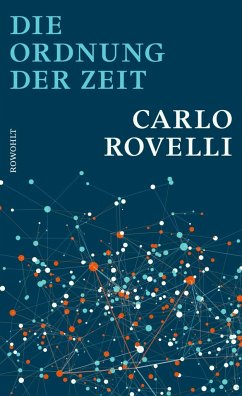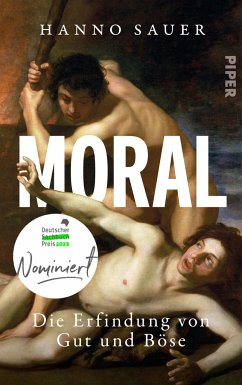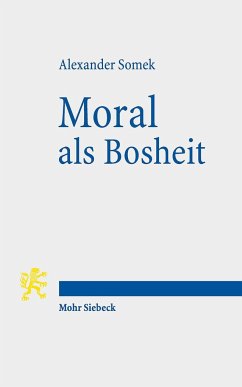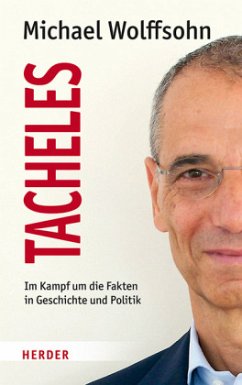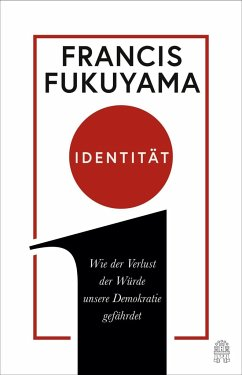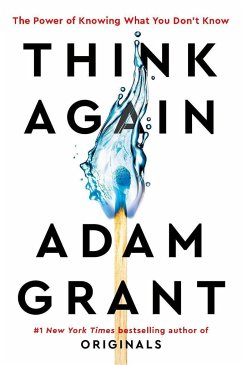Der Begriff der Person entstammt – anders als der der Individualität –, von vornherein dem Humanbereich. Silvio Vietta weiß: „Die Herkunft des Begriffs ist nicht zweifelsfrei belegt. Man nimmt an, das Wort wurde von lateinisch „personare“ abgeleitet im Sinne des Durchdringens einer Stimme durch die Maske.“ Diese Theatermasken hatten individuelle Züge eines Charakters, wenn auch stark stereotypisiert. Sie konnten daher als Anhaltspunkte für bestimmte personale Charakterzüge dienen. Die hellenistische Philologie ging dann auch daran, in philosophischen Texten verschiedene Sprecherrollen ausfindig zu machen. Der Begriff der Person vollzieht dann eine regelrechte „Himmelfahrt“. Er bezeichnet nämlich in der christlichen Theologie des Mittelalters die Einheit von Gottvater, Sohn und heiligem Geist. Prof. em. Dr. Silvio Vietta hat an der Universität Hildesheim deutsche und europäische Literatur- und Kulturgeschichte gelehrt.
Identität
Nationalität ohne Grenzen ist möglich
Immer wieder hört Hadija Haruna-Oelker Menschen im Alltag von „anderer Hautfarbe“ sprechen, wenn sie Schwarz meinen. Sie selbst sagt das nie, weil Weißsein nicht die Norm ist, von der aus sie spricht. Von ihr aus betrachtet: „Was wäre das, „die andere Hautfarbe“? Hadija Haruna-Oelker erklärt: „Es gibt viele dieser unterbewussten Kategorisierungen. Gedanken von „deiner Kultur“ und „meiner Kultur“. Ein Islam, der für die einen zu Deutschland und für die anderen nicht zu Deutschland gehört.“ Es sind die Gegensätze, die man formuliert. Schon seit langer Zeit hat Nationalität im Kopf von Hadija Haruna-Oelker keine Grenzen gehabt, und sie plädiert für ein offenes Konzept von Zugehörigkeit. Hadija Haruna-Oelker lebt als Autorin, Redakteurin und Moderatorin in Frankfurt am Main. Hauptsächlich arbeitet sie für den Hessischen Rundfunk.
Die Differenz der Menschen in Deutschland wird weiter wachsen
Hadija Haruna-Oelker hält fest, dass es eine andere Wirklichkeit gibt, welche die breite Öffentlichkeit bisher nicht zugelassen hat: „Wir leben Leben in Differenz in Deutschland, und diese wird weiter wachsen. Die Differenz war immer da, sollte einst ausgelöscht werden und ist trotzdem nicht aufzuhalten.“ Marginalisierte Menschen warten nicht mehr und verschaffen sich die eigene Sichtbarkeit auf eigenen Bühnen. Sie haben ihre eigenen Methoden der Aufarbeitung geschaffen. Sie sind bereit, diese zu teilen. Es ist der Wunsch von vielen Menschen. Hadija Haruna-Oelker nennt es, ein „Wir-Gefühl“ füreinander zu entwickeln. Und sie meint damit ein Verständnis von „ich fühle mit dir“. Sie meint damit keine Nächstenliebe oder vom Leid anderer bewegt zu sein. Hadija Haruna-Oelker lebt als Autorin in Redakteurin und Moderatorin Frankfurt am Main. Hauptsächlich arbeitet sie für den Hessischen Rundfunk.
Die Identitätssynthese ist eine gefährliche Idee
In seinem neuen Buch „Im Zeitalter der Identität“ setzt sich Yascha Mounk mit dem wachsenden Einfluss neuer Ideen von der Rolle der Identität kritisch auseinander. Yascha Mounk schreibt: „Wie ich es darstelle, haben wir in den letzten Jahren nichts weniger als die Geburt einer neuen Ideologie erlebt – einer Ideologie, die weithin als „woke“ bekannt ist, obwohl ich den Begriff der „Identitätssynthese“ für trefflicher halte.“ Die Identitätssynthese wendete sich von Anfang an ausdrücklich gegen die Werte der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Sie peilt eine Gesellschaft an, in der Kategorien wie das Geschlecht, die Hautfarbe und die sexuelle Orientierung nicht etwa an Bedeutung verlieren – sondern stets bestimmen, wie sich Menschen einander wahrnehmen und behandeln. Yascha Mounk ist Politikwissenschaftler und lehrt an der Johns Hopkins Universität in Baltimore.
Die meisten Gemeinschaften sind exklusivistisch orientiert
Richard Rorty schreibt: „Die Frage, ob es Überzeugungen und Wünsche gibt, die allen Menschen gemeinsam sind, ist ziemlich uninteressant, wenn man nicht von der Vorstellung einer utopischen, inklusivistischen Menschengemeinschaft ausgeht, die nicht mit der Entschiedenheit, mit der sie Fremde ausschließt, stolz ist, sondern auf die Verschiedenheit der Arten von Menschen, die sie willkommen heißt.“ Die meisten menschlichen Gemeinschaften sind jedoch exklusivistisch orientiert. Ihr Identitätsgefühl und das Selbstbild ihrer Angehörigen beruhen auf ihrem Stolz darauf, bestimmten Arten von Menschen nicht anzugehören. Nämlich denen, die den falschen Gott verehren, die falschen Nahrungsmittel essen oder irgendwelche anderen abwegigen, abstoßende Überzeugungen oder Wünsche haben. Richard Rorty (1931 – 2007) war einer der bedeutendsten Philosophen seiner Generation. Zuletzt lehrte er Vergleichende Literaturwissenschaft an der Stanford University.
Stammesmentalität hindert oft beim klaren Denken
Menschen denken in Gruppen und drehen in Gruppen durch. Doch um wieder zu Sinnen zu kommen, ist jeder auf sich gestellt. Philipp Hübl weiß: „Unsere Stammesmentalität hindert uns oft am klaren Denken.“ Mit der progressiven Revolution legen viele Menschen insgesamt weniger Wert auf Autorität und Loyalität und sind dadurch weltweit weniger kollektivistisch. Doch gerade im Internet kann man eine „Retribalisierung“ beobachten, nämlich die Ausbildung moderner Stämme und die Radikalisierung der Etablierten. Es kämpfen neue Rechte gegen alte Linke, Veganer gegen Fleischesser, Fahrradfahrer gegen Autofahrer, Impfgegner gegen Naturwissenschaftler, Gläubige gegen Atheisten. Denn wer aus dem Blickwinkel seiner Stammesidentität lange genug hinschaut, entdeckt immer irgendwo Nachteile für die eigene Gruppe und moralische Verstöße bei den anderen Gruppen. Philipp Hübl ist Philosoph und Autor des Bestsellers „Folge dem weißen Kaninchen … in die Welt der Philosophie“ (2012).
Veränderungen erzeugen zunächst Unbehagen
Jede Form der Veränderung geht zunächst mit einem Unbehagen einher. Emanuele Coccia kritisiert: „Wir haben Bewegung und Wandel zu Fetischen gemacht. Dabei ist alles so angelegt, Bewegung unmöglich zu machen.“ Viele Menschen streben danach, sich fortzubewegen und ihre Stellung in der Gesellschaft zu verändern. Manche möchten auch an einen anderen Wohnort ziehen, von einem Zustand in einen anderen wechseln. Doch all diese Veränderungen sind eine Illusion. Man verschiebe das Leben nur in ein neues Dekor. Die Globalisierung verspricht eine sagenhafte Mobilität in der Geschichte der Menschheit. Fieberhaft wechseln viele Menschen die Orte, sind und bleiben aber alle, wer sie waren. Die Reichen bleiben reich, die Armen haben nicht mehr Chancen am Ziel als am Start. Emanuele Coccia ist Professor für Philosophiegeschichte an der École des Hautes Études en Sciences Sociales in Paris.
Manchmal fächert sich die eigene Identität regelrecht auf
Im neuen Philosophie Magazin 01/2024 geht es im Titelthema um alternative Leben nach dem Motto: „Wer wäre ich, wenn …?“ Viele Möglichkeiten, sich zu entwerfen, bleiben im Laufe eines Lebens unverwirklicht. Die Chefredakteurin Svenja Flaßpöhler schreibt: „Es gibt Momente, in denen sich die eigene Identität regelrecht auffächert.“ Tatsächlich sind Lebensumstände ja nicht einfach wie Kleider, die man einer festen, unveränderbaren Identität überwirft. Lebensumstände haben die Macht, einen Menschen tief zu verändern. Oder noch stärker: Sie haben die die Kraft, einer Person die Möglichkeit eines ganz anderen Ich zu eröffnen. Zunächst einmal kann man das eigene Leben nur vor dem Hintergrund vorstellbarer Alternativen als gestaltbar erfahren. Es stimmt, dass man die Vergangenheit nicht ändern kann. Und doch gibt es auch Entscheidungen, die sich zurücknehmen oder mindestens überdenken lassen.
Unterdrückung passt nicht mehr in diese Welt
Die Menschheit lebt heute in einer globalisierten und digitalisierten Welt, die immer weiter zusammenrückt. In diese Welt passen die unterdrückenden Systeme nicht nur nicht mehr, sondern die Unterdrückten wehren sich ach stärker dagegen. Hadija Haruna-Oelker fügt hinzu: „Diese Menschen tun das im Foucaultschen Sinn und lassen sich nicht mehr zu Gefangenen unserer Geschicke machen.“ Menschenfeindliche Strukturen sind jedoch hartnäckig und das negative Bild einer Differenz spielt bereits im frühen Kindesalter eine Rolle. Es ist eine große und Generationenaufgabe, diese Situation zu verändern. Deshalb ist es Hadija Haruna-Oelker im Zusammenhang mit der Sozialisation und Prägung wichtig, über Kinder als die zukünftige Generation zu sprechen. Hadija Haruna-Oelker lebt als Autorin, Redakteurin und Moderatorin in Frankfurt am Main. Hauptsächlich arbeitet sie für den Hessischen Rundfunkt.
Selbstgewählte Identitäten bergen Gefahren in sich
Amartya Sen betont die Bedeutung der wohlüberlegten Entscheidung für selbstgewählte Identitäten. Nämlich um die Zuschreibung ausschließlicher Identitäten abzuwehren. Und so zu verhindern, dass Menschen sich für Kampagnen mobilisieren lassen, in man gebrandmarkte Opfer terrorisiert. Viele Greueltaten auf der Welt gehen auf Kampagnen zurück, in denen man selbstgewählte Identitäten gegen zugeschriebene austauschte. So verwandelten sich alte Freude in Feinde und widerliche Sektierer schwangen sich zu mächtigen politischen Führern auf. Amartya Sen erläutert: „Es ist daher eine anstrengende und äußerst wichtige Aufgabe, im identitätsbezogenen Denken den Elementen der Vernunft und der freien Wahl Geltung zu verschaffen.“ Denn ist gibt tatsächlich Alternativen zwischen denen Menschen wählen können. Amartya Sen ist Professor für Philosophie und Ökonomie an der Harvard Universität. Im Jahr 1998 erhielt er den Nobelpreis für Ökonomie.
Das Gedächtnis begründet die Identität
Es gibt eine ganz entscheidende Komponente, welche die Identität eines Menschen begründet. Und sie ist wahrscheinlich die Wesentliche, nämlich das Gedächtnis. Carlo Rovelli schreibt: „Wir sind keine Gesamtheit aus voneinander unabhängigen Prozessen, die in aufeinanderfolgenden Momenten ablaufen.“ Jeder Moment der Existenz ist über das Gedächtnis über einen besonderen doppelten Faden mit der Vergangenheit – der unmittelbar vorangehenden und der ferneren – verknüpft. Die Gegenwart eines Menschen wimmelt von Spuren aus seiner Vergangenheit. Menschen sind für sich selbst Geschichten oder Erzählungen. Was einen Menschen ausmacht, sind auch seine Gedanken. Jeder ist diese lange Roman, der sein Leben ist. Menschen bestehen unter anderem aus dem Gedächtnis, das die über die Zeit verstreuten Prozesse zusammenfügt. Carlo Rovelli ist seit dem Jahr 2000 Professor für Physik in Marseille.
Identität kann erworben und verdient werden
Es gibt angeblich eine zentrale Bedeutung der Entdeckung „zu wissen, wer man ist“. Der Politiktheoretiker Michael Sandel hat diese Behauptung auf erhellende Weise erklärt: „Gemeinschaft beschreibt nicht nur, was sie als Mitbürger haben, sondern auch, was sie sind. Es handelt sich dabei nicht um eine Beziehung, die sie wählen, sondern um eine Bindung, die sie entdecken. Das ist nicht nur ein Attribut, sondern ein konstituierender Bestandteil ihrer Identität.“ Amartya Sen weiß: „Die Entdeckung, wo wir stehen, ist jedoch nicht der einzige Weg zu einer bereichernden Identität. Diese kann auch erworben und verdient werden.“ Menschen sind nicht in ihre vorgefundenen Standorte und Zugehörigkeiten eingesperrt. Amartya Sen ist Professor für Philosophie und Ökonomie an der Harvard Universität. Im Jahr 1998 erhielt er den Nobelpreis für Ökonomie.
Alle Menschen teilen universelle Werte
Hanno Sauer stellt in seinem neuen Buch „Moral“ fest, dass universelle Werte scheinbar erodiert sind und eine allgemeingültige Moral der Vergangenheit angehört. Doch seiner Meinung nach trügt der Schein. Denn tatsächlich gibt es universelle Werte, die alle Menschen miteinander teilen. Der Autor erzählt die Geschichte der Moral von der Evolution menschlicher Fähigkeit zur Kooperation vor fünf Millionen Jahren bis zu den jüngsten Krisen moralischer Polarisierung. Und Hanno Sauer erklärt, welche Prozesse die moralische Grammatik der Gegenwart prägen. Wer verstehen will, wie die Moral die Identität der Menschen bestimmt, muss ihre Geschichte verstehen. Sie handelt von allem, was dabei wichtig war: von Werten, Prinzipien, den Quellen der Identität, den Fundamenten der Gemeinschaft und vom Mit- und Gegeneinander. Hanno Sauer ist Associate Professor of Philosophy und lehrt Ethik an der Universität Utrecht in den Niederlanden.
Die Auslegung der religiösen Quellen lässt viel Spielraum
Es kann große Unterschiede im Sozialverhalten verschiedener Anhänger ein und derselben Religion geben. Selbst auf Gebieten, von denen man vielfach meint, sie hingen eng mit der Religion zusammen. Diese Unterschiede darf man jedoch nicht als bloße Aspekte eines neuen, durch die Moderne in die muslimischen Länder getragenen Phänomens verstehen. Amartya Sen ergänzt: „Der Einfluss anderer Interessen, anderer Identitäten lässt sich in der gesamten Geschichte muslimischer Völker beobachten.“ In der Weltgeschichte sind oftmals die Einstellungen zur religiösen Toleranz gesellschaftlich bedeutsam gewesen. Und unter Muslimen findet man in dieser Beziehung eine große Bandbreite. Muslim zu sein ist keine alles überragende Identität, die alles, woran ein Mensch glaubt, determiniert. Amartya Sen ist Professor für Philosophie und Ökonomie an der Harvard Universität. Im Jahr 1998 erhielt er den Nobelpreis für Ökonomie.
Der demographische Wandel prägt die USA
Die USA erleben derzeit einen umfassenden demographischen Wandel. Dieser wird mit Sicherheit frühere Denkansätze in Bezug auf Fragen der Identität, der Gemeinschaft und der sozialen Beziehungen auf den Kopf stellen. Wenn die US-amerikanischen Bürger heute die falschen Entscheidungen treffen, könnte es sein, dass der binäre Gegensatz schwarz / nichtschwarz sich von Neuem behauptet und Rassenprivilegien genauso massiv sind wie eh und je. Danielle Allen ergänzt: „Etwas Ähnliches ließe sich über Europa sagen. So wie es sich gerade mit einer Mischung aus niedrigen Geburtsraten in der einheimischen Bevölkerung, Flüchtlingskrise, binneneuropäischer Migration und der Frage von Europas Zukunft herumschlägt.“ Die Politikwissenschaftlerin und Altphilologin Danielle Allen lehrt als Professorin an der Harvard University. Zugleich ist sie Direktorin des Edmond J. Safra Center for Ethics in Harvard.
Das Geschlecht erheischt öffentliche Anerkennung
Ein schlimmes Unrecht, das man im „Gender Trouble“ zufügen kann, besteht in der Verkennung des wahren, selbstbestimmt festgelegten Geschlechts. Alexander Somek erklärt: „Egal, ob das Geschlecht als freiwillig festgelegt oder als umsichtig entdeckt gilt, es erheischt öffentliche Anerkennung.“ Vor dem Hintergrund dieses Liberalismus gilt jegliches sture Festhalten in der binären Unterscheidung der Geschlechter als ein Affront gegen die freie Selbstbestimmung der Person und damit als ein Unrecht. Aus der Sicht der zeitgenössischen Soziologie, die unsere Gesellschaft als solche von Singularitäten versteht, ist diese Entwicklung nicht weiter überraschend. Sie ist konsistent mit der Vermengung bürgerlicher und romantischer Motive in der Kultur der „Spätmoderne“. Alexander Somek ist seit 2015 Professor für Rechtsphilosophie und juristische Methodenlehre an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien.
Die Religion schafft keine allumfassende Identität
Die Religion eines Menschen muss nicht seine allumfassende oder ausschließliche Identität sein. Amartya Sen nennt ein Beispiel: „Gerade der Islam als Religion enthebt die Muslime in vielen Lebensbereichen nicht der Notwendigkeit einer verantwortungsbewussten Entscheidung.“ Es ist durchaus möglich, dass der eine Muslim eine streitbare Haltung einnimmt, während sich ein anderer sich gegenüber Andersgläubigen vollkommen tolerant verhält. Keiner der beiden hört allein aus diesem Grund auf, ein Muslim zu sein. Es gibt ausgesprochen verworrene Reaktionen auf den islamischen Fundamentalismus und den damit verbundenen Terrorismus. Das liegt daran, wenn man generell versäumt, zwischen islamischer Geschichte und der Geschichte der muslimischen Völker zu unterscheiden. Amartya Sen ist Professor für Philosophie und Ökonomie an der Harvard Universität. Im Jahr 1998 erhielt er den Nobelpreis für Ökonomie.
In einem Staat entscheidet die Kommunikation
Das deutsche Volk ist, wie jedes andere Volk, vor allem eine Lebensgemeinschaft, eine Kommunikationsgemeinschaft und eine Haftungsgemeinschaft. Die Kinder von Türken und anderen Ausländer sind im Allgmeinen keine deutschen Staatsbürger. Selbst dann, wenn sie seit Jahrzehnten in Deutschland leben. Aber sie gehören zweifellos zur Kommunikationsgemeinschaft der Deutschen, weil sie mit ihnen und in Deutschland leben. Herkunft, Sprache oder auch die gemeinsame Geschichte gehören nicht mehr unbedingt zu den Kennzeichen der jeweiligen Gemeinschaft im Staat. Michael Wolffsohn ergänzt: „Doch dieser Staat bleibt trotz aller internationalen Verflechtungen der entscheidende Bezugspunkt der Kommunikation.“ Wenn etwas Erfreuliches passiert, stößt sich niemand an der gemeinsamen Haftungsgemeinschaft. Prof. Dr. Michael Wolffsohn war von 1981 bis 2012 Professor für Neuere Geschichte an der Universität der Bundeswehr in München.
Identität kann auch töten
Ein Identitätsgefühl kann eine Quelle nicht nur von Stolz und Freude, sondern auch von Kraft und Selbstvertrauen sein. Es überrascht Amartya Sen nicht, dass die Idee der Identität so allgemeine Zustimmung erfährt. Vom Grundsatz der Nächstenliebe bei den kleinen Leuten bis hin zu den anspruchsvollen Theorien des sozialen Kapitals und der kommunitaristischen Selbstdefinition. Und dennoch kann Identität auch töten und zwar hemmungslos töten. Ein starkes und exklusives Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gruppe kann in vielen Fällen mit der Wahrnehmung einer Distanz und Divergenz zu anderen Gruppen einhergehen. Amartya Sen weiß: „Solidarität innerhalb der Gruppe kann Zwietracht zwischen Gruppen verstärken.“ Amartya Sen ist Professor für Philosophie und Ökonomie an der Harvard Universität. Im Jahr 1998 erhielt er den Nobelpreis für Ökonomie.
Die Würde lässt sich demokratisieren
Während des 19. Jahrhunderts ging das Verständnis der Würde auseinander. Einerseits in Richtung eines liberalen Individualismus, der in den politischen Rechten zeitgenössischer freiheitlicher Demokratien zum Ausdruck kommen sollte. Andererseits in Richtung kollektiver Identitäten, die sich entweder durch Nation oder Religion definieren ließen. In den neuzeitlichen liberalen Demokratien Nordamerikas und Europas hat sich eine besondere Identität herausgebildet. Francis Fukuyama erklärt: „In diesen Regionen haben die politischen Systeme nach und nach immer weiteren Personenkreisen Rechte gewährt, was zu einer Demokratisierung der Würde führte.“ Die Verfassung der Vereinigten Staaten wurde im Jahr 1788 ratifiziert. Zu dieser Zeit besaßen nur weiße Männer, die über Grundbesitz verfügten, volle politische Rechte. Francis Fukuyama ist einer der bedeutendsten politischen Theoretiker der Gegenwart. Sein Bestseller „Das Ende der Geschichte“ machte ihn international bekannt.
Zwänge schränken Freiheiten ein
Viele kommunitaristische Denker neigen zu folgender Ansicht: Eine dominierende gemeinschaftliche Identität sei lediglich eine Sache der Selbsterkenntnis, nicht aber der Wahl. Für Amartya Sen ist es jedoch schwer zu glauben, dass ein Mensch wirklich keine Wahl hat, zu entscheiden, welche relative Bedeutung er den verschiedenen Gruppen beimisst, denen er angehört. Und dass er seine Identitäten lediglich zu entdecken braucht, so als handle es sich um ein rein natürliches Phänomen. In Wirklichkeit treffen alle Menschen ständig Entscheidungen über die Prioritäten, die sie ihren verschiedenen Zugehörigkeiten und Mitgliedschaften beimessen. Die Freiheit, über die persönlichen Loyalitäten und Gruppen, denen man angehört, selbst zu entscheiden, ist eine besonders wichtige Freiheit. Amartya Sen ist Professor für Philosophie und Ökonomie an der Harvard Universität. Im Jahr 1998 erhielt er den Nobelpreis für Ökonomie.
Die Metamorphose ist die Bestimmung des Menschen
Einmal geboren, haben die Menschen keine Wahl mehr. Emanuele Coccia erklärt: „Die Geburt lässt uns die Metamorphose zur Bestimmung werden. Wir sind nur auf der Welt, weil wir geboren wurden.“ Das Gegenteil trifft aber genauso zu. Geboren zu sein, bedeutet ein Stück dieser Welt zu sein. Gewiss, allerdings eines, dessen Gestalt die Menschen verändern mussten. Die Menschen sind eine Metamorphose dieses Planeten. Und einzig durch Metamorphose haben sie Zugang zu sich selbst und zu allen übrigen Körpern erhalten. Sie haben das Stück Materie, das sie beherbergt, verändert, um auf die Welt zu kommen. Sie haben sich dem Körper und Leben ihrer Eltern anverwandt und deren Lauf verändert. Emanuele Coccia ist Professor für Philosophiegeschichte an der École des Hautes Études en Sciences Sociales in Paris.
Geistige Offenheit kann man lernen
In seinem neuen Buch „Think Again“ fordert Adam Grant seine Leser dazu auf, die Komfortzone fester Überzeugungen zu verlassen. Denn nur wer Zweifel und unterschiedliche Ansichten zulässt, ohne sich in seinem Ego bedroht zu fühlen, eröffnet sich die großartige Chance, wirklich neue Erkenntnisse zu gewinnen. In einer Welt, die sich rasant verändert, brauchen die Menschen dringend die Fähigkeit, Gedachtes zu überdenken und sich von Erlerntem wieder zu lösen. Adam Grant vertritt in „Think Again“ die These, dass man geistige Offenheit lernen kann. Dazu muss man seine kognitive Trägheit überwinden. Viele Menschen ziehen jedoch oft die Bequemlichkeit, an alten Ansichten festzuhalten, der Schwierigkeit vor, sich mit neuen Sichtweisen auseinanderzusetzen. Adam Grant ist Professor für Organisationspsychologie an der Wharton Business School. Er ist Autor mehrerer internationaler Bestseller, die in 35 Sprachen übersetzt wurden.
Jeder Mensch hat viele Identitäten
Geschichte und Herkunft sind nicht die einzigen Aspekte, unter denen sich Menschen sind und die Gruppen, denen sie angehören, betrachten. Amartya Sen weiß: „Die Kategorien, denen wir gleichzeitig angehören, sind sehr zahlreich.“ Dabei muss man zwei Gesichtspunkte beachten. Erstens die Einsicht, dass Identitäten entschieden plural sind und dass die Wichtigkeit einer Identität nicht die Wichtigkeit anderer zunichtemachen muss. Für das Leben in einer Gesellschaft kann es extrem wichtig sein, sich auf die eine oder andere Weise mit anderen zu identifizieren. Doch war es nicht immer leicht, Gesellschaftsanalytiker dazu zu bewegen, die Identität angemessen zu berücksichtigen. So stößt man in der theoretischen Natur zur Gesellschafts- und Wirtschaftsanalyse gehäuft auf zwei Arten von Reduktionismus. Amartya Sen ist Professor für Philosophie und Ökonomie an der Harvard Universität. Im Jahr 1998 erhielt er den Nobelpreis für Ökonomie.
Es gibt zwei Phänomene der Identität
Die Französische Revolution hatte weltweit immense Auswirkungen auf das Verständnis von Identität. Obwohl der Begriff damals noch nicht Verwendung fand, lassen sich doch fortan deutlich zwei Phänomene der Identität unterscheiden. Diese gehen von unterschiedlichen Prämissen aus. Francis Fukuyama erklärt: „Eine Gruppierung verlangte die Anerkennung der Würde von Individuen, während die andere die Anerkennung der Würde von Kollektiven in den Vordergrund rückte.“ Die erste, individualistische Fraktion ging von der Voraussetzung aus, dass alle Menschen frei geboren und in ihrem Streben nach Freiheit gleichwertig sind. Die Schaffung politischer Institutionen sollte allein dem Ziel dienen, so viel wie möglich jener natürlichen Freiheit zu erhalten, soweit sie im Einklang mit der Notwendigkeit eines gemeinsamen Gesellschaftslebens stand. Francis Fukuyama ist einer der bedeutendsten politischen Theoretiker der Gegenwart. Sein Bestseller „Das Ende der Geschichte“ machte ihn international bekannt.