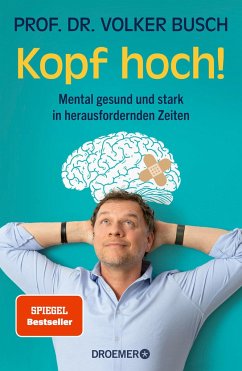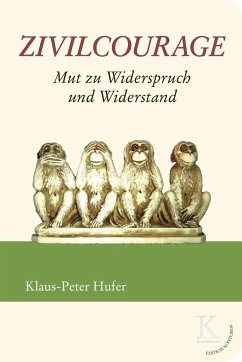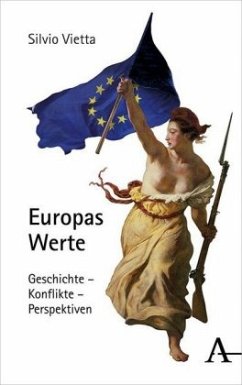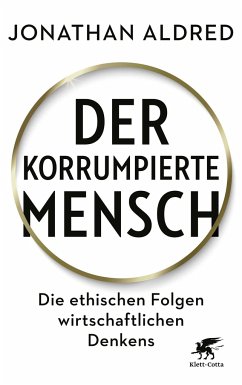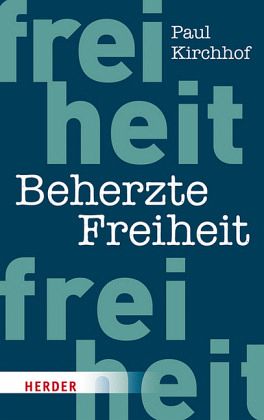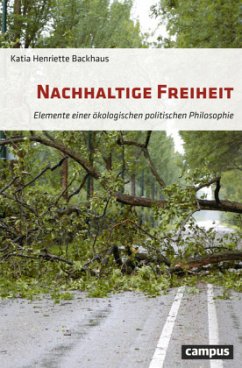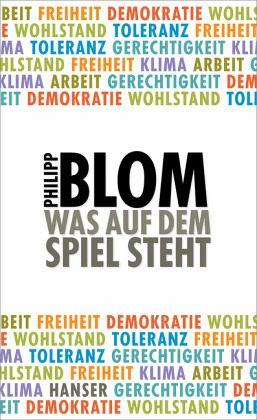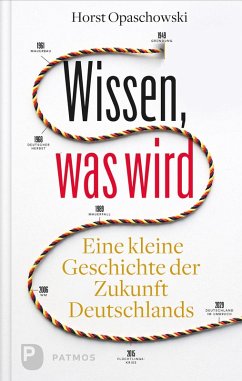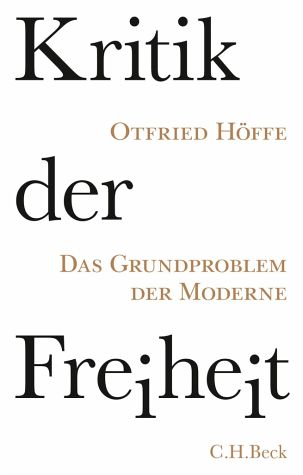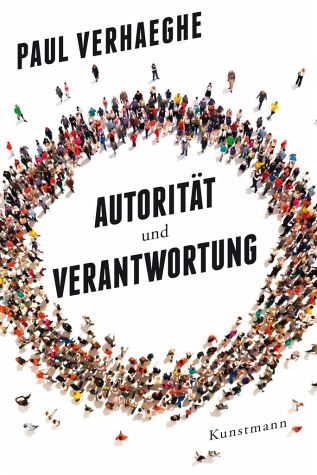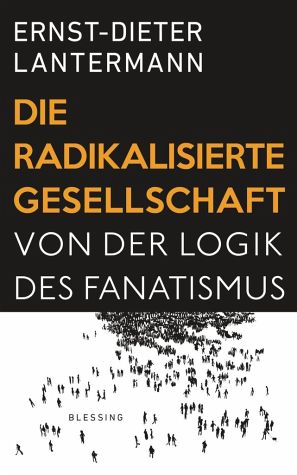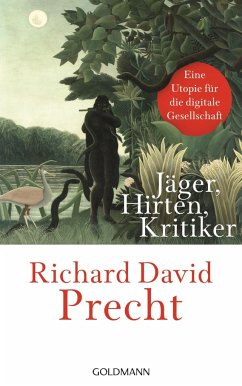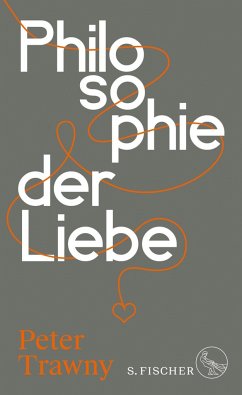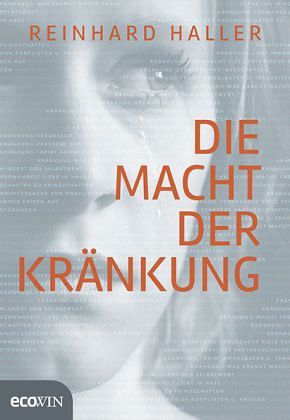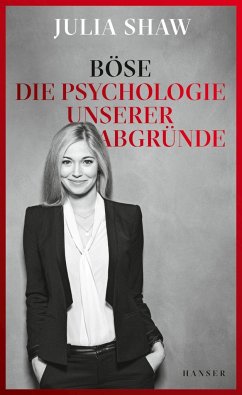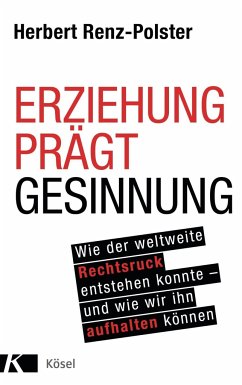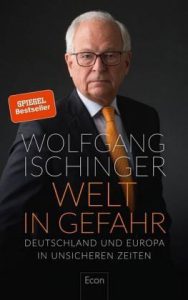„Kopf hoch!“ ist ein Sachbuch mit Ratgeberfunktion, in dem Volker Busch versucht, ausgehend von einer knappen gesellschaftlichen „Zeitdiagnose“ Möglichkeiten für einen besseren Umgang mit den psychischen Belastungen des Alltags zu beschreiben. Dabei konzentriert er sich auf die mentale Stärkung und die Stabilisierung. Hauptbestandteile dieses Buches sind Geist und Gehirn. „Kopf hoch!“ umfasst unter anderem einfach aufbereitete neurowissenschaftliche Fakten und therapeutisches Erfahrungswissen. Dieses Buch hat Volker Busch für Leser geschrieben, die angesichts ihrer aktuellen Lebensumstände in irgendeiner Weise belastet sind, ohne psychisch manifest krank zu sein. Er spricht diejenigen an, die im Laufe der letzten Zeit empfindsamer und weniger belastbar geworden sind, am Abend angespannt und gestresst sind, dünnhäutiger und reizbarer reagieren und schneller aus der Haut fahren als früher, nachdenklich geworden sind und viel grübeln oder ihre Leichtigkeit und Lockerheit im Leben vermissen. Prof. Dr. Volker Busch ist seit circa zwanzig Jahren als Arzt, Wissenschaftler, Autor und mehrfach ausgezeichneter Vortragsredner tätig.
Sicherheit
Menschen müssen in Sicherheit leben können
Beim zivilcouragierten Handeln geht es um die Beibehaltung einer Zivilgesellschaft. Zudem geht es um die Verteidigung der Menschenrechte, um die Bewahrung der Demokratie und um den Schutz von Opfern durch Diskriminierung. Klaus-Peter Hufer ist besorgt: „Beides ist gefährdet, im Alltag, in der Gesellschaft und in der Politik – und durch diese. Menschen müssen in Würde, Sicherheit und Freiheit leben können – dafür muss immer gesorgt werden, muss wachsam hingeschaut und entschieden gehandelt werden.“ Die Probleme beginnen bei individuellen Beleidigungen und setzen sich fort über Mobbing beim Arbeitsplatz. Des Weiteren kommt es zu öffentlichen Pöbeleien und Behinderungen von beispielsweise Rettungskräften bei ihren Einsätzen. Klaus-Peter Hufer promovierte 1984 in Politikwissenschaften, 2001 folgte die Habilitation in Erziehungswissenschaften. Danach lehrte er als außerplanmäßiger Professor an der Uni Duisburg-Essen.
Der Mensch ist von Natur aus ein gieriges Wesen
Silvio Vietta stellt fest: „Der englische Staatstheoretiker und Philosoph Thomas Hobbes geht davon aus, dass der Mensch in seinem Naturzustand ein gieriges Wesen ist. Dieses will alles haben und dem ja auch alles offen zu stehen scheint.“ Wenn aber nun alle Mitmenschen naturgemäß auch so veranlagt sind, entsteht daraus zwangsläufig eine Art Konkurrenz aller gegen alle um die vorhandenen Ressourcen. Thomas Hobbes hat dies noch schlimmer formuliert, nämlich als „Krieg aller gegen alle“. Wie kann man dem gegensteuern? Nach Thomas Hobbes eigentlich nur so, dass sich die Menschen verpflichten, ihre Macht an einen Dritten abzutreten, der für diese Preisgabe aber eines verbürgt: Sicherheit und Ordnung. Prof. em. Dr. Silvio Vietta hat an der Universität Hildesheim deutsche und europäische Literatur- und Kulturgeschichte gelehrt.
Manche Risiken sind unberechenbar
Jonathan Aldred stellt fest: „Manche Risiken haben zwei Merkmale, die es sehr viel schwieriger machen, mit ihnen fertig zu werden. Erstens: reine Ungewissheit. Zweitens: das Potenzial einer Katastrophe.“ Dabei handelt es sich nicht nur um eine negative, sondern um eine qualitativ andersartig negative Entwicklung. Diese führt in vielen Fällen zu unumkehrbaren Schäden oder Verlusten. Oder es kommt zu einem Zusammenbruch der zugrunde liegenden Systeme, Organisationen oder Bezugssysteme, innerhalb derer man Entscheidungen trifft. Vermutlich weisen sowohl die Klimaveränderung als auch globale Finanzkrisen diese beiden Merkmale auf. Wenn es um solche Risiken geht, ist das traditionelle ökonomische Denken fahrlässig. Jonathan Aldred ist Direktor of Studies in Ökonomie am Emmanuel College. Außerdem lehrt er als Newton Trust Lecturer am Department of Land Economy der University of Cambridge.
Der Staat muss seine Befugnisse begrenzen
Sicherheit und öffentlicher Frieden setzen voraus, dass der Staat die Gestaltung des individuellen Lebens in der Freiheit des Bürgers belässt. Und dass er im Freiheitsvertrauen auf die Redlichkeit und Tüchtigkeit seiner Bürger und Wähler seine eigenen Aufgaben und Befugnisse begrenzt. Paul Kirchhof erläutert: „Gemeinschaftliche Lebensbereiche wie die Wirtschaft, die Wissenschaft, die Kunst, insbesondere das Familienleben bleiben in privater Hand.“ Diese Freiheit schafft Vielfalt. Sie setzt auf die Bereitschaft zum Wagnis, erwartet neue Entwicklungen, erlaubt Korrektur und Erneuerung auch im Prinzipiellen. Das Grundgesetz fordert vom Staat, dass er um des inneren Frieden willen die Frage nach der religiösen Wahrheit offenlässt. Dr. jur. Paul Kirchhof ist Seniorprofessor distinctus für Staats- und Steuerrecht an der Universität Heidelberg. Als Richter des Bundesverfassungsgerichts hat er an zahlreichen, für die Entwicklung der Rechtskultur der Bundesrepublik Deutschland wesentlichen Entscheidungen mitgewirkt.
Die Revolution hat ihre Gegner
Anfangs war der Gedanke der „Brüderlichkeit“ in der Französischen Revolution frei von jeder Aggressivität. Der Revolutionär will den neuen, den besseren Menschen schaffen, der sich die Ziele der Revolution zu eigen macht. Deshalb arbeitet er in einer gemeinsamen Brüderlichkeit auf den Umsturz mit den Methoden der Revolution hin. Paul Kirchhof weiß: „Doch diese Revolution hat ihre Gegner: den König und sein Gefolge, die Aristokraten, das Feudalsystem, den hohen Klerus, schließlich alle Andersdenkenden.“ Dadurch wird die „Brüderlichkeit“ zu einem ausgrenzenden Begriff: „Jeder Franzose ist heute euer Bruder, bis er sich offen als Verräter am Vaterland erweist. Da die Aristokraten kein „Vaterland“ hätten, seien sie von vornherein vom Kreis der Brüder ausgenommen. Dr. jur. Paul Kirchhof ist Seniorprofessor distinctus für Staats- und Steuerrecht an der Universität Heidelberg.
Im Jahr 1776 löst sich Amerika von England
Bekanntlich entflammte der amerikanische Freiheitsdrang am Problem der Steuererhebung. Der Kampfruf „No taxation without representation“ rief die revolutionären Kräfte der neuen Welt auf in den Kampf gegen das englische Mutterland. Silvio Vietta blickt zurück: „Mit der Unabhängigkeitserklärung vom 4. Juli 1776 löste sich Nordamerika von England durch die Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika.“ Thomas Jefferson, der wichtigste Autor der „Declaration of Independence“, hatte John Locke und andere Aufklärer gelesen. Die neue Staatsgründung sollte die Sicherheit und auch das Glück ihrer Bürger gewährleisten. Und sie sollte die Bürger schützen, vor allem auch durch die Bindung der Repräsentanten der Macht an das Recht. Dies sollte mittels Freiheitsgarantien und Gewaltenteilung geschehen. Prof. em. Dr. Silvio Vietta hat an der Universität Hildesheim deutsche und europäische Literatur- und Kulturgeschichte gelehrt.
Gefahren lassen sich in zwei Kategorien einteilen
Die negative Freiheit ist robust und kann die individuelle Freiheit gegen Gefahren schützen. Die Vorstellung eines unangreifbaren Freiheitsraums des Individuums, so merkt Charles Taylor an, mutet wie die Errichtung einer Barriere gegen den Totalitarismus an. Die von Isaiah Berlin Ende der 1950er-Jahre geschilderten Gefahren lassen sich laut Katia Henriette Backhaus in zwei Kategorien einordnen. Erstens entsteht eine Gefährdung der Freiheit, sobald die metaphysische Annahme einer „höheren Instanz“ gemacht wird, die naturgemäß Unterwerfung verlangt. Die andere Gefahr ist weniger schillernd, aber politisch nicht weniger wirkmächtig. Nämlich die Verwechslung von Freiheit mit anderen politischen Werten wie Sicherheit oder Anerkennung. Katia Henriette Backhaus hat an der Universität Frankfurt am Main im Bereich der politischen Theorie promoviert. Sie lebt in Bremen und arbeitet als Journalistin.
Der Mensch beansprucht Autonomie
Die Rechtsgarantien von Freiheit, Gleichheit und Sicherheit wirken miteinander und gegeneinander. Man muss sie deshalb aufeinander abstimmen und gemeinsam zur Geltung bringen. Paul Kirchhof erklärt: „Der Mensch ist nicht frei, sondern freiheitsberechtigt. Er beansprucht in Bindungen an Staat und Recht, in Familie und Gesellschaft, in Natur und Technik ein Stück selbstbestimmter Autonomie.“ Der Mensch ist nicht gleich, sondern gleichberechtigt. Alle Menschen sind in ihrer Individualität verschieden, dürfen in Freiheit ihre Verschiedenheit mehren. Sie sollen also nicht gleich sein, sondern maßvoll angeglichene Lebensverhältnisse vorfinden. Deshalb behauptet die Verfassung nicht, alle Menschen seien gleich, sondern stellt sie „vor dem Gesetz“, dem Instrument rechtlicher Entscheidungen, gleich. Dr. jur. Paul Kirchhof ist Seniorprofessor distinctus für Staats- und Steuerrecht an der Universität Heidelberg.
Der Staat muss für Sicherheit sorgen
Die Entwicklung des menschlichen Zusammenlebens zu einem Staat bestimmt das Verständnis des Menschen über seine Fähigkeit zur Freiheit und zum Frieden. Paul Kirchhof erläutert: „Bekämpfen sich die Menschen, muss eine öffentliche Hand herrschen und Sicherheit gewährleisten. Wird der Herrscher zur Bedrohung individueller Freiheit, entwickeln die Menschen ein Regierungssystem der Gewaltenteilung.“ Traut der Staat den Menschen zu, ihre Konflikte letztendlich ohne Gewalt – ohne Faust und Fehde – zu lösen, organisiert er eine Gerichtsbarkeit, die in allein sprachlicher Auseinandersetzung Streit schlichtet und Frieden schafft. Der Kampf findet mit Worten statt, nicht mit Waffen. Dr. jur. Paul Kirchhof ist Seniorprofessor distinctus für Staats- und Steuerrecht an der Universität Heidelberg. Als Richter des Bundesverfassungsgerichts hat er an zahlreichen, für die Entwicklung der Rechtskultur der Bundesrepublik Deutschland wesentlichen Entscheidungen mitgewirkt.
Die Ökonomie missbraucht die Ideen der Aufklärung
Es ist für Philipp Blom erstaunlich zu sehen, was im Zusammenhang des verabsolutierten Marktes aus den Ideen der Aufklärung wird, die ein fester Bestandteil seiner Theorien sind. Hier wie dort sind Menschen rational, liegt ihr Heil in der Vernunft. Beide sind universalistisch und tolerant. Sie gehen davon aus, dass Menschen von Geburt an mit Freiheiten und Rechten ausgestattet sind. Beide sehen optimistisch in die Zukunft, die besser, gerechter und wohlhabender sein wird. Der alles entscheidende Unterschied wird laut Philipp Blom allerdings wirksam, wenn diese Gedanken aus dem Kontext der philosophischen Debatte in den der ökonomischen Theorie transportiert werden und dabei ihre qualitativen Aspekte verlieren. Philipp Blom studierte Philosophie, Geschichte und Judaistik in Wien und Oxford und lebt als Schriftsteller und Historiker in Wien.
Der Fortschritt wird immer unberechenbarer
Eine Ära der Unsicherheit hat weltweit begonnen. Die Menschen müssen umdenken und lernen, in und mit dauerhaft unsicheren Zeiten zu leben. Horst Opaschowski nennt ein Beispiel: „Die Finanzmärkte kennen diese Volatilität schon lange: Kein Vermögenswert ist mehr wirklich sicher.“ Nach dem amerikanischen Risikoforscher Nicholas Taleb brauchen die Menschen ein neues Denken für eine Welt, die bei allem Fortschritt immer unberechenbarer wird. Seine Antwort und Empfehlung für die Herausforderungen in unsicheren Zeiten lautet: „Antifragilität“. Damit ist eine Lebenshaltung gemeint, die mehr als stark, solide, robust und unzerbrechlich ist. Horst Opaschowski gründete 2014 mit der Bildungsforscherin Irina Pilawa das Opaschowski Institut für Zukunftsforschung. Bis 2006 lehrte er als Professor für Erziehungswissenschaften an der Universität Hamburg. Ab 2007 leitete er die Stiftung für Zukunftsfragen.
Der Staat muss dem Bürger dienen
Zu den wichtigsten Aufgaben jedes Staates gehört es, die Bürger von der Selbstverteidigung ihrer Rechte zu entlasten. Aus diesem Grund übernimmt der Einzelstaat den Schutz der Bürger mitsamt ihren Rechten. Zu diesem Zweck erhält er innenpolitische Souveränität. Otfried Höffe ergänzt: „Das Gewaltmonopol, sofern er jede Privatjustiz verbietet, bleibt erhalten.“ Aber eine Relativierung muss sich der Staat freilich gefallen lassen. Weil kein Staat denselben rechtsmoralischen Rang wie ein Individuum hat, ist kein Staat, auch keine Religion oder Tradition „Zweck an sich selbst“. Er dient vielmehr dem einzigen Wesen, dem ein intrinsischer moralischer Wert zukommt, der einzelnen Person. Das Individuum bedarf freilich, um seine Freiheit im Zusammenleben zu wahren, des öffentlichen Rechts. Otfried Höffe ist Professor für Philosophie und lehrte in Fribourg, Zürich und Tübingen, wo er die Forschungsstelle Politische Philosophie leitet.
Viele Menschen glauben an eine Führerfigur
Im Unterschied zur traditionellen Auffassung, dass Autorität in Gott begründet liegt, sowie in Immanuel Kants Überzeugung, dass der Mensch selbstständig denken muss, glauben viele Menschen, dass Autorität am besten von einer Führerfigur ausgehen sollte. Paul Verhaeghe stellt fest: „Den Glauben an einen großen Anführer, der aufgrund seiner natürlichen Eigenschaften (er ist weise und gerecht) die Befehlsgewalt erwirb oder zumindest bekommt, gab es zu allen Zeiten.“ Die Idee geht zurück auf Platons Philosophenkönig, doch der wichtigste Impuls ging von Thomas Hobbes aus. Nach ihm legt Jean-Jaques Rousseau eine sehr eigene Interpretation des Gedankens vor. Und in Deutschland plädierte zu Beginn des vorigen Jahrhunderts seinerseits Max Weber für eine charismatische Führerschaft. Paul Verhaeghe lehrt als klinischer Psychologe und Psychoanalytiker an der Universität Gent.
Die scheinbar bedrohten Eliten schotten sich ab
Weltweit haben Sozialwissenschaftler in Studien herausgefunden, dass eine wesentliche Ursache für die Ausbreitung geschlossener Wohnformen das gesellschaftspolitische Klima in einer Region ist. Ernst-Dieter Lantermann erläutert: „Je tiefer die Kluft zwischen Arm und Reich und je engagierter in der Öffentlichkeit diese Spaltung diskutiert wird, umso häufiger werden Gated Communities errichtet.“ Für den Religionswissenschaftler Manfred Rolfes ist es keine Überraschung, wenn ein einem öffentlichen Diskurs, der zum einen Armut als Bedrohung kommuniziert, zum anderen den wachsenden Reichtum einer kleinen Minderheit zum Thema macht, Gated Communities gedeihen, in denen die Begüterten vor den ökonomisch und sozial Benachteiligten geschützt werden müssen. Für den Soziologen Ulrich Vogel-Sokolowsky sind Gated Communities Ausdruck einer wachsenden Polarisierung zwischen Arm und Reich auch in Deutschland. Ernst-Dieter Lantermann war von 1979 bis 2013 Professor für Persönlichkeits- und Sozialpsychologie an der Universität Kassel.
Ein selbstbestimmtes Leben erträgt Ungewissheit
Ernst-Dieter Lantermann schreibt: „Angesichts der geballten Unsicherheiten gerät bei vielen Menschen die Balance zwischen ihren Bedürfnissen nach Sicherheit und Wagnis gründlich aus dem Gleichgewicht. Eine Balance, in der mal die Lust auf Neues und Risiko, dann wieder das Verlangen nach Sicherheit und Verlässlichkeit das Handeln leitet.“ Der Wunsch nach neuen, den eigenen Horizont erweiternden Selbst- und Welterfahrungen, die nicht ohne Gefahr zu haben sind, tritt zurück. Oberhand gewinnt ein heftigen Verlangens nach Überschaubarkeit, Struktur, Orientierung, Abschottung und Sicherheit. Das Verlangen nach Ordnung und Schutz veranlasst manche Menschen, radikale oder fanatische Haltungen zu entwickeln. Von diesen versprechen sie sich neue Welt- und Selbstgewissheiten und zugleich ein neues, gefestigtes positives Selbstwertgefühl. Ernst-Dieter Lantermann war von 1979 bis 2013 Professor für Persönlichkeits- und Sozialpsychologie an der Universität Kassel.
Die Überwachung breitet sich im Alltag aus
Die Suche nach Lösungen der Überwachung und Kontrolle ist nicht nur auf China und die USA beschränkt. Auch in Deutschland springen Geheimdienste und Polizei auf den Zug auf. Damit optimieren sie im Zuge der scheinbaren Terrorbekämpfung ihre Möglichkeiten. In den Achtzigerjahren empörten sich viele Menschen in Deutschland über die Volkszählung und den maschinenlesbaren Personalausweis. Heute sind sie bereit, Techniken der Überwachung in ihrem Alltag zu dulden. Richard David Precht kritisiert: „In vielen kleinen Schritten verschiebt sich damit das Verhältnis von Sicherheit und Freiheit gewaltig.“ Und zwar nicht, weil sich die Bedrohungslage in Deutschland in den letzten Jahren vergrößert hat. Es gibt heute einfach viele technische Möglichkeiten, die es früher nicht gab. Der Philosoph, Publizist und Autor Richard David Precht zählt zu den profiliertesten Intellektuellen im deutschsprachigen Raum.
Die Freiheit kann für die Liebe zum Problem werden
„Freiheit“ ist spätestens seit den Zeiten der Aufklärung, seit Immanuel Kant also, eines der großen Worte der Gesellschaft, der Moral und der Politik. Peter Trawny nennt ein Beispiel: „Als erster Begriff der Triade „Liberté, Egalité, Fraternité“ hat sie die Französische Revolution angeführt.“ So ist es auch kein Wunder, dass das Wort ganz am Beginn der Präambel der Menschenrechtserklärung von 1948 auftaucht. Frei sein zu wollen ist heutzutage scheinbar ein derart banaler Wunsch, dass die meisten Menschen ihn für gewöhnlich gar nicht mehr thematisieren. Wenn die Freiheit bedroht zu sein scheint, ist die Empörung allerdings groß. Dabei ist der Begriff der Freiheit besonders in Form des feministischen Projekts immer noch höchst aktuell. Peter Trawny gründete 2012 das Martin-Heidegger-Institut an der Bergischen Universität in Wuppertal, das er seitdem leitet.
Werte verleihen einem Menschen Sicherheit
Zu den sensibelsten Bereichen eines Menschen gehören seine Werte, besonders der Selbstwert. Werte sind die als erstrebenswert oder moralisch gut betrachteten Eigenschaften von Menschen, Verhaltensweisen, Handlungsmuster und Charaktereigenschaften, aber auch von Ideen, Sachverhalten und Gegenständen. Reinhard Haller fügt hinzu: „Aus solchen Wertvorstellungen bilden wir unsere Wertesysteme und darauf aufbauend können wir Wertentscheidungen treffen.“ Werte sind ein wichtiges Element einer jeglichen Gesellschaft und Kultur. Sie werden durch ebendiese Kultur und Gesellschaft weitergegeben. Werte geben metaphysisch-religiöse Orientierung, prägen die soziale Ausrichtung und sind zentraler Bestandteil des humanistischen Denkens. Die Wertphilosophie, die ihre Höhepunkte in der Güterethik des Aristoteles und in der „Idee des Guten“ von Platon hatte, wurde später von der Moraltheologie aufgegriffen. Reinhard Haller ist Chefarzt einer psychiatrisch-psychotherapeutischen Klinik mit dem Schwerpunkt Abhängigkeitserkrankungen.
Unvorhersagbarkeit ist potenziell gefährlich
Viele Menschen haben Angst vor der Dunkelheit, da sie nicht wissen, was sich in ihr verbirgt. Julia Shaw weiß: „Es ist das Unvorhersehbare, vor dem wir uns fürchten. Bei Menschen, die anders denken als wir, fragen wir uns, was sie als nächstes tun werden. Wir können ihre Gedanken und erst recht ihre Denkweise nicht verstehen.“ Die meisten Menschen mögen diese Art von Unvorhersagbarkeit nicht. Ordnung und Kontrolle vermitteln ein Gefühl der Sicherheit. Unvorhersagbarkeit ist potenziell gefährlich. Dass viele Menschen psychische Erkrankungen stigmatisieren, ist nichts Neues, doch es ist ein hartnäckiges, verheerendes Vorurteil. Eine der auffälligsten Verhaltensweisen, die sie gegenüber psychisch Kranken an den Tag legen, ist, Abstand zu ihnen zu wahren: sowohl sozial als auch psychisch. Julia Shaw forscht am University College London im Bereich der Rechtspsychologie, Erinnerung und Künstlicher Intelligenz.
Rechtspopulisten stehen der Globalisierung feindlich gegenüber
Die AfD ist im Jahr 2020 in Deutschland die konsequenteste – und einzige – Partei, die der Globalisierung feindlich gegenübersteht. Herbert Renz-Polster fügt hinzu: „Und blickt man auf die Wirtschaftspolitik der neuen Rechten in den USA, so zeigen sich die Rechtspopulisten sogar als die einzigen erfolgreichen Globalisierungsgegner.“ Globalisierung und Rechtspopulismus, da scheint Feuer auf Wasser zu treffen. Der erste Grund dafür dürfte ein offensichtlicher sein: Der grenzüberschreitende Austausch von Ideen, Waren, Kapital und Dienstleistungen passt einfach nicht zu dem identitären Rückzugsprogramm der Rechtspopulisten – da hat man dann doch eher die eigene Volksgemeinschaft im Blick als den Abbau von Barrieren, die den weltweiten Handel behindern. Der Kinderarzt Dr. Herbert Renz-Polster hat die deutsche Erziehungsdebatte in den letzten Jahren wie kaum ein anderer geprägt.
Gated Communities sind auch in Deutschland auf dem Vormarsch
Nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland werden Gated Communities oder geschlossene Wohnkomplexe immer beliebter. Bis vor wenigen Jahren war diese Wohnform hierzulande noch weitgehend unbekannt. Wohnsoziologen und Kulturgeografen, die sich mit diesem Phänomen beschäftigen, sind sich sicher, dass die Entwicklung hin zu abgeschlossenen Wohnen auch in Deutschland kaum aufzuhalten sein wird. Ernst-Dieter Lantermann erklärt: „ Geschlossene Wohnkomplexe sind abgeschirmte und bewachte Wohnkomplexe mit Zugangsbeschränkungen, die in zwei Varianten gebaut werden – als Apartmentanlagen oder als Ensembles von Häusern und Eigentumswohnungen auf einem von der näheren Umgebung abgesonderten Territorium.“ „Arcadia“, die deutschlandweit erste Gated Community wurde in Potsdam errichtet, 45 Wohnungen und sieben Villen stehen auf einem parkähnlichen Grundstück in bester Lage. Ernst-Dieter Lantermann war von 1979 bis 2013 Professor für Persönlichkeits- und Sozialpsychologie an der Universität Kassel.
Nur der Mensch kann die Herrschaft über sich selbst und die Welt gewinnen
Der Mensch beobachtet, wie die Vögel fliegen, mit Leichtigkeit in den Himmel aufsteigen und sich wieder herabfallen lassen. Er bewundert diese Kunst. Er staunt. Doch dann macht er sich bewusst, dass er die Welt zwar nicht von oben herab sehen, wohl aber in seinem Denken an die Vergangenheit erinnern und aus Erfahrung in die Zukunft voraussehen kann. Paul Kirchhof fügt hinzu: „Er kann sprechen und die Welt in Begriffen begreifen. Er kann Gesetzmäßigkeiten der Natur und Gesetze menschlichen Verhaltens erkennen und so die Herrschaft über sich selbst und die Welt gewinnen.“ Dr. jur. Paul Kirchhof ist Seniorprofessor distinctus für Staats- und Steuerrecht an der Universität Heidelberg. Als Richter des Bundesverfassungsgerichts hat er an zahlreichen, für die Entwicklung der Rechtskultur der Bundesrepublik Deutschland wesentlichen Entscheidungen mitgewirkt.
Europas muss sich mehr um die eigene Sicherheit kümmern
Es wird in Deutschland immer wieder das Argument vorgetragen, Europa müsse die Zeichen der Zeit erkennen und sich endlich von den USA abnabeln. Durch das, was die Welt jetzt mit Donald Trump erlebt, wird die Notwendigkeit, dass Europa sich handlungsfähiger macht, deutlicher als je zuvor. Und Wolfgang Ischinger stimmt zu: „Es kann nicht dauerhaft politisch tragfähig sein, dass 500 Millionen wohlhabende Europäer wesentliche Teile ihrer Sicherheit an den atlantischen Partner auf der anderen Seite des Ozeans outsourcen.“ Insofern müssen die Europäer das Thema Sicherheit energischer in die eigene Hand nehmen, genau wie es die deutsche Kanzlerin Angela Merkel in ihrer Truderinger Rede gesagt hat. Wolfgang Ischinger ist Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz und einer der renommiertesten deutschen Experten für Außen- und Sicherheitspolitik.
Fremdenfeindlichkeit gedeiht vor allem in unsicheren Gesellschaften
Fremdenfeindliche Einstellungen und Überzeugungen gedeihen besonders gut in einer Gesellschaft, die ihres Zusammenhalts nicht mehr gewiss ist und daher ihren Mitgliedern keinerlei Sicherheitsversprechen mehr anbieten kann. Dieter-Lantermann fügt hinzu: „So muss jeder selbst für seine eigenen Sicherheiten sorgen, ohne Netz und doppelten Boden, ohne die Gewissheit einer festen sozialen Verortung, ohne selbstverständlich geltende Normen, Verhaltensregeln und Handlungsorientierungen, die das Miteinander in der Gesellschaft verlässlich und berechenbar organisieren und leiten. Menschen, die sich ihrer sozialen und gesellschaftlichen Zughörigkeit, Wertschätzung und sozialen Identität unsicher geworden sind, neigen häufig zu zugespitzten fremdenfeindlichen Haltungen, von denen sie sich neue soziale und persönliche Sicherheiten versprechen. Auf die Frage worin der „Sicherheitsgewinn“ solcherart radikaler Haltungen gegenüber Zuwanderern aus fremden Ländern und Kulturen liegt, weiß Ernst-Dieter Lantermann eine Antwort. Ernst-Dieter Lantermann war von 1979 bis 2013 Professor für Persönlichkeits- und Sozialpsychologie an der Universität Kassel.