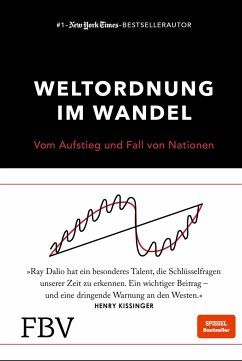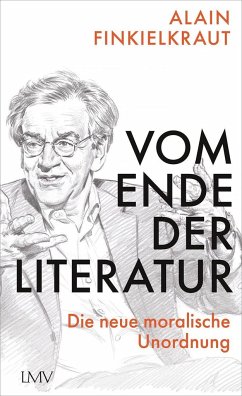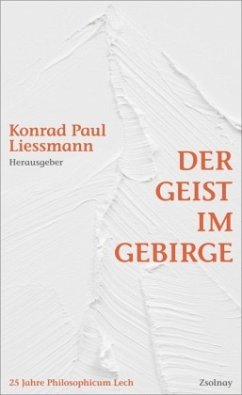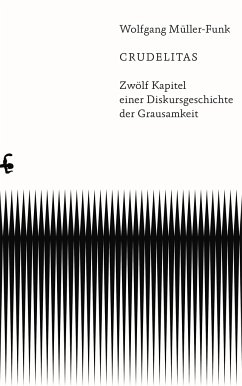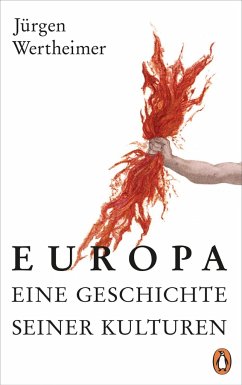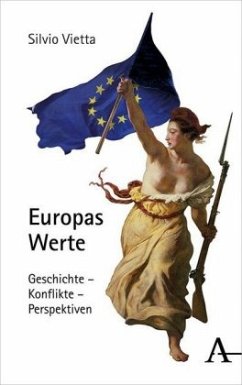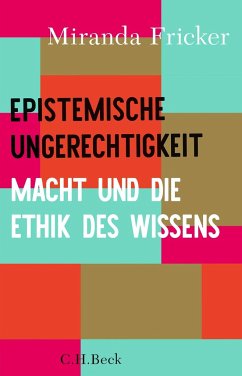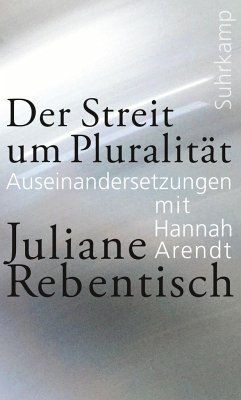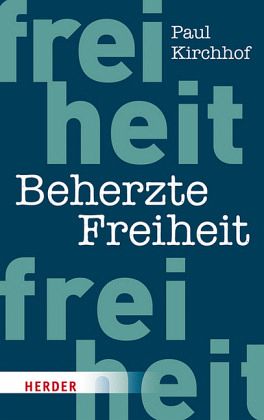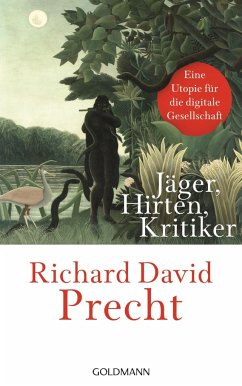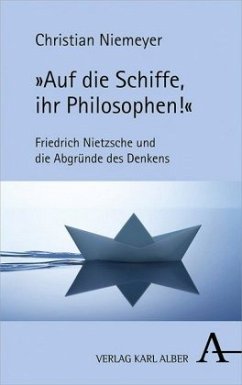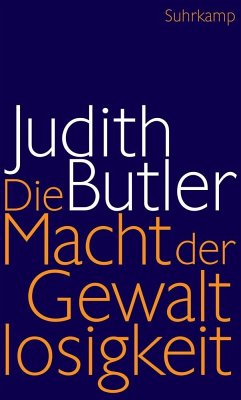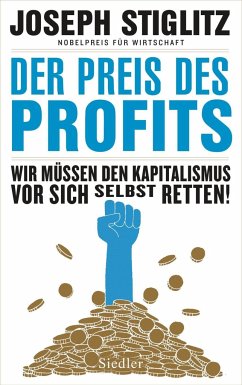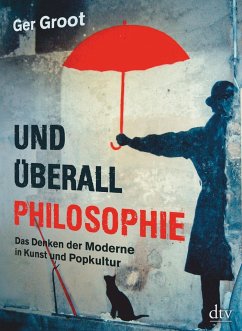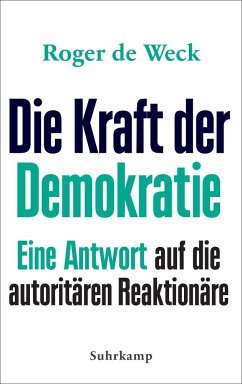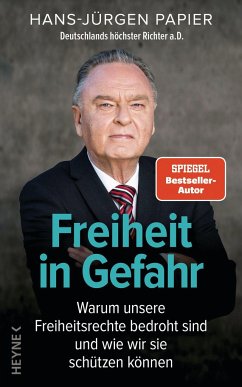Evolutionäre Lernprozesse und Produktionssteigerungen sind durchaus bedeutsam. Aber sie lösen keine abrupten Veränderungen daran aus, wer über Wohlstand und Macht verfügt. Ray Dalio weiß: „Die heftigen, unvermittelten Brüche ereignen sich durch Auf- und Abschwünge, Revolutionen und Kriege, denen in erster Linie Zyklen zugrunde liegen. Und diese Zyklen werden ihrerseits durch logische Kausalzusammenhänge angetrieben.“ Im Zeitverlauf ist die Erfolgsformel ein System, in dem sich gut ausgebildete Menschen, die zivilisiert miteinander umgehen, Innovationen einfallen lassen. Sie finanzieren sich über die Kapitalmärkte und besitzen Mittel, durch die ihre Erfindungen Ressourcen produzieren und zuweisen und sich für sie in Form von Gewinn auszahlen. Auf lange Sicht führt der Kapitalismus jedoch zu einem Wohlstands- und Chancengefälle und zur Überschuldung. Ray Dalio ist Gründer von Bridgewater Associates, dem weltgrößten Hedgefonds. Er gehört mit zu den einflussreichsten Menschen der Welt.
Macht
Es gibt eine neue Moral und den Willen zur Umerziehung
Was der Mensch hervorbringt, misst man stets an derselben Elle der Humanität, dem Maßstab gleichberechtigter Menschenwürde. Alain Finkielkraut fügt hinzu: „Keine Möglichkeit wird übersehen, eine Mühe gescheut, wenn es darum geht, Geist und Herz zu öffnen.“ Man beurteilt Philip Roth und Milan Kundera als zu sexistisch, um den Nobelpreis zu verdienen. Und man verdammt Vladimir Nabokovs „Lolita“ aus allen Lehrveranstaltungen der Universitäten. So kann man sich rühmen, niemanden mehr zu privilegieren und die Missetaten und Wunschvorstellungen der letzten Vertreter der patriarchalischen Gesellschaft zu verdammen. Der Bannstahl der neuen Moral und der Wille zur Umerziehung entspringen jedoch nicht dem „Tugendideal der Askese“, sondern einem „egalitären Ideal“. Man hütet sich übrigens, das Wort Tugend zu verwenden, weil man sich unbedingt vom Krieg gegen die Libido distanzieren will. Alain Finkielkraut gilt als einer der einflussreichsten französischen Intellektuellen.
Die Regierung des Geldes verhindert blutige Gewalt
Norbert Bolz vertritt folgende These: „Geld entlastet die Gesellschaft von Menschlichkeiten wie Hass und Gewalt.“ Man kann leicht zeigen, dass sich Zivilität und Urbanität der Kultur der Geldwirtschaft verdanken. Wo Geld die Welt regiert, bleibt Menschen der Terror von nackter Faust und guter Gesinnung erspart. So könnte ein Wirtschaftsliberaler mit guten Gründen argumentieren, dass das weltweite Netzwerk der vielgescholtenen multinationalen Konzerne mehr für den Weltfrieden tun als die Vereinten Nationen. Wo Geld die Welt regiert, herrschen eben nicht: fanatische Ideologie und blutige Gewalt. Die monetarisierte Habsucht zähmt die anderen Leidenschaften. Auf die Liebe zum Geld ist Verlass – hier entfaltet sich ein ruhiges Begehren nach Reichtum. Univ.-Prof. Dr. Norbert Bolz lehrte bis zu seiner Emeritierung als Professor für Medienwissenschaft an der Technischen Universität Berlin.
Auf dem Höhepunkt eines Landes beginnt schon sein Abstieg
Auf dem Höhepunkt kann ein Land die Erfolge, denen es seinen Aufstieg verdankte, aufrechterhalten. Ray Dalio warnt: „Doch im Lohn des Erfolgs, liegt der Ursprung des Abstiegs begründet. Mit der Zeit wachsen die Verbindlichkeiten und zerstören die sich selbst verstärkenden Rahmenbedingungen, die dem Aufstieg Nahrung gaben.“ Wenn die Menschen in einem Land, das mittlerweile reich und mächtig ist, mehr verdienen, sind sie als Arbeitnehmer teurer und weniger wettbewerbsfähig als Menschen in anderen Ländern, die bereit sind, für weniger Geld zu arbeiten. Gleichzeitig kopieren die Menschen aus anderen Ländern die Methoden und Technologien einer Führungsmacht, was deren Wettbewerbsfähigkeit weiter unterhöhlt. Ebenso gilt: Werden die Menschen in einem führenden Land reicher, arbeiten sie in aller Regel nicht mehr so hart. Ray Dalio ist Gründer von Bridgewater Associates, dem weltgrößten Hedgefonds. Er gehört mit zu den einflussreichsten Menschen der Welt.
Es gibt circa 18 Messgrößen für die Stärke eines Landes
Die Kerngröße für Wohlstand und Macht entspricht in etwa dem Durchschnitt aus 18 Messgrößen für die Stärke eines Landes. Zu den zentralen Werten zählt Ray Dalio Bildung, Wettbewerbsfähigkeit, Innovation und Technologie, Wirtschaftsleistung, Anteil am Welthandel, militärische Stärke, Bedeutung als Finanzzentrum und Reservewährungsstatus. Die gängige Reservewährung – ebenso wie die Weltsprache – hatte in aller Regel noch Bestand, als der Niedergang eines Imperiums bereits eingesetzt hatte. Denn man verwendete sie auch noch weiter, als die Stärken, die zu dieser breiten Verwendung geführt hatten, schon geschwunden waren. Ray Dalio hebt noch einmal hervor, dass all diese Messgrößen für Stärke eines Imperiums erst zu- und dann abnehmen. Ray Dalio ist Gründer von Bridgewater Associates, dem weltgrößten Hedgefonds. Er gehört mit zu den einflussreichsten Menschen der Welt.
Terror und Gewalt führen zu keiner stabilen Macht
Gewalt und Macht lassen sich mit Hannah Arendt dadurch unterscheiden, dass Erstere prozessual, dynamisch und zeitlich begrenzt ist. Letztere stellt dagegen eine strukturelle Größe dar, die dauerhaft, und, was fast dasselbe ist, institutionalisiert ist. Gewalt ist ein Komplement von Macht, insofern sie, wie Michel Foucault dargelegt hat, auf einem System von möglichen psychischen und/oder physischen Bestrafungen basiert, die gleichsam den symbolischen Horizont aller Macht bildet. Wolfgang Müller Funk ergänzt: „Das, was als politischer Körper bezeichnet wird, wäre gewissermaßen der Foucaultsche Aspekt des Zusammenhangs von Macht und Gewalt. Jenseits der Befunde des französischen Denkers besteht der Verdacht, dass keine Macht, die allein auf Terror und Gewalt beruht, dauerhaft stabil ist. Wolfgang Müller-Funk war Professor für Kulturwissenschaften in Wien und Birmingham und u.a. Fellow an der New School for Social Research in New York und am IWM in Wien.
Führende Weltmächte bestimmten die Weltordnung
Seit Menschengedenken gelangten verschiedene Gruppen von Menschen, zum Beispiel Stämme, Königreiche, Länder et cetera, zu Wohlstand und Macht. Sie erarbeiteten sich diese entweder selbst, jagten sie anderen ab oder sie fielen ihnen durch Bodenschätze zu. Ray Dalio fügt hinzu: „Hatten sie erst mehr Wohlstand und Macht auf sich vereint als jede andere Gruppe, avancierten sie zur führenden Weltmacht, was es ihnen erlaubte, die Weltordnung zu bestimmen.“ Verloren sie ihren Wohlstand und ihre Macht – und das passierte ausnahmslos allen –, so kam es zu tiefgreifenden Veränderungen der Weltordnung und aller Lebensbereiche. Fast alle Imperien verzeichneten Perioden des Aufstiegs, gefolgt von Zeiten des Niedergangs. Ray Dalio ist Gründer von Bridgewater Associates, dem weltgrößten Hedgefonds. Er gehört mit zu den einflussreichsten Menschen der Welt.
Der „europäische Geist“ erlebte eine Krise
War man um die Mitte des 17. Jahrhunderts durch die zermürbende Erfahrung des Krieges klüger geworden? ES kann jedenfalls kein Zufall sein, dass mehr oder weniger simultan europaweit Tendenzen zu beobachten sind, an allem, was mit überkommenen Machtstrukturen zu tun hat, Kritik zu üben. Jürgen Wertheimer weiß: „Das betrifft Regierungsformen wie Denkstile. England unter der republikanischen Diktatur Oliver Cromwells oder die Revolte der Niederlande gegen die spanische Hegemonie sind nur zwei Beispiele für die beginnende Korrosion traditioneller Herrschaftsgefüge.“ Weit deutlicher jedoch als im Bereich der Politik zeigen sich die Zeichen eines generellen Umbruchs im Bereich der Künste und Wissenschaften. Denn der „europäische Geist“ erlebte in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts eine massive Krise. Jürgen Wertheimer ist seit 1991 Professor für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft und Komparatistik in Tübingen.
Der Mensch ist von Natur aus ein gieriges Wesen
Silvio Vietta stellt fest: „Der englische Staatstheoretiker und Philosoph Thomas Hobbes geht davon aus, dass der Mensch in seinem Naturzustand ein gieriges Wesen ist. Dieses will alles haben und dem ja auch alles offen zu stehen scheint.“ Wenn aber nun alle Mitmenschen naturgemäß auch so veranlagt sind, entsteht daraus zwangsläufig eine Art Konkurrenz aller gegen alle um die vorhandenen Ressourcen. Thomas Hobbes hat dies noch schlimmer formuliert, nämlich als „Krieg aller gegen alle“. Wie kann man dem gegensteuern? Nach Thomas Hobbes eigentlich nur so, dass sich die Menschen verpflichten, ihre Macht an einen Dritten abzutreten, der für diese Preisgabe aber eines verbürgt: Sicherheit und Ordnung. Prof. em. Dr. Silvio Vietta hat an der Universität Hildesheim deutsche und europäische Literatur- und Kulturgeschichte gelehrt.
Macht kann aktiv oder passiv wirken
Es gibt die sehr eingängige Vorstellung, dass soziale Macht eine Fähigkeit ist, die Menschen als soziale Akteure haben, um den Verlauf der Dinge in der Gesellschaft zu beeinflussen. Miranda Fricker hält zunächst einmal fest, dass Macht aktiv oder passiv wirken kann: „Zwischen aktiver und passiver Macht besteht ein Abhängigkeitsverhältnis. Denn die passive Macht schwindet im gleichen Maße, in dem die aktive Macht schwindet.“ Ein zweiter Punkt ist folgender: Macht ist eine Fähigkeit, die auch in jenen Zeiten Bestand hat, in denen sie nicht ausgeübt wird. Michel Foucault behauptet bekanntlich: „Macht existiert nur in actu.“ Miranda Fricker ist Professorin für Philosophie an der New York University, Co-Direktorin des New York Institute für Philosophy und Honorarprofessorin an der University of Sheffield.
Pluralität ist das zentrale Thema von Hannah Arendt
Es gibt ein Motiv, dass sich wie ein roter Faden durch alle Publikationen von Hannah Arendt zieht. Es handelt sich dabei um die Pluralität. Juliane Rebentisch erklärt: „Die Überzeugung, dass die Entfaltung menschlicher Würde auf Pluralität angewiesen ist, bestimmt ihren Begriff der Öffentlichkeit und ihre Unterscheidung von Macht und Herrschaft.“ Sie motiviert Hannah Arendts Kritik der modernen Arbeitsgesellschaft ebenso wie ihre Aversion gegen die Gleichsetzung von Souveränität und Freiheit sowie den Sog der Brüderlichkeit. Sie ist in ihrer frühen Kritik der Assimilation ebenso präsent wie im Spätwerk über das Denken und Urteilen. Kurz: Hannah Arendts Texte kann man in wesentlichen Zügen als Beiträge zu einer „Apologie der Pluralität“ lesen. Juliane Rebentisch ist Professorin für Philosophie und Ästhetik an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach am Main.
Die Politik braucht die Bereitschaft des Kampfes
Den Menschen ist die Unterscheidung von Freund und Feind nicht fremd. Die Moral unterscheidet zwischen gut und böse, die Ästhetik zwischen schön und hässlich, die Ökonomie zwischen nützlich und schädlich. Der Mensch braucht bei der freiheitlichen Begegnung einen Maßstab, um die Mitmenschen in Gruppen von Nahe- und Fernstehenden zu unterscheiden. Paul Kirchhof weiß: „Für Carl Schmitt ist dieses die Unterscheidung zwischen Freund und Feind.“ Sie ist seiner Meinung nach notwendig, um politische Handlungen und Motive zu erklären und zu verstehen. Ist der Andere existenziell etwas Anderes und Fremdes, sind Konflikte mit ihm möglich. Bedroht das Anderssein des Fremden die eigene Existenz, muss man den anderen abwehren und bekämpfen. Dr. jur. Paul Kirchhof ist Seniorprofessor distinctus für Staats- und Steuerrecht an der Universität Heidelberg.
Normverstöße gehören zum Leben
Das Ziel der Ethik ist nicht die größtmögliche Lebenssicherheit. Richard David Precht stellt fest: „Es ist die Chance auf ein erfülltes Leben für möglichst viele Menschen. Normen sollen uns dazu dienen. Keinesfalls ist es ihr Sinn, dass wir ihnen dienen.“ Und wenn man sich über Normverstöße aufregt, so ist es doch gut, dass es sie gibt. Wer wollte in einem Land leben, in dem jeder Verstoß bemerkt und geahndet wird? Jeder moralische Grundsatz wird zu einem Gräuel, wenn er uneingeschränkt zur starren Regel erhoben wird. Immer ehrlich sein, immer gerecht, immer fair, immer mitfühlend, immer großzügig, immer dankbar und so weiter. Wer möchte so sein? Ist dies tatsächlich ein erfülltes Leben? Der Philosoph, Publizist und Autor Richard David Precht zählt zu den profiliertesten Intellektuellen im deutschsprachigen Raum.
Wahrheit ist der Wille der Überwältigung
Für Friedrich Nietzsche bedeutet der Wille zur Wahrheit: „Ich will nicht täuschen, auch mich selbst nicht.“ Und hiermit befindet er sich auf dem Boden der Moral. Im Nachlass vom Herbst 1887 findet sich sogar noch eine Steigerungsform. Wahrheit sei ein Name „für den Willen der Überwältigung. Wahrheit hineinlegen, als ein aktives Bestimmen, nicht als Bewusstsein von etwas, das an sich fest und bestimmt wäre. Es ist ein Wort für den Willen zur Macht.“ Christian Niemeyer weist darauf hin, dass man gegen diese Pointe das Bedenken vortragen könnte, Friedrich Nietzsche moralisiere hiermit das Wahrheitsproblem. Und er verfehle die in seinem Grundansatz an sich die sehr viel zwingendere Psychologisierung des Moralbegriffs. Der Erziehungswissenschaftler und Psychologe Prof. Dr. phil. habil. Christian Niemeyer lehrte bis 2017 Sozialpädagogik an der TU Dresden.
Epistemische Ungerechtigkeit ist erkenntnistheoretischer Natur
Miranda Fricker befasst sich in ihrem Buch „Epistemische Ungerechtigkeit“ mit der Idee, dass es eine besondere Art von Ungerechtigkeit gibt, die besonders Erkennende und Wissende betrifft. In ihrem Werk arbeitet die Autorin zwei Formen von epistemischer Ungerechtigkeit heraus, die eindeutig erkenntnistheoretischer Natur sind. Und sie zeigt dabei, dass sie grundsätzlich in einem Unrecht bestehen, das jemandem speziell in seiner Eigenschaft als Wissendem zugefügt wird. Miranda Fricker nennt sie Zeugnisungerechtigkeit und hermeneutische Ungerechtigkeit und erklärt: „Zeugnisungerechtigkeit tritt auf, wenn eine Hörerin aufgrund von Vorurteilen den Äußerungen einer Sprecherin eine geringere Glaubwürdigkeit zubilligt. Hermeneutische Ungerechtigkeit tritt in einem früheren Stadium auf, nämlich dann, wenn eine Lücke in den kollektiven Interpretationsressourcen jemanden in seinem Bemühen, die eigenen sozialen Erfahrungen sinnvoll zu deuten, auf unfaire Weise benachteiligt.“ Miranda Fricker ist Professorin für Philosophie an der New York University, Co-Direktorin des New York Institute für Philosophy und Honorarprofessorin an der University of Sheffield.
Mit dem Neinsagen fängt das Denken an
Das Titelthema des neuen Philosophie Magazins 04/2023 erforscht diesmal die Kraft des Neinsagens. Denn das Nein ist für Chefredakteurin Svenja Flaßpöhler der Ursprung jedes Aufbegehrens, individuell und auch politisch: „Ja, eine solche Kraft hat das Nein, dass es oft sogar den überrascht, der es äußert.“ Dabei herrscht das vage Gefühl, dass hier etwas nicht stimmt und so bereitet das Nein den Weg für einen Neuanfang. Wer mutig nein sagt, widersetzt sich äußeren Ansprüchen, um nach seinen eigenen Vorstellungen zu leben. Doch ist die Verweigerung immer auch in Gefahr, in Narzissmus, Resignation, gar Depressionen abzugleiten. Dennoch gilt: Das Nein hat das Ja, so scheint es, in vielen Bereichen als Grundhaltung abgelöst. Für Denker wie Theodor W. Adorno oder Donatella Di Cesare fängt mit dem Neinsagen das Denken überhaupt erst an.
Autonomie beruht auf Grundfreiheiten
Der Schutz politischer Freiheit verlangt nicht bloß die Gewährung des Rechts zu wählen, ein Amt zu bekleiden oder als Geschworener zu fungieren. Dazu gehören auch Vereinigungsfreiheit und freie Meinungsäußerung, die politische Partizipation erst möglich machen. Danielle Allen erklärt: „Letztere Rechte bilden natürlich auch eine wertvolle Grundlage für die Äußerungen von privater und nicht bloß von öffentlicher Autonomie.“ Die Dynamik des Sozialen und Ökonomischen darf dabei die gleichen Grundfreiheiten, einschließlich der politischen Freiheiten, nicht untergraben. In Bezug auf diesen Punkt setzt sich Danielle Allen ganz entschieden von John Rawls ab. Dieser behauptet immerhin, dass die Grundfreiheiten, auf denen private Autonomie beruht, niemals dem materiellen Wohlstand geopfert werden dürfe. Die Politikwissenschaftlerin und Altphilologin Danielle Allen lehrt als Professorin an der Harvard University. Zugleich ist sie Direktorin des Edmond J. Safra Center for Ethics in Harvard.
Bei der Selbstverteidigung gibt es das Problem der Ungleichheit
Viele der Linken behaupten zwar, an Gewaltlosigkeit zu glauben. Dennoch nehmen sie für die Selbstverteidigung eine Ausnahme in Anspruch. Manche Menschen meinen, dass das eine Selbst verteidigungswürdig ist, das andere aber nicht. Damit stellt sich für Judith Butler das Problem der Ungleichheit, dass sich aus der Rechtfertigung von Gewalt im Dienst der Selbstverteidigung ergibt. Leben zählen in dem Sinn, dass sie in der Sphäre der Erscheinung physisch Gestalt annehmen. Sie zählen auch deswegen, weil sie alle gleich geschätzt werden müssen. Und doch ist die Berufung auf Selbstverteidigung vonseiten derjenigen, die Macht ausüben, allzu oft nichts anderes als die Verteidigung dieser Macht. Gleichzeitig beanspruchen sie damit ihre Vorrechte und die von ihnen vorausgesetzten und geschaffenen Ungleichheiten. Judith Butler ist Maxine Elliot Professor für Komparatistik und kritische Theorie an der University of California, Berkeley.
Freiheit bewahrt den Staat vor Überforderung
Der freiheitliche Staat überlässt den Menschen die Gestaltung ihres Lebens. Insoweit darf der Staat nicht handeln, ist aber auch von Aufgaben entlastet. Paul Kirchhof ergänzt: „Freiheit bewahrt den Staat vor Überforderung, enthält ein Konzept sachgerechter Aufgabenteilung zwischen Gesellschaft und Staat. Der Staat nimmt sich um der Freiheit willen in seinen Machtbefugnissen zurück.“ Er ist ohne Macht, ohnmächtig, wo Freiheit wirkt. Immer mehr Menschen suchen jedoch statt der selbstbestimmten und selbstverantwortlichen Freiheit eine sicherheitsbedachte, den Staat beanspruchende Freiheit. Daher organisiert, regelt und finanziert der Staat die Voraussetzungen individueller Freiheitswahrnehmung. Er formt die Freiheitsfähigkeit durch Ausbildung, Bildung und Kulturangebote und setzt damit den Rahmen der Freiheit. Dr. jur. Paul Kirchhof ist Seniorprofessor distinctus für Staats- und Steuerrecht an der Universität Heidelberg.
Ray Dalio erforscht die neue Ordnung der Welt
Die Weltordnung verändert sich derzeit rasant. Und zwar in so verschiedener maßgeblicher Hinsicht, wie es in der jüngsten Vergangenheit noch nie der Fall war, aber schon viele Male davor. Die Fallbeispiele und Mechanismen, die ihnen zugrunde liegen, hat Ray Dalio erforscht. Denn nur so kann er sich eine Vorstellung von der Zukunft bilden. Zuerst beschreibt er aber die Kräfte, die ihm über die letzten 500 Jahre aufgefallen sind bei der Analyse des Aufstiegs und Niedergangs der letzten drei Reservewährungsreiche. Zu ihnen zählt er das niederländische, das britische und das amerikanische Reich. Daneben existieren sechs weitere maßgebliche Reiche wie Deutschland, Frankreich, Russland, Indien, Japan und China. Zudem betrachtet er die großen chinesischen Dynastien bis hin zur Tang-Dynastie etwa um das Jahr 600. Ray Dalio ist Gründer von Bridgewater Associates, dem weltgrößten Hedgefonds. Er gehört mit zu den einflussreichsten Menschen der Welt.
Marktmacht manifestiert sich im Umgang mit Kunden
Marktmacht manifestiert sich noch in anderer Weise als nur in höheren Preisen und Gewinnen. Zum Beispiel darin, wie Unternehmen ihre Kunden behandeln. Joseph Stiglitz kritisiert: „So zwingen zum Beispiel viele ihre Kunden dazu, im Fall von Streitigkeiten nicht auf das öffentliche Rechtssystem zurückzugreifen.“ Das sollte eigentlich das gute Recht jedes Bürgers in einer demokratischen Gesellschaft sein. Stattdessen schalten die Firmen geheimniskrämerischen Schiedsgerichte ein, die zugunsten der Unternehmen voreingenommen sind. Die meisten Menschen haben schon einmal unabsichtlich durch ihre Unterschrift auf ihre Rechte verzichtet. Beispielsweise wenn sie ein Bankkonto eröffnet, einen Internetanschluss beantragt oder einen Telefonanbieter ausgewählt haben, da diese ihren Kunden praktisch ähnliche Bestimmungen auferlegen. Joseph Stiglitz war Professor für Volkswirtschaft in Yale, Princeton, Oxford und Stanford. Er wurde 2001 mit dem Nobelpreis für Wirtschaft ausgezeichnet.
Der „Übermensch“ riskiert seinen eigenen Untergang
Die Welt existiert nur in Form von Interpretationen, die immer unter einem bestimmten Blickwinkel vorgenommen werden. Diese Ansicht bezeichnet man Friedrich Nietzsches „Perspektivismus“. Dieser Perspektivismus hat eine Ähnlichkeit mit einer erkenntnistheoretischen Strömung, die in etwa zur gleichen Zeit in Amerika Denker wie Charles Sanders Peirce und William James entwickeln. Dabei handelt es sich um den Pragmatismus, nach dem die Wahrheit das ist, was funktioniert. Doch für Friedrich Nietzsche ist das alles zu kleinkrämerisch. Seine Philosophie ist auf viel mehr aus als Selbsterhaltung. Ger Groot erklärt: „Wie Zarathustra wird der „Übermensch“ – der die Frucht dieses Abschieds von der Wahrheit ist – dazu bereit sein, für dieses „mehr“ möglicherweise sogar seinen eigenen Untergang zu riskieren.“ Ger Groot lehrt Kulturphilosophie und philosophische Anthropologie an der Erasmus-Universität Rotterdam. Zudem ist er Professor für Philosophie und Literatur an der Radboud Universität Nijmegen.
Autoritäre brauchen fremde Feinde
Auch in Europa brauchen Autoritäre fremde Feinde, um ihren Autoritarismus zu rechtfertigen. Immer aus dem Ausland – in Gestalt von „Eurokraten“ und Migranten – brechen die Katastrophen herein. Roger de Weck ergänzt: „Um sie abzuwenden, ist eine Politik der harten Hand das Allheilmittel. Überrollen uns „islamische Invasoren“, drängt sich eine geistig-moralische Wende auf.“ Was in friedlichen Zeiten verboten war, gebietet nunmehr der Existenzkampf. Es ist nun an der Zeit, sich moralischen Bedenken zu entledigen. Das christliche Abendland braucht unbarmherzige Retter. Für den nüchternen Hanseaten Helmut Schmidt war Politik „pragmatisches Handeln zu sittlichen Zwecken“. Für die Neue Rechte ist Politik die Freiheit der Macht. Helmut Schmidt verwarf gleichermaßen eine Moral ohne Politik und eine Politik ohne Moral. Roger de Weck ist ein Schweizer Publizist und Ökonom.
Meistens funktioniert der Wettbewerb nicht richtig
Verfechter der freien Marktwirtschaft argumentieren oft, die Aufteilung des nationalen Einkommenskuchens hänge vom Wirken unpersönlicher Marktkräfte ab. Das ist für Joseph Stiglitz vergleichbar mit den physikalischen Kräften, die das Körpergewicht eines Menschen festlegen. Niemand möchte das Gravitationsgesetz widerrufen. Manchmal zeigt die Waage an, dass man zu viele Pfunde drauf hat. Dafür kann man nicht die Schwerkraft verantwortlich machen, sondern muss sich um seine Essgewohnheiten kümmern. Joseph Stiglitz stellt fest: „Aber die wirtschaftswissenschaftlichen Gesetze unterscheiden sich von den Gesetzen der Physik. Märkte gestaltet man durch die staatliche Rechtsordnung, und auf den meisten funktioniert der Wettbewerb nicht richtig. Die Rechtsordnung legt insbesondere fest, wer wie viel Marktstärke besitzt.“ Joseph Stiglitz war Professor für Volkswirtschaft in Yale, Princeton, Oxford und Stanford. Er wurde 2001 mit dem Nobelpreis für Wirtschaft ausgezeichnet.
Die Welt rückt enger zusammen
In den freiheitlichen Demokratien konnten die Menschen in der Corona-Krise den Eindruck gewinnen, zu viele widerstreitende Instanzen mit zu unterschiedlichen Interessen behindern einander gegenseitig. Hans-Jürgen Papier stellt fest: „Lange Zeit schien das Vorgehen der europäischen Staaten unkoordiniert und schlecht abgestimmt. Auch das bundesrepublikanische föderale System erweckte häufig den Eindruck, als sei es hauptsächlich damit beschäftigt, einen Flickenteppich aus unübersichtlichen Regelungen und jede Menge Streit und Unsicherheiten zu produzieren.“ Wie die Pandemie haben auch Klimawandel, Digitalisierung oder internationaler Terrorismus mit Prozessen zu tun, die man häufig unter dem Stichwort der Globalisierung zusammenfasst. Die Welt rückt in vieler Hinsicht enger zusammen. Die Dinge werden komplizierter, und Einflusssphären überlagern sich. Prof. em. Dr. Dres. h.c. Hans-Jürgen Papier war von 2002 bis 2014 Präsident des Bundesverfassungsgerichts.