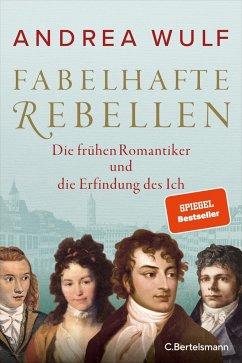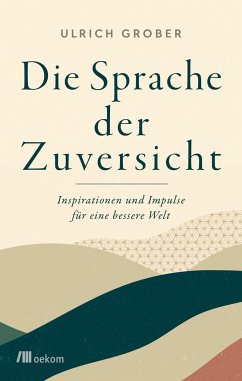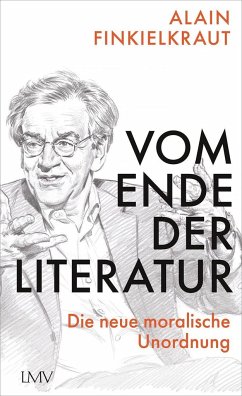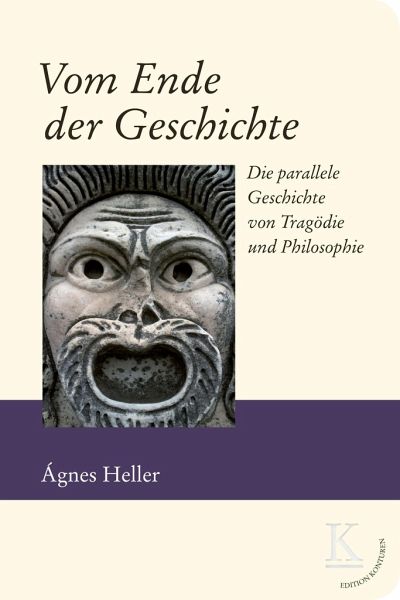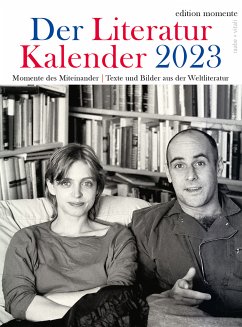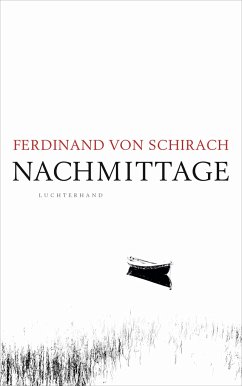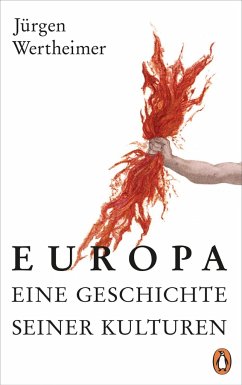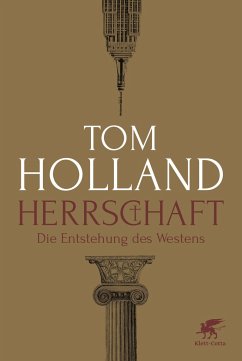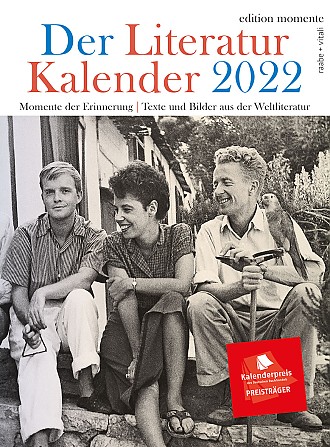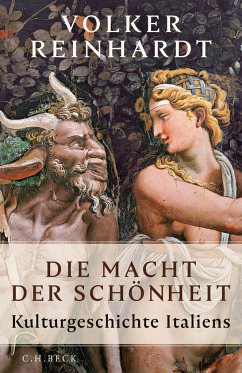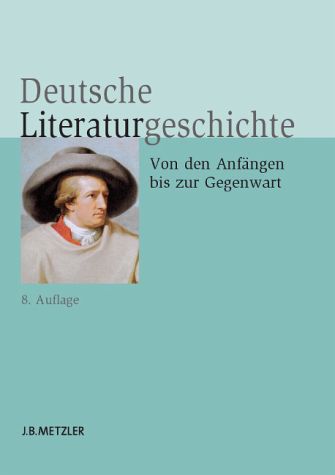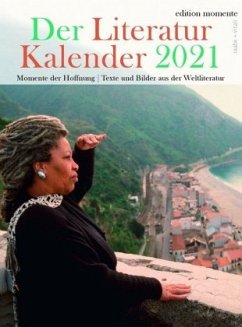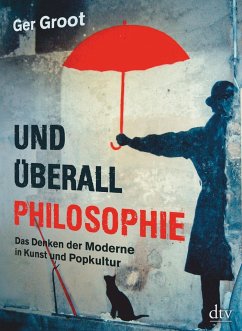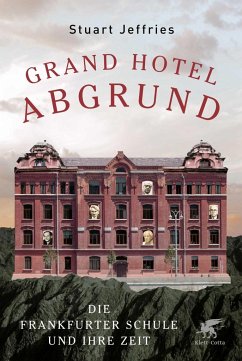Das Buch „Die Leiden des jungen Werthers“ waren Johann Wolfgang von Goethes bedeutendster Beitrag zum sogenannten Sturm und Drang. Dabei handelt es sich um eine literarische Bewegung, die sich gegen den Rationalismus der Aufklärung wandte. Die Schriftsteller des Sturm und Drang zelebrierten Emotionen in all ihren Extremen. Sie schrieben von leidenschaftlicher Liebe bis zur düsteren Melancholie, von selbstmörderischer Sehnsucht bis zu rasender Freude. Und Johann Wolfgang von Goethe wurde damit zum literarischen Superstar. Andrea Wulf weiß: „Der achtzehn Jahre alte Herzog Carl August war von dem Roman so angetan, dass er Goethe 1775 einlud, bei ihm im Herzogtum Sachsen-Weimar zu leben und zu arbeiten.“ Als Autorin zeichnete man Andrea Wulf mit einer Vielzahl von Preisen aus, vor allem für ihren Weltbestseller „Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur“ 2016, der in 27 Sprachen übersetzt wurde.
Literatur
Uralt ist das Streben nach Glück
Das Leben ist gut – wie es auch sei. Es gibt bei vielen Menschen die Sehnsucht, seinem Leben und Erleben Glanz zu verleihen. Dazu gesellt sich die Entschlossenheit, das Schöne, das Wunder, den Zauber ins eigene Leben hereinzuholen. Diese Wünsche haben ihre Dynamik in der der prekären Gegenwart keineswegs verloren. Ulrich Grober betont: „Und das ist gut so. Dieser Wille gehört untrennbar zum Streben nach Glück, ist uralt und ewig jung. Er sucht sich immer neue Kanäle und Ausdrucksformen.“ Doch wie die sozialen Medien, ja das Netz insgesamt, ist gerade das Wortfeld WOW heillos verstrickt in die Sprache der Werbung und die Welt der Warenästhetik. Es wird seines Zaubers beraubt von endlosen Plakaten zu Lippenstiften und Anzeigen zum nächsten Wochenendtrip. Den Publizisten und Buchautor Ulrich Grober beschäftigt die Verknüpfung von kulturellem Erbe und Zukunftsvisionen.
Schiller und Goethe waren gefeierte Schriftsteller
Im Jahr 1789 nahm Friedrich Schiller eine schlecht bezahlte Stelle an der Universität in Jena an. Andrea Wulf weiß: „Dort hielt er Vorlesungen über Geschichte und Ästhetik, und auch wenn das Geld knapp war, hatte er doch endlich die Freiheit zu schreiben.“ Johann Wolfgang von Goethe aber hielt sich von ihm fern. Beide waren gefeierte Schriftsteller, und beide wussten voneinander. Da Goethe im nur zwanzig Kilometer entfernten Weimar lebte, scheint es seltsam, dass sie nie wirklich miteinander sprachen. Es war Johann Wolfgang von Goethe, der den Kontakt gemieden hatte, wie er später zugab. Als Autorin wurde Andrea Wulf mit einer Vielzahl von Preisen ausgezeichnet, vor allem für ihren Weltbestseller „Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur“ 2016, der in 27 Sprachen übersetzt wurde.
Friedrich Schiller ist mit dem Stück „Die Räuber“ bekannt geworden
In den frühen 1780er Jahren war Friedrich Schiller mit „Die Räuber“ bekannt geworden. Dabei handelt es sich um ein Stück über zwei adlige Brüder, die sich nicht entscheiden konnten, ob sie nach Macht oder nach Freiheit streben sollten. Andrea Wulf blickt zurück: „Schiller wurde 1789 im Herzogtum Württemberg geborgen, wo sein Leben vom despotischen Herzog Karl Eugen überschattet wurde – eines Landesherrn, der sein Geld vor allem für Paläste, Feste und Kunst ausgab.“ Nach dem Vorbild des französischen Königs in Versailles war der Hof des Herzogs opulent, förmlich und absolut. Als Autorin wurde Andrea Wulf mit einer Vielzahl von Preisen ausgezeichnet, vor allem für ihren Weltbestseller „Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur“ 2016, der in 27 Sprachen übersetzt wurde.
In den Romanen von Philip Roth spielt die Komik immer eine Rolle
In den Romanen von Philip Roth nehmen der innere Aufruhr und die Sexualität einen wichtigen Platz ein. Doch wenn Roth von Sex spricht, spielt die Komik immer eine Rolle. Alain Finkielkraut nennt ein Beispiel: „Das trifft besonders auf „Portnoys Beschwerden“ zu. Die Hervorhebung des komischen Elements dieser entscheidenden Erfahrung hat Roth mit Milan Kundera, dem Autor von „Das Buch der lächerlichen Liebe“, gemeinsam.“ Diesem hat Philip Roth übrigens seinen Roman „Der Ghostwriter“ gewidmet. Der Vorwurf der Frauenfeindlichkeit bekundet die Dummheit der literaturfernen Gegenwart. In „Mein Leben als Mann“ hat Roth eine Frau als Monster geschildert. Die scharfsinnigen Kritiker haben daraus geschlossen, dass für ihn alle Frauen Monster seien, obwohl sein Werk reich ist an wundervollen, feinfühligen oder herzzerreißenden Frauengestalten. Alain Finkielkraut gilt als einer der einflussreichsten französischen Intellektuellen.
Tod und Sex sind die Themen von Philip Roth
„Hier, wo der Mensch palavert und wehklagt, Der graue Schopf, erbärmlich dünn, sich neigt, Wo Jugend bleich und geisterhaft verdirbt, Wo denken heißt: sich sorgen.“ Diese großartigen Verse von John Keats sind als Motto Philip Roths Roman „Jedermann“ vorangestellt. Alain Finkielkraut weiß: „Es ist der Roman eines Sterblichen, unser aller Geschichte, und seinen Vornamen werden wir deswegen im ganzen Roman nicht erfahren. In Philip Roths Werk ist die ständige Auseinandersetzung mit dem Altern und dem Tod mindestens ebenso präsent wie der Sex.“ Der Tod ist unausweichlich, absurd, universell, so schrecklich wie banal, und inzwischen auch ohne Aussicht auf ein schöneres Jenseits. „Der Tod ist von Gott und hat seinen Vater gefressen“, sagt Elias Canetti. Alain Finkielkraut gilt als einer der einflussreichsten französischen Intellektuellen.
Mythen prägten die griechische Tragödie
In der griechischen Tragödie spielte die Handlung in der mythologischen Vergangenheit, da man genau diese Vergangenheit am Ende überwand. Ágnes Heller ergänzt: „Bei Shakespeare spielte sich die Handlung hauptsächlich in der historischen Vergangenheit ab. Und nicht nur die aus der englischen Geschichte, sondern auch Hamlet, Macbeth oder König Lear – denn man kann die Geschichte nur hinter sich lassen, wenn man in ihr aufgeht. Die klassische französische Tragödie folgte beiden Vermächtnissen, ähnlich wie die Barockoper. Im griechischen Drama spielte der Chor immer eine entscheidende Rolle, nicht nur in Tragödien, sondern auch in Komödien des Aristophanes. Ab 1977 lehrte Ágnes Heller als Professorin für Soziologie in Melbourne. 1986 wurde sie Nachfolgerin von Hannah Arendt auf deren Lehrstuhl für Philosophie an der New School for Social Research in New York.
William Shakespeare schrieb Tragödien und Komödien
Ágnes Heller weiß: „In der Neuzeit war die strikte Trennung zwischen tragischem Dichter und komischem Dichter bereits überholt.“ Sokrates schlug vor, dass derselbe Dichter Tragödie und Komödie schreiben sollte. Dabei bezog er sich offensichtlich auf seine eigenen philosophischen Dialoge, die sowohl tragisch als auch komisch waren. Doch der erste Dichter, der sowohl Tragödien als auch Komödien und darüber auch „Romanzen“ schrieb, war William Shakespeare. Und er tat noch etwas Unerhörtes: Es gab komische Szenen in seinen Tragödien als auch tragische Szenen in seinen Komödien. Ágnes Heller, Jahrgang 1929, war Schülerin von Georg Lukács. Ab 1977 lehrte sie als Professorin für Soziologie in Melbourne. 1986 wurde sie Nachfolgerin von Hannah Arendt auf deren Lehrstuhl für Philosophie an der New School for Social Research in New York. Ágnes Heller starb am 19. Juli 2019 in Ungarn.
Johann Wolfgang von Goethe ritt von Weimar nach Jena
Am 20. Juli 1794 ritt Johann Wolfgang von Goethe von seinem Haus im Zentrum Weimars nach Jena, wo er an einer Sitzung der neu gegründeten Naturforschenden Gesellschaft teilnehmen wollte. Andrea Wulf blickt zurück: „Auf dem gut zwanzig Kilometer langen Weg von Weimar nach Jena kam Goethe an Bauern vorbei, die auf goldenen Feldern Weizen ernteten.“ Zwei Stunden ritt er durch flaches Ackerland, dann änderte sich die Landschaft allmählich. Kleiner Dörfer und Weiler schmiegten sich in sanfte Senken, dann wurde der Wald dichter und die Felder verschwanden. Die Gegend prägten nun Hügel. Als Autorin wurde Andrea Wulf mit einer Vielzahl von Preisen ausgezeichnet, vor allem für ihren Weltbestseller „Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur“ 2016, der in 27 Sprachen übersetzt wurde.
Der Literatur Kalender 2023 preist das Miteinander
Der Literatur Kalender 2023 hat diesmal Texte und Bilder aus der Weltliteratur über Momente des Miteinanders zusammengetragen. Von solchen beflügelnden oder inspirierenden, deprimierenden oder verzweifelnden Augenblicken erzählen 53 Schreibende. Die algerische Schriftstellerin Assia Djebar feiert in ihrem ersten preisgekrönten, autobiografisch geprägten Roman „La Soif“ das Leben: „Hin und wieder hatte ich in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen mit Freunden die Kinos und Kasinos von Algier besucht, hatte mit ihnen an regnerischen Sonntage Überraschungspartys gefeiert und an Autorennen teilgenommen, bei denen die Wagen im Wind so nervös zuckten wie junge Pferde.“ Ganz nah am Leben dran ist auch der Dichter F. C. Delius in seinem Gedicht „Fähre Schenkenschanz“. „Das Wasser tot und ich führt mich nicht / Ich mag es nicht zu sagen das Wort Glück / Du zeigst dem Kind die nahen Weiden und das Licht / Komm näher her ich halt dich diesen Augenblick.“
Literatur muss den Leser berühren
Ferdinand von Schirach hat Jura studiert, weil er glaubte, ein bürgerliches Leben könnte ihm Halt geben. Er hat immer gewartet, ohne zu wissen, worauf. Erst als er wieder schreiben konnte, verstand er, dass es genau das war: das Schreiben. Das ist die ganze Geschichte. Das Schreiben ist seiner Meinung nach nicht aufregend oder romantisch: „Ich sitze vor dem Laptop, rauche, trinke Kaffee und schreibe. Drei Stunden am Vormittag. Man sollte sich vorher duschen, rasieren und ordentlich anziehen, sonst schreibt man Bademantelliteratur.“ Für Ferdinand von Schirach ist es schwieriger über sich selbst als über Erfundenes zu schreiben. Die Wahrheit kann ohnehin niemand erzählen. Ferdinand von Schirach verteidigte etwa 700 Mandanten vor Gericht, bevor er zu einem der international erfolgreichsten Romanautoren und Dramatiker Deutschland avancierte.
Die griechische Tragödie befreit von Zwängen
Die griechische Tragödie ist der öffentlich vorgetragene Versuch, sich aus den Zwängen archaischer Rituale zu befreien. Außerdem will man Rachemechanismen und Schicksalsobsessionen, an deren Fäden die Menschen hängen zu scheinen, abschütteln. Jürgen Wertheimer erläutert: „Denn alle, die wir in ihr Unglück stürzen sehen, müssen so handeln, wie sie handeln.“ Klytämnestra muss ihren Mann, der als Sieger von Troja zurückkehrt, töten. Damit will sie den Berg an Schuld und Lügen, die sich zwischen beiden angehäuft hat, abtragen. Orest muss Klytämnestra, seine Mutter, töten, um dem Gesetz seiner Götter und der Ehre zu genügen. Kassandra muss ihre Warnungen herausschreien. Wohl wissend, dass ihr auch jetzt, wie einst vor Troja, niemand glauben wird. Jürgen Wertheimer ist seit 1991 Professor für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft und Komparatistik in Tübingen.
Homer umgab eine Aura von Göttlichkeit
Das Schicksal Trojas hörte nie auf, die Griechen zu beschäftigen. Sogar Xerxes hatte bei seiner Ankunft am Hellespont verlangt, dass man ihm den Ort zeige. In der „Ilias“ war die Erinnerung an jene aufgehoben war, die im Staub der Ebene vor Troja gekämpft hatten. Zudem gab sie den Griechen auch ihr wichtiges Fenster auf das Wirken der Götter und ihr Verhältnis zu den Sterblichen. Tom Holland fügt hinzu: „Der Verfasser der „Ilias“, ein Mann, dessen Geburtsort und dessen Lebensdaten Gegenstand endloser Diskussionen waren, was selbst eine Gestalt mit einer gewissen Aura von Göttlichkeit.“ Einige gingen so weit zu sagen, Homers Vater sei ein Fluss und seine Mutter eine Meeresnymphe gewesen. Der Autor und Journalist Tom Holland studierte in Cambridge und Oxford Geschichte und Literaturwissenschaft.
Die Tragödie ist die Nachahmung der Natur
Die Tragödie ist nach Aristoteles eine Untergattung innerhalb der allgemeinen Gattung der Kunst. Sie ist Mimesis, also eine Art Imitation, und zwar in seinen Augen die Nachahmung der Natur. Ágnes Heller stellt fest: „Der Begriff umfasst nicht nur Poesie oder Drama oder Malerei, sondern auch Werkzeuge für den praktischen Gebrauch. Aristoteles betont das Offensichtliche: Von der frühen Kindheit an ahmen wir immer nach. Wir können nicht aufwachsen, ohne zu imitieren.“ Ágnes Heller, Jahrgang 1929, war Schülerin von Georg Lukács. Ab 1977 lehrte sie als Professorin für Soziologie in Melbourne. 1986 wurde sie Nachfolgerin von Hannah Arendt auf deren Lehrstuhl für Philosophie an der New School for Social Research in New York. Ágnes Heller starb am 19. Juli 2019 in Ungarn.
Der Literaturkalender 2022 weckt Erinnerungen
Diesmal dreht sich im „Literatur Kalender 2022“ alles um Momente der Erinnerung, die manchmal Haltepunkte im Leben sind. Dabei kann es sich um eine Reise, eine vergangene Liebe, ein wichtiges Gespräch oder einen Sonnenuntergang am Meer handeln. Einen Moment lang befindet sich der Erinnernde an einem anderen Ort, sei es das Haus der Kindheit, versunken in eine Melodie oder in ein Buch. Erinnerungen sind manchmal glücklich, können jedoch auch tief traurig sein. Wie zum Beispiel diese Zeilen aus dem Gedicht „Du hast Spanien gehasst“ von Ted Hughes, des Mannes von Sylvia Plath. Er veröffentlichte es in seinen „Birthday Letters“ 35 Jahre nach ihrem Suizid und kurz vor seinem eigenen Tod: „ …Ich sehe dich im Mondlicht, Den leeren Kai von Alicante entlanggehen, Wie eine Seele, die auf die Fähre wartet, Eine neue Seele, die noch immer nicht versteht, Die denkt, es sei noch immer deine Hochzeitsreise In der glücklichen Welt, dein ganzes Leben noch vor dir, Glücklich, und alle deine Gedichte warteten noch auf dich.“
Dante hatte 19 Jahre in der Verbannung verbracht
Dante wurde zwar 1265 in Florenz geboren, doch starb er 1321 in Ravenna, wo er auch begraben lag. Und die dortigen Machthaber weigerten sich seit fast anderthalb Jahrhunderten standhaft, die kostbaren Überreste an den Arno überführen zu lassen. Volker Reinhardt ergänzt: „Selbst politische Zugeständnisse und verlockende Geldgeschenke vermochten sie nicht zu erweichen.“ Dante hatte die letzten neunzehn Jahre in der Verbannung verbracht. Nach seinen Worten als „exul immeritus“, als zu Unrecht Vertriebener. Dafür hatte er sich an seiner Heimat mit den Waffen, die er wie kein anderer beherrschte, gerächt. Mit anklagenden Versen, die Florenz zum Hort des Bösen dämonisierten. Das Gegenteil davon ist im Dom zu sehen und zu lesen. Volker Reinhardt ist Professor für Geschichte der Neuzeit an der Universität Fribourg. Er gehört international zu den führenden Italien-Historikern.
Adalbert Stifter will nicht Tugend oder Sitte predigen
In einer Vorrede zu den sechs Erzählungen, denen er nach mehrfacher Umarbeitung schließlich den programmatisch gemeinten Obertitel „Bunte Steine“ gab, erläutert Adalbert Stifter (1805 – 1869) seine literarischen Absichten und einige Grundsätze seiner Weltanschauung auf wenigen Seiten. Diese sind in Aufbau und einfacher, aber einprägsamer Gedankenführung kaum zu überbieten. Ausgehend von einer dreifachen Verneinung. Er sei kein Künstler (Dichter). Er wolle nicht Tugend oder Sitte predigen und er habe weder „Großes“ noch „Kleines“ als Ziel. Damit will Adalbert Stifter sich und seine Freunde abgrenzen gegen die alles zersetzende Außenwelt. Denn, so sagt er, er wolle nur „Geselligkeit unter Freunden“ und ein Körnchen Gutes zum Bau der Welt beitragen – und natürlich wolle er auch vor falschen Propheten schützen. Erst nach dieser fast familiären Erklärung greift Adalbert Stifter weiter aus und erläutert, was er mit dem Großen und dem Kleinen meint.
So unterscheiden sich Tragödie und Philosophie
Was in einer Tragödie geschieht, entfaltet sich in der Handlung. Dagegen entfaltet sich in Argumenten und Beweisführungen, was in der Philosophie geschieht. Ágnes Heller fügt hinzu: „Beide – Geschichten und Argumente – führen zu einem Ergebnis, zum Ausgang, beide sind teleologisch konstruiert.“ Aristoteles setzte voraus, dass fast alle guten Tragödiendichter das Endergebnis ihrer Geschichte kennen, bevor sie zu schreiben beginnen. Er missbilligte Tragödienreihen. Wo etwas endet, da sollte es auch enden, es gibt nichts anderes mehr zu beginnen. Ágnes Heller, Jahrgang 1929, war Schülerin von Georg Lukács. Ab 1977 lehrte sie als Professorin für Soziologie in Melbourne. 1986 wurde sie Nachfolgerin von Hannah Arendt auf deren Lehrstuhl für Philosophie an der New School for Social Research in New York. Ágnes Heller starb am 19. Juli 2019 in Ungarn.
Medea wird zur Mörderin
Das bekannteste Stück von Euripides ist „Medea“. Eine Magierin aus Kolchis, vom Rande der zivilisierten Welt, betritt den sauberen Boden der Polis. Jürgen Wertheimer fügt hinzu: „Eine Barbarin an der Seite eines griechischen Helden, des Argonauten Jason, Eroberer des Goldenen Vlieses, zieht in Korinth ein.“ Sehr früh treten Frauen als Helferinnen und Organisatorinnen im Hintergrund in Erscheinung. Bereits Theseus hatte den Minotaurus unter tatkräftiger Mitwirkung Ariadnes zur Strecke gebracht. Medeas aktive Rolle geht jedoch sehr viel weiter. Um ihrer Liebe willen hatte sich ihm nicht nur bei Diebstahl der begehrten Trophäe geholfen, sondern sogar den Tod des eigenen Bruders in Kauf gekommen. In Korinth unternahm Medea zaghafte Integrationsversuche, die jedoch ins Leere liefen. Jürgen Wertheimer ist seit 1991 Professor für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft und Komparatistik in Tübingen.
Antigone kämpft gegen ein korruptes Staatssystem
Das wagemutige Theater der griechischen Polis liebte und riskierte es, den Blick in die Abgründe und Gefährdungen des eigenen, fragilen Systems zu werfen. Wie auch Sophokles (497/6 – 406/5 v.u.Z.) dies getan hat. Selbst und gerade in seinem zu Recht berühmtesten und von der Jury der Dionysien ausgezeichneten Stück, „Antigone“. Jürgen Wertheimer erläutert: „Eine todesmutige junge Frau, die ihr Leben einsetzt für – scheinbar ein bloßes Beerdigungsritual, in Wirklichkeit für den Kampf gegen ein in ihren Augen korruptes Herrschaftssystem.“ Eine selbstbewusste junge Frau stellt den Staat auf offener Bühne infrage. Sie will den Ernstfall, sie schafft den Ernstfall. Sie ist der Ernstfall, entschlossen, die Grenzen des Systems zu erkunden und darüber hinauszugehen. Jürgen Wertheimer ist seit 1991 Professor für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft und Komparatistik in Tübingen.
Der Held im Bildungsroman ist immer ein Mann
Die Rehabilitierung des Romans als Literaturgattung war eine Leistung der Aufklärung, aber erst in der Kunstepoche erlangte der Roman weltliterarische Geltung und trat gleichberechtigt neben das Drama. Als Kunstepoche bezeichnete Heinrich Heine die Zeit zwischen der Französischen Revolution 1789 und dem Tod Johann Wolfgang von Goethes 1832. Johann Wolfgang von Goethes „Werther“ (1774) und Christoph Martin Wielands „Agathon“ (1766/67) stellten die ersten Versuche dar, Erfahrungen und Entwicklungen des bürgerlichen Individuums episch zu erfassen. Beide Romane waren jedoch noch weit davon entfernt, die hoch gesteckten Hoffnungen zu erfüllen, die Friedrich von Blanckenburg in seiner „Theorie des Romans“ (1774) mit dem bürgerlichen Roman verbunden hatte. „Werther“ bot nur einen höchst subjektivistischen Ausschnitt der Gesellschaft. „Agathon“ war in ein antikes Gewand gehüllt und verdeckte die bürgerliche Identitätsproblematik mehr, als dass er sie verdeutlichte.
Der Literatur Kalender 2021 verbreitet Hoffnung
Der Literaturkalender 2021 widmet sich diesmal ganz und gar Momenten der Hoffnung. In diesen grässlichen Zeiten der Corona-Seuche ist das löblich und mehr als verständlich. Auch nach dem Ende einer jeden Diktatur blüht die Hoffnung. Der portugiesische Arzt und Dichter Miguel Torga beschreibt das Ende des Salazar-Regimes durch die sogenannte Nelken-Revolution: „Von Norden nach Süden füllten strahlende Menschenmassen im Sog hemmungslos erneuerter Hoffnung die Straßen. Es war wie ein Traum! … Väter und Söhne, Freunde und Feinde, Gegner und Parteigänger fühlten sich von der gleichen brüderlichen Begeisterungswelle mitgerissen.“ Zora Neale Hurston war in den 1930er Jahren eine der wichtigsten afroamerikanischen Autorinnen. Über die Hoffnung sagt sie folgendes: „Mein Wunsch, wieder zur Schule zu gehen, war nie verstummt … Entschlossen ergriff ich die einzige Waffe, die ich besaß – Hoffnung –, und nahm die Beine in die Hand. Vielleicht würde von nun an alles gut werden.“
Friedrich Schiller macht Karl Moor zum Helden
Die Gestalt des Karl Moor in „Die Räuber“ (1781) von Friedrich Schiller weigert sich der Welt und den Winkelzügen, die sie ihm abverlangt, anzupassen. Er kann das Unrecht, das ihm angetan wird, nicht überwinden. Sein Gemüt bricht sich Bahn und er gerät mit seiner Welt auf Kollisionskurs. Friedrich Schiller macht ihn zu einem Helden. Er hat beschlossen für sich selbst und für andere Opfer der Ungerechtigkeit Rache an der verhassten, scheinheiligen Gesellschaft zu üben. Ger Groot fügt hinzu: „Dazu scheut er sogar nicht davor zurück, die schwersten Verbrechen zu begehen.“ Er gründet eine Räuberbande, er plündert und mordet. Aber er ist ein edler Verbrecher, der büer der verkommenen Welt steht, die seine Persönlichkeit missachtet. Ger Groot lehrt Kulturphilosophie und philosophische Anthropologie an der Erasmus-Universität Rotterdam und ist Professor für Philosophie und Literatur an der Radboud Universität Nijmegen.
Die Literatur des Spätmittelalters ist keine bürgerliche
Walther von der Vogelweide klagte um das Jahr 1220 wiederholt über den Verfall der Sitten bei Rittertum und Volk und über die allgemeine unsichere Situation im Lande und den sichtbaren Schwund der Reichsmacht. Dabei ist eines allerdings zu bedenken: Das ist eine ständische Klage, auch wenn sie im Namen der Menschheit zu sprechen scheint. Ihre ideologische Adresse ist das politisch bedeutungslos gewordene staufische Reichsrittertum und nicht die gesamte Menschheit des christlichen Weltkreises. So hellsichtig und vielseitig sich diese Standesdichtung oft darbietet, letzten Endes ist sie dem konservativen Lager zuzuordnen, weil ihr ein aufnahmebereiter, aufnahmefähiger Blick für die neuen reichspolitischen Realitäten zwangsläufig und aus ihrem eigenen Selbstverständnis fehlen muss. Die Epik und Lyrik der Stauferzeit lebt im 13. Jahrhundert weiter, aber sie tut es in Erfüllung eines einmal gefundenen Musters, mit deutlichem Blick zurück.
Thomas Mann trifft Theodor W. Adorno
Im Jahr 1943 lud der Literaturnobelpreisträger Thomas Mann den Philosophen Theodor W. Adorno in sein Haus am San Remo Drive in Pacific Palisades ein. Er wollte ihm aus dem Manuskript seines letzten Romans „Doktor Faustus: Das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn, erzählt von einem Freunde“ vorlesen. Stuart Jeffries nennt den Grund der Einladung: „Der 68 Jahre alte Schriftsteller erhoffte sich vom zwanzig Jahre jüngeren Theodor W. Adorno fachmännischen musikalischen Rat, den er in den Roman, eine aktuelle Fassung der Faustsage, einarbeiten konnte.“ Thomas Mann schrieb an Theodor W. Adorno: „Wollen Sie mit mir darüber nachdenken, wie das Werk – ich meine Leverkühns Werk – ungefähr ins Werk zu setzen wäre; wie Sie es machen würden, wenn Sie im Pakt mit dem Teufel wären?“ Stuart Jeffries arbeitete zwanzig Jahre für den „Guardian“, die „Financial Times“ und „Psychologies“.