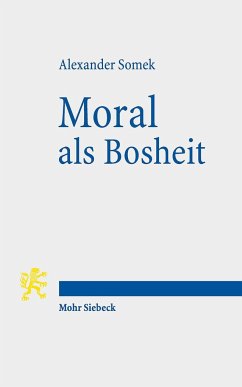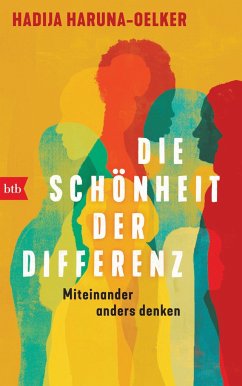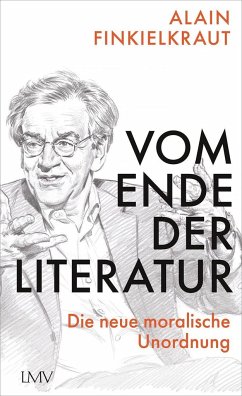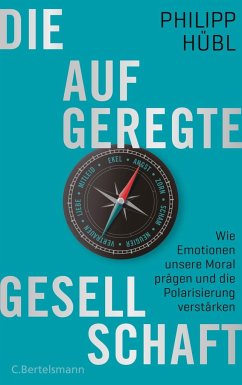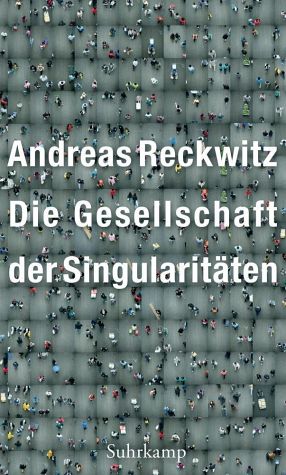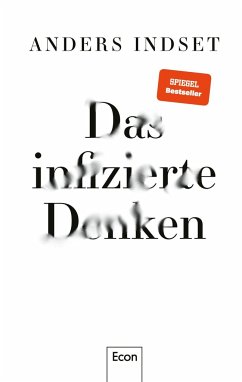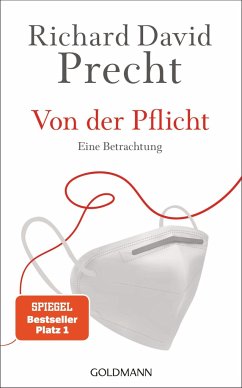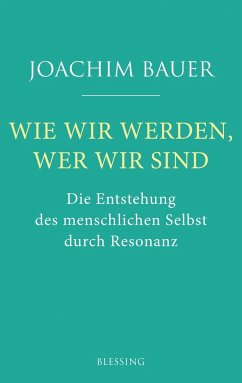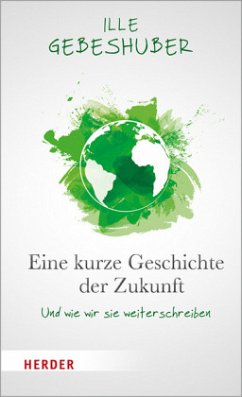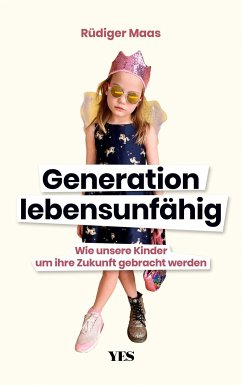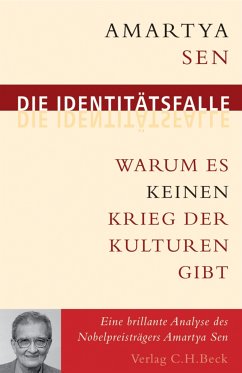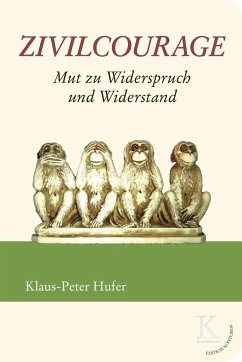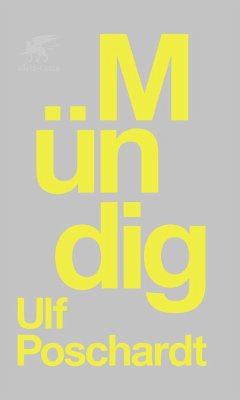Eigentlichkeit und Kapitalismus gehen in der Regel nicht zusammen. Sie sind miteinander inkompatibel. Alexander Somek erklärt: „In eine kapitalistischen Gesellschaft erwartet „man“ von uns, dass wir uns als eine agile und anpassungsfähige Humanressource verstehen. Eine Gesellschaft dieser Art stellt die Karriere und den Erfolg als erstrebenswerte Güter in Aussicht.“ Agilität und Anpassungsfähigkeit sind der Preis, den man entrichten muss, um ihrer teilhaftig zu werden. Wer keine Aussicht hat, als Anwalt erfolgreich zu sein, als Anwalt erfolgreich zu sein, wir halt Chirurg oder umgekehrt. Wer sich diesen Normen fügt, auf den mag Theodor W. Adornos Diktum, das zwar herabwürdigend klingen mag, zutreffen, wonach es für viele Menschen eine Anmaßung sei, „ich“ zu sagen. Alexander Somek ist seit 2015 Professor für Rechtsphilosophie und juristische Methodenlehre an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien.
Soziologie
Nationalität ohne Grenzen ist möglich
Immer wieder hört Hadija Haruna-Oelker Menschen im Alltag von „anderer Hautfarbe“ sprechen, wenn sie Schwarz meinen. Sie selbst sagt das nie, weil Weißsein nicht die Norm ist, von der aus sie spricht. Von ihr aus betrachtet: „Was wäre das, „die andere Hautfarbe“? Hadija Haruna-Oelker erklärt: „Es gibt viele dieser unterbewussten Kategorisierungen. Gedanken von „deiner Kultur“ und „meiner Kultur“. Ein Islam, der für die einen zu Deutschland und für die anderen nicht zu Deutschland gehört.“ Es sind die Gegensätze, die man formuliert. Schon seit langer Zeit hat Nationalität im Kopf von Hadija Haruna-Oelker keine Grenzen gehabt, und sie plädiert für ein offenes Konzept von Zugehörigkeit. Hadija Haruna-Oelker lebt als Autorin, Redakteurin und Moderatorin in Frankfurt am Main. Hauptsächlich arbeitet sie für den Hessischen Rundfunk.
Vor dem Bildschirm sitzen die Zuschauer stets in der ersten Reihe
Von den Menschen früherer Zeiten unterscheidet die heute lebenden, dass sie Zuschauer geworden sind. Alain Finkielkraut erklärt: „Wir schauen Ereignissen zu, von denen unsere Vorgänger durch mündliche Berichte oder die Lektüre erfuhren. Dieses „Wir“ kennt keine Ausnahme mehr: Ganz gleich, wo wir leben, mit dem Bildschirm sitzen wir stets in der ersten Reihe.“ Das Bild von George Floyd, dem am 25. Mai 2020 in Minneapolis gezielt die Luft abgedrückt wurde, ist um die ganze Welt gegangen, ein unerträgliches Bild. „Ich kann nicht atmen“, keuchte der Farbige, während ihm sein Peiniger ungerührt und sogar lächelnd das Knie auf den Hals drückte, bis er starb. Die Amerikaner, die danach spontan auf die Straße gegangen sind, um ihre Empörung kundzutun, versteht Alain Finkielkraut umso besser, als der Mord an George Floyd nicht der erste seiner Art war. Alain Finkielkraut gilt als einer der einflussreichsten französischen Intellektuellen.
Die Differenz der Menschen in Deutschland wird weiter wachsen
Hadija Haruna-Oelker hält fest, dass es eine andere Wirklichkeit gibt, welche die breite Öffentlichkeit bisher nicht zugelassen hat: „Wir leben Leben in Differenz in Deutschland, und diese wird weiter wachsen. Die Differenz war immer da, sollte einst ausgelöscht werden und ist trotzdem nicht aufzuhalten.“ Marginalisierte Menschen warten nicht mehr und verschaffen sich die eigene Sichtbarkeit auf eigenen Bühnen. Sie haben ihre eigenen Methoden der Aufarbeitung geschaffen. Sie sind bereit, diese zu teilen. Es ist der Wunsch von vielen Menschen. Hadija Haruna-Oelker nennt es, ein „Wir-Gefühl“ füreinander zu entwickeln. Und sie meint damit ein Verständnis von „ich fühle mit dir“. Sie meint damit keine Nächstenliebe oder vom Leid anderer bewegt zu sein. Hadija Haruna-Oelker lebt als Autorin in Redakteurin und Moderatorin Frankfurt am Main. Hauptsächlich arbeitet sie für den Hessischen Rundfunk.
Die junge Generation kann mit Mehrdeutigkeit leben
Konservative Menschen hegen einen Wunsch nach Struktur und Klarheit und sie wollen deutlich zwischen Gut und Böse unterscheiden. Die junge Generation hingegen kann nicht nur besser als ihre Eltern und Großeltern mit Fremdheit, Mehrdeutigkeit und Vagheit leben. Sie findet das sogar ästhetisch ansprechend. Philipp Hübl weiß: „Daher sind Komplexität und Ambivalenz ein neues und dominierendes Merkmal der Unterhaltungsindustrie.“ Die großen Narrative der Gegenwart, also Fernsehserien und Computerspiele, die besonders bei jungen Menschen beliebt sind, setzen weder auf eindeutige Rollenverteilungen noch auf eine abgeschlossene Handlungsführung. Selbst der von Daniel Craig gespielte James Bond ist nicht mehr der unbesiegbare Gentleman-Spion. Sondern er ist ein traumatisierter Alkoholiker und, trotz maskuliner Statur, verletzlicher Mann. Philipp Hübl ist Philosoph und Autor des Bestsellers „Folge dem weißen Kaninchen … in die Welt der Philosophie“ (2012).
Erziehung und Bildung erleben einen sozialen Wandel
Das Engagement, das Erziehung und Schule in den Familien der akademischen Mittelklasse seit den 1990er Jahren beansprucht, ist immens. Andreas Reckwitz erläutert: „Der alltägliche Umgang mit den Kindern, ihre Förderung und Begleitung ihrer Schullaufbahn erreichen eine ausgeprägte Intensität.“ Erziehung und Schule sind der Ort, an dem sich die beiden wichtigsten Motive der Lebensführung der Akademikerklasse, aufs Engste miteinander verbinden. Nämlich ihr Wunsch nach Selbstentfaltung und das Streben nach sozialem Prestige. In der industriellen Moderne stellte die Schule ein herausragendes gesellschaftliches Feld der formalen Rationalisierung und Standardisierung dar. Die soziale Logik des Allgemeinen und des Gleichen war prägend. Die Massenbildung ist eine „industrielle“ Bildung gewesen und ist es nach wie vor. Andreas Reckwitz ist Professor für Kultursoziologie an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt / Oder.
Nur die Unvernünftigen dulden keinen Widerspruch
Das Recht ist eine Sphäre von vernünftigen Auffassungsunterschieden. Alexander Somek erklärt: „In gewissem Umfang ist es kein Anzeichen von Unvernunft, wenn man inhaltlich nicht akzeptiert, was für uns gelten soll. Es bedeutet sogar umgekehrt, dass die Anerkennung von Dissens die Vernunft indiziert. Vernünftige Leute verstehen, warum wir nicht übereinstimmen.“ Sie verstehen, dass die Dinge mehr als eine Seite haben und dass unterschiedliche Leute den einen oder anderen Aspekt entgegengesetzt bewerten. Nur die Unvernünftigen wollen einer Meinung sein und dulden keinen Widerspruch. Die Unvernünftigen bestehen auf Übereinstimmung. Sie sehen nicht, dass der Dissens die Brücke zur Vernunft ist. Was die einen anordnen, weil sie es für richtig halten, stellt für die anderen einen Eingriff in ihre Freiheit dar. Alexander Somek ist seit 2015 Professor für Rechtsphilosophie und juristische Methodenlehre an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien.
Das Wissen verwandelt sich zum neuen Öl
Die Einbildung ist der Todesstoß der Bildung. Statt nachhaltigem Lernen, Wachsen und Versehen heißt es Verbildlichen und Liken. Sogar in der Mathematik und Physik zieht man ästhetische Modelle und Hypothesen vor. Anders Indset stellt fest: „Wir brauchen diese Kompensation, da sie uns Stabilität und Halt gibt, aber gleichzeitig macht sie uns starr und schafft eine trügerische Ruhe. Wir sterben in Schönheit, leben aber nicht den Fortschritt.“ Das starre Wissen, das man in bestimmten Institutionen vermittelt bekommt, setzt man absolut. Es wird für den einen abschließenden Test gelernt. Befristetes Wissen führt zur Qualifikation und Bildung zum sozialen Grad. Das heutige Bildungssystem ist ein endliches Modell, das auf Speichern von Daten ausgerichtet ist. Anders Indset, gebürtiger Norweger, ist Philosoph, Publizist und erfolgreicher Unternehmer.
Der Konsument befindet sich in einem Zustand latenter Gereiztheit
Preise selbst zur Ware zu machen ist weit mehr als nur ein Anschlag auf die Leistungsgesellschaft. Es ist eine tägliche Prägung und evidente Lebenswirklichkeit, gegen die Moralphilosophen nur hilflos anschreiben können. Richard David Precht stellt fest: „Die Vorteilsgesellschaft statt der Leistungsgesellschaft verhöhnt zentrale Werte des Bürgertums, wie Treue, Fairness und Verlässlichkeit.“ Und da Menschen, wie die Wirtschaftspsychologie eindrucksvoll beweist, lieber die Bösen als die Dummen sind, spielen nahezu alle mit. Die Seelen der Menschen finden sich dabei zumeist in einem Zustand zumindest latenter Gereiztheit, übersättigt und angestachelt zugleich. Und genau das ist das Telos der Ökonomie. Nicht der zufriedene Konsument ist ihr Ziel, sondern der immer wieder neu unzufriedene. Der Philosoph, Publizist und Autor Richard David Precht einer der profiliertesten Intellektuellen im deutschsprachigen Raum.
Die moderne Gesellschaft bringt unangenehme Grenzgänger hervor
Der Publizist Roger Willemsen hat 2016 in seinem Essay „Wer wir waren“ die Gegenwart aus der Zukunft betrachtet. Darin beschrieb er eine Gesellschaft der Ruhelosen, die sich im Kampf um Aufmerksamkeit befindet. Hadija Haruna-Oelker erläutert: „Er sah die Menschen mit der Frage konfrontiert, wie eine Person sich nicht von der Flüchtigkeit der Nachrichten, dem beschleunigten Leben und dem Rasanten unseres Alltags verunsichern lässt.“ Er zeigte zudem, wie in der Gesellschaft alles in Großaufnahme und aus äußersten Steigerungsformen besteht. Menschen horten dabei ein schlechtes Gewissen, weil sie so vieles wissen müssten, was sie nicht wissen. Und schließlich bringt Disziplin und Leistungsfähigkeit auf allen Feldern viele unangenehme Grenzgänger hervor, sodass sich die Frage stellt: Was kann man dagegen tun? Hadija Haruna-Oelker lebt als Autorin, Redakteurin und Moderatorin in Frankfurt am Main. Hauptsächlich arbeitet sie für den Hessischen Rundfunk.
Migration ist ein weltweites Phänomen
Die Menschheit lebt gerade in einem Zeitalter großer Migrationsbewegungen. Diese werden zum ganz überwiegenden Teil von Krieg, Zerstörung, Klimawandel und krasser Armut ausgelöst. Menschen, die ihre Lebensgrundlage verloren haben, müssen sich auf die Flucht begeben. Die Mehrheit der seit 2015 nach Deutschland Geflüchteten sind Menschen aus Syrien, Irak und Afghanistan, also aus Ländern, die eine sogenannte Gemeinschaftskultur pflegen. Joachim Bauer ist seit vielen Jahren in der Flüchtlingshilfe aktiv: „Bereits zur Zeit der Jugoslawienkriege gehörte ich zu einem Kollegennetzwerk, das aus dem Balkan geflohenen Frauen geholfen hat.“ Diesen war teilweise der Aufenthalt in Deutschland verweigert worden, obwohl sie schwere Traumatisierungen hinter sich hatten. Daher lebten sie zum Teil ohne legalen Aufenthaltsstatus in Deutschland. Prof. Dr. Med. Joachim Bauer ist Neurowissenschaftler, Psychotherapeut und Arzt.
Die Welt ist zu kompliziert geworden
Viele Menschen hoffen insgemein, der Weg in eine bessere Welt sei möglich. Doch selbst Übermorgen werden die Politiker der Welt auch keine Lösung für die Probleme der Welt finden. Ille C. Gebeshuber stellt fest: „Selbst der einfache Ansatz, dass der erste Schritt in eine bessere Welt darin besteht, dass alle die Regeln und Gesetze unserer Gesellschaft einhalten, erscheint undurchführbar.“ Die Bürger sehen, dass die Ankündigungen großer Schritte, die man nie ausführt, viel einfacher ist als das Gehen kleiner Schritte, die sofort Geld und Aufwand kosten. Zu kompliziert ist die Welt geworden und zu groß sind die Eigeninteressen einzelner. Aber man weiß einige Dinge. Zum einen weiß man, dass der Weg der globalen Gesellschaft nicht mehr lange so weitergehen kann. Ille C. Gebeshuber ist Professorin für Physik an der Technischen Universität Wien.
Die Deutschen sind liberaler und friedlicher geworden
Innerhalb der letzten 30 Jahren sind die Mehrheit der Deutschen und der übrigen Welt deutlich fürsorglicher, liberaler und friedlicher, kurz: progressiver geworden. Dieser Wandel veranschaulicht allerdings nicht, warum am rechten Rand der deutschen Parteienlandschaft eine Lücke aufgeklafft ist. Diese besetzt jetzt eine neue Partei, die Alternative für Deutschland (AfD). Philipp Hübl blickt zurück: „Fast alle Länder und Kulturen haben in den letzten Jahrhunderten eine Entwicklung vom kollektivistischen Stammesmodell zu modernen Gesellschaftsnormen durchgemacht.“ Die Menschen legen mehr Wert auf Individualismus und universelle Gesetze, sodass der moralische Kompass immer weniger in Richtung Autorität und Loyalität ausschlägt. Fairness und Freiheit rückt in den Vordergrund, wie der amerikanische Anthropologe Alan Fiske zeigt. Philipp Hübl ist Philosoph und Autor des Bestsellers „Folge dem weißen Kaninchen … in die Welt der Philosophie“ (2012).
Die Gesellschaft ist nicht gebildet sondern eingebildet
Auch wenn zunehmend neue Bildungskonzepte entstehen, hat man es größtenteils mit einer Gesellschaft zu tun, die einen traditionellen Ansatz der Bildung verfolgt. Dort manifestiert man Absolutheiten. Man legt keinen Wert auf das Lernen, das Miteinander oder das Wohl der zukünftigen Generationen. Sondern man fördert ausschließlich die Optimierung eines Individuums, die Vorbereitung auf Karriere und Wettkampf. Anders Indset kritisiert: „So sind wir eingebildet. Unsere Gesellschaft ist eingebildet. Wir meinen, wir seinen gebildet. Doch letztlich bilden wir uns das nur ein.“ Der Begriff „Bildung“ ist ausgehöhlt, nichtssagend. Er ist tragischerweise zu einem prätentiösen Begriff geworden. Man kokettiert und schwadroniert mit ihm. Es fallen Aussagen wie „Bildungsrepublik“, „Wir müssen mehr in Bildung investieren“, „Bildung ist der Schlüssel zum Erfolg“. Anders Indset, gebürtiger Norweger, ist Philosoph, Publizist und erfolgreicher Unternehmer.
Fortschritt ist ein zweischneidiges Schwert
Der Medienethiker Paul Virilio prognostiziert in seinen Essay „Rasender Stillstand“ die Auslöschung der menschlichen Zivilisation durch deren erfundene Technologien. Rüdiger Maas weiß: „Virilio ist dabei aber kein Technologiekritiker. Ganz im Gegenteil. Die Folgen des technologischen Fortschritts betrachtet er als positiv, nur wurden die Heilsversprechen um positiven technologischen Folgen zur Propaganda.“ Das Problem dabei ist, dass man bei all den Versprechen der permanenten technologischen Weltverbesserung die negativen Folgen der Technologie außer Acht lässt. Denn Fortschritt ist ein zweischneidiges Schwert. Oder wie es Virilio ausdrücken würde: „Die Erfindung des Schiffs war gleichzeitig die Erfindung des Schiffwracks.“ Der Soziologe und Politikwissenschaftler Hartmut Rosa fordert von den Menschen daher Entschleunigung. Rüdiger Maas studierte in Deutschland und Japan Psychologie. Er ist Gründer und Leiter eines Instituts für Generationenforschung.
Stammesmentalität hindert oft beim klaren Denken
Menschen denken in Gruppen und drehen in Gruppen durch. Doch um wieder zu Sinnen zu kommen, ist jeder auf sich gestellt. Philipp Hübl weiß: „Unsere Stammesmentalität hindert uns oft am klaren Denken.“ Mit der progressiven Revolution legen viele Menschen insgesamt weniger Wert auf Autorität und Loyalität und sind dadurch weltweit weniger kollektivistisch. Doch gerade im Internet kann man eine „Retribalisierung“ beobachten, nämlich die Ausbildung moderner Stämme und die Radikalisierung der Etablierten. Es kämpfen neue Rechte gegen alte Linke, Veganer gegen Fleischesser, Fahrradfahrer gegen Autofahrer, Impfgegner gegen Naturwissenschaftler, Gläubige gegen Atheisten. Denn wer aus dem Blickwinkel seiner Stammesidentität lange genug hinschaut, entdeckt immer irgendwo Nachteile für die eigene Gruppe und moralische Verstöße bei den anderen Gruppen. Philipp Hübl ist Philosoph und Autor des Bestsellers „Folge dem weißen Kaninchen … in die Welt der Philosophie“ (2012).
Menschen haben verschiedene Identitäten
Es ist keine neue Erkenntnis, dass die Menschen verschiedene Identitäten haben können und tatsächlich auch haben. Diese sind an verschiedene wichtige Gruppen geknüpft, denen sie gleichzeitig angehören. Amartya Sen fügt hinzu: „Im normalen Leben sehen wir uns als Mitglieder einer Vielzahl von Gruppen, denen wir allen angehören.“ Jedes dieser Kollektive, denen allen der Betreffende angehört, verleiht ihm eine potentielle Identität, die je nach Kontext sehr wichtig sein kann. Die Darstellung Indien in Samuel P. Huntigtons Buch „Der Kampf der Kulturen“ als einer hinduistischen Kultur ist für Amartya Sen ein grober Fehler. Grobheit der einen oder anderen Art findet man dort auch in der Charakterisierung anderer Kulturen. Amartya Sen ist Professor für Philosophie und Ökonomie an der Harvard Universität. Im Jahr 1998 erhielt er den Nobelpreis für Ökonomie.
Die Moderne umfasst drei Phasen
Generell lässt sich die Geschichte der Moderne in drei Phasen einteilen: die der bürgerlichen Moderne, der organisierten Moderne und der Spätmoderne. Andreas Reckwitz erläutert: „Die bürgerliche Moderne als erste Version der klassischen Moderne verdrängt in Europa und Nordamerika im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts allmählich die traditionelle Feudal- und Adelsgesellschaft.“ Die frühe Industrialisierung, die Aufklärungsphilosophie, und die Verwissenschaftlichung, die Entstehung von überregionalen Warenmärkten und kapitalistischen Produktionsstrukturen, die allmähliche Verrechtlichung und Demokratisierung, die Urbanisierung und die Ausbildung des Bürgertums als kulturell tonangebende Klasse mit Ansprüchen der Selbstdisziplin, der Moral und der Leistung lassen in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft eine soziale Logik des Allgmeinen entstehen. Überall setzten sich die technische, die kognitive und die normative Rationalisierung allmählich durch. Andreas Reckwitz ist Professor für Kultursoziologie an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt / Oder.
Menschen müssen in Sicherheit leben können
Beim zivilcouragierten Handeln geht es um die Beibehaltung einer Zivilgesellschaft. Zudem geht es um die Verteidigung der Menschenrechte, um die Bewahrung der Demokratie und um den Schutz von Opfern durch Diskriminierung. Klaus-Peter Hufer ist besorgt: „Beides ist gefährdet, im Alltag, in der Gesellschaft und in der Politik – und durch diese. Menschen müssen in Würde, Sicherheit und Freiheit leben können – dafür muss immer gesorgt werden, muss wachsam hingeschaut und entschieden gehandelt werden.“ Die Probleme beginnen bei individuellen Beleidigungen und setzen sich fort über Mobbing beim Arbeitsplatz. Des Weiteren kommt es zu öffentlichen Pöbeleien und Behinderungen von beispielsweise Rettungskräften bei ihren Einsätzen. Klaus-Peter Hufer promovierte 1984 in Politikwissenschaften, 2001 folgte die Habilitation in Erziehungswissenschaften. Danach lehrte er als außerplanmäßiger Professor an der Uni Duisburg-Essen.
Unterdrückung passt nicht mehr in diese Welt
Die Menschheit lebt heute in einer globalisierten und digitalisierten Welt, die immer weiter zusammenrückt. In diese Welt passen die unterdrückenden Systeme nicht nur nicht mehr, sondern die Unterdrückten wehren sich ach stärker dagegen. Hadija Haruna-Oelker fügt hinzu: „Diese Menschen tun das im Foucaultschen Sinn und lassen sich nicht mehr zu Gefangenen unserer Geschicke machen.“ Menschenfeindliche Strukturen sind jedoch hartnäckig und das negative Bild einer Differenz spielt bereits im frühen Kindesalter eine Rolle. Es ist eine große und Generationenaufgabe, diese Situation zu verändern. Deshalb ist es Hadija Haruna-Oelker im Zusammenhang mit der Sozialisation und Prägung wichtig, über Kinder als die zukünftige Generation zu sprechen. Hadija Haruna-Oelker lebt als Autorin, Redakteurin und Moderatorin in Frankfurt am Main. Hauptsächlich arbeitet sie für den Hessischen Rundfunkt.
Hoher Bildungsstand sorgt für moralischen Fortschritt
Bildung ist ein wichtiger Faktor für moralischen Fortschritt. Deutsche mit niedriger Bildung sind eher menschenfeindlich. Sie lehnen beispielsweise Muslime zu 24 Prozent oder Langzeitarbeitslose zu 55 Prozent ab. Bei Deutschen mit einem hohen Bildungsstand liegt dieser Anteil bei 8 und bei 35 Prozent. Philipp Hübl ergänzt: „Auch die Anfälligkeit für populistische Parteien befindet sich bei Deutschen mit niedriger und mittlerer Bildung über dem Durchschnitt, bei Hochgebildeten darunter.“ Der Bildungsstand hängt jedoch nicht unmittelbar von den emotionalen Dispositionen ab. Daher ist es naheliegend, dass man mit der Erziehung ein progressives Emotionsprofil erworben oder als Nebeneffekt emotionale Selbstkontrolle erlernt hat. Noch wahrscheinlicher ist, dass man eingesehen hat, dass Fairness und Mitgefühl vernünftig und allgemein geboten sind, weil man sie auch von anderen für sich selbst erwartet. Philipp Hübl ist Philosoph und Autor des Bestsellers „Folge dem weißen Kaninchen … in die Welt der Philosophie“ (2012).
Das Netzwerkkapital spielt eine große Rolle
Heutzutage spielen die Internationalisierung und Entfaltung der Kompetenzen der Persönlichkeit über standardisierte, nationale Bildungsabschlüsse eine zunehmend wichtige Rolle. Andreas Reckwitz erklärt: „Das ökonomische Kapital von Einkommen und Vermögen will auf volatilen Arbeits-, Immobilien- und Finanzmärkten entwickelt werden. Eine bedeutsame Rolle nimmt die Entwicklung von sozialem Kapital ein.“ Die neue Akademikerklasse zeichnet sich durch eine besonders differenzierte Pflege von Netzwerkkapital aus. Sowohl von solchem, das man beruflich verwerten kann, als auch von solchem, das allgemeine Beratungsfunktion verspricht. Dabei geht es um die Themen Gesundheit, Recht und Bildung. Daneben gibt es ein Netzwerkkapital, das relevant für die Gestaltung der Freizeit ist. Als Beispiele nennt Andreas Reckwitz die Nutzung von Ferienhäusern, internationalen Wohnungstausch oder lokale Kaufempfehlungen. Andreas Reckwitz ist Professor für Kultursoziologie an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder.
Geschmack ist die weibliche Form des Genius
Geschmack bezeichnete F. Scott Fitzgerald – ganz Gentleman der alten Schule – als die weibliche Form des Genius. In diesem Sinne wäre die Boutiquisierung der Kultur – folgte man dem Machismo Fitzgeralds – auch ein Erfolg der weiblichen Emanzipation. Ulf Poschardt erklärt: „Die Kultur wird metrosexuell. Vielleicht überlebt das Buch am Ende nur am Coffeetable und das Tanztheater nur in Modeschauen.“ Die Organisation und Reproduktion von Lebensstilen verlangen als Mündigkeitsanstrengung vor allem „kulturelles Kapital“, wie das Pierre Bourdieu vermutet. Kurz vor dem Eintritt in die Zwanzigerjahre des 21. Jahrhunderts hat der Postmaterialismus die Mündigwerdung reidealisiert und dabei auch die Rollenbilder verschoben. Die Klimabewegung Fridays for Future trat 2019 als eine extrem weibliche Protestbewegung hervor. Seit 2016 ist Ulf Poschardt Chefredakteur der „Welt-Gruppe“ (Die Welt, Welt am Sonntag, Welt TV).
Soziale Verbundenheit könnte ein Idealzustand sein
Das Assimilationsideal strebt nach sozialem Zusammenhalt, opfert aber dafür das Bedürfnis des Einzelnen, mit seiner Herkunftsgemeinschaft in Verbindung zu bleiben. Das Multikulturalismusideal wertet diese Verbindung zu diesen Herkunftsgemeinschaften auf Kosten sowohl eines vernünftigen Identitätsverständnisses als auch der wertvollen Fluidität sozialer Bindungen auf. Danielle Allen stellt fest: „Das Ideal sozialer Verbundenheit und einer vernetzten Gesellschaft wart dagegen die Autonomie.“ Eine Assoziationsökologie, die das Bauen von Brücken maximiert, sollte egalitäre Effekte mit sich bringen. Zudem sollte sie die Wahrscheinlichkeit minimieren, dass soziale Differenz sich mit Herrschaft verknüpft. Damit hat Danielle Allen ein soziales Prinzip der Organisation formuliert. Danielle Allen ist James Bryant Conant University Professor an der Harvard University. Zudem ist sie Direktorin des Edmond J. Safra Center for Ethics in Harvard.
Die Emanzipation verändert auch die Männer
Noch zur Zeit der Aufklärung wurden Knechte wie Mägde, aber auch Frauen ganz allgemein als unmündig angesehen. Immanuel Kant bezeichnete 1793 noch die Unmündigkeit der Frauen als natürlich gegeben und nannte sie in einem Atemzug mit der der Kinder. Ulf Poschardt stellt fest: „Mündige Männer freuen sich gut zweihundert Jahre später über die Emanzipation der Frauen.“ Die „emancipatio“ meinte im Lateinischen die Entlassung des Sohnes aus der väterlichen Gewalt oder auch die Freilassung eines Sklaven. Mündigkeit kennt kein Geschlecht. Sie ist eine universalistische Idee von Humanität und Fortschritt. Durch den Prozess der Emanzipation werden nicht nur Frauen andere, auch die Männer verändern sich mit ihnen. Die kulturellen Rollenbilder verschieben sich drastisch und schnell. Seit 2016 ist Ulf Poschardt Chefredakteur der „Welt-Gruppe“ (Die Welt, Welt am Sonntag, Welt TV).