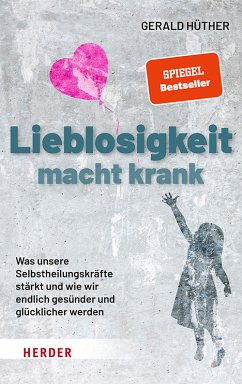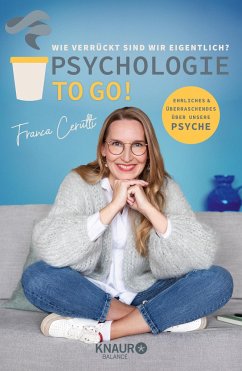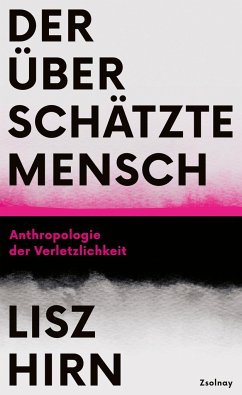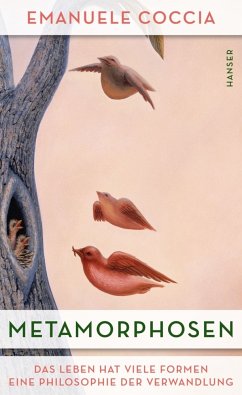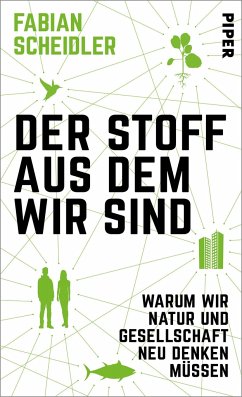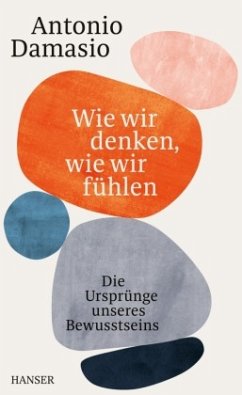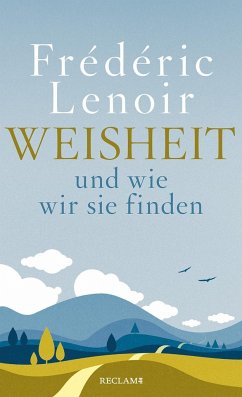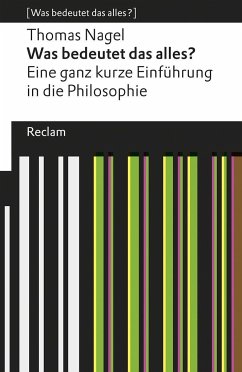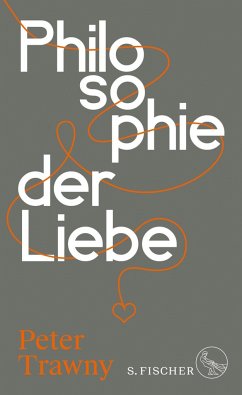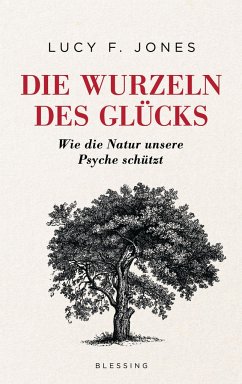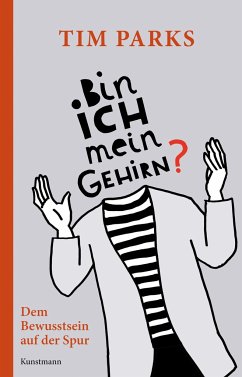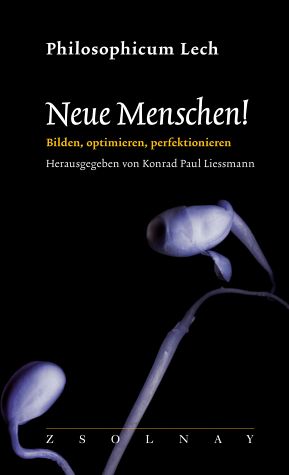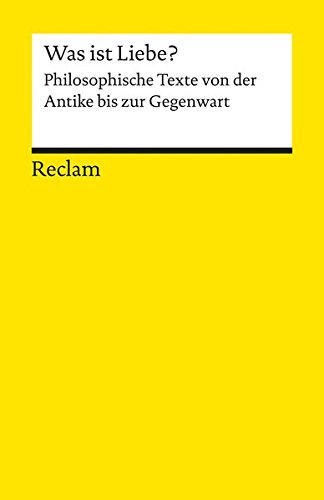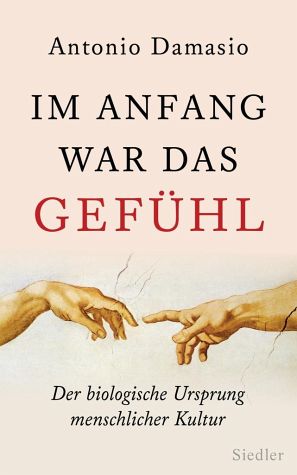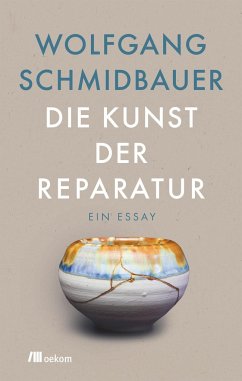Am Beispiel des Nocebo-Effektes lässt sich die krankmachende Wirkung krankmachender Vorstellungen am leichtesten verstehbar machen. Gerald Hüther weiß: „Der menschliche Organismus verfügt über Selbstheilungskräfte, die ihre Wirkung insbesondere über die im gesamten Organismus ausgebreiteten integrativen Systeme entfalten: das autonome Nervensystem, das Hormonsystem, das kardiovaskuläre System und das Immunsystem.“ Gesteuert und koordiniert wird deren Aktivität im Gehirn nicht von der Hirnrinde, sondern von neuronalen Netzwerken, die in entwicklungsgeschichtlich älteren und tiefer im Hirn gelegenen Bereiche lokalisiert sind. Diese Netzwerke dienen der Regulation der im Körper ablaufenden Prozesse. Sie sind nicht daran beteiligt, wenn sich ein Mensch etwas vorstellt oder ausdenkt. Deshalb gibt es diese Netzwerke auch schon bei den Krokodilen. Solange sie in ihren Aktivitäten und ihrem Zusammenwirken durch nichts gestört werden, ist alles gut. Gerald Hüther ist Neurobiologe und Verfasser zahlreicher Sachbücher und Fachpublikationen.
Körper
Die Psyche und das Gehirn sind eng verbunden
Wenn man über die Psyche spricht, spricht man auch über das Gehirn. Genauer: über das gesamte Nervensystem. Franca Cerutti weiß: „Die Trennung zwischen Psyche und Körper und die Vorstellung, als sei die Psyche etwas, was den Körper „bewohnt“, ist schlicht und einfach falsch. Wir haben keinen Körper, wir sind ein Körper.“ Menschen sind Chemie und Strom, sie sind Botenstoffe und Hormone. Gleichzeitig sind sie, wie Aristoteles schon sagte, als Ganzes mehr als die Summe ihrer Teile. Menschen sind die Magie, die sich aus dem gesamten komplexen, verzahnten Geschehen ergibt. Und wie könnte dieses ganze System stets und ständig bei jedem „normal“ laufen? Das menschliche Gehirn ist wohl das komplizierteste Organ, das sich im Laufe der Evolution entwickelt hat. Franca Cerutti ist Psychotherapeutin mit eigener Praxis und Podcasterin.
Die Spezies Mensch droht die Vernichtung
Die Abgrenzung zwischen „Tier“ und „Mensch“ war eine der wichtigsten Aufgaben der Philosophie. Sie nahm eine exklusive Vernunftbegabung an, um die außerordentliche Stellung des Menschen nicht nur auf der Erde, sondern sogar im Kosmos zu legitimieren. Als unspezifischer Gegenbegriff zum Menschen geistert „das Tier“ in einem verallgemeinerten Singular durch die Philosophiegeschichte. Lisz Hirn fordert: „Gerade wir, die wir durch die uns drohende Vernichtung Fragile geworden sind, erleben diese Kluft zwischen Fleisch und Geist, bedürfen einer neuen Anthropologie, die sich nicht jenseits, sondern in unserer Verletzlichkeit verortet.“ Laut Giorgio Agamben ist der Mensch in der westlichen Kultur immer als Trennung und Vereinigung eines Körpers und einer Seele gedacht worden. Lisz Hirn arbeitet als Publizistin und Philosophin in der Jugend- und Erwachsenenbildung, unter anderem am Universitätslehrgang „Philosophische Praxis“.
Im Spiegel vervielfältigt sich die eigene Gestalt
Das Reich der Bilder, die Sinnenwelt, ist ein an den Rändern einer spezifischen Kraft – des rezeptiven Vermögens – errichtetes Reich. Emanuele Coccia erläutert: „Indem das Medium die materielose Form in sich empfängt, trennt es sie von ihrem gewohnten Substrat und ihrer Natur.“ In den Begriffen der Scholastik ist das Medium der Ort der Abstraktion, also der Abtrennung. Das Sinnliche ist die von ihrer natürlichen Existenz abgetrennte, abstrahierte Form. So existiert das eigene Abbild im Spiegel oder einer Fotografie wie losgelöst von der eigenen Person, in einer anderen Materie, an einem anderen Ort. Die Trennung ist die wesentliche Funktion des Ortes. Einer Form einen Ort zuzuweisen, bedeutet, sie von den anderen zu trennen. Sie von der Kontinuität und der Vermischung mit dem übrigen Körper abzulenken. Emanuele Coccia ist Professor für Philosophiegeschichte an der École des Hautes Études en Sciences Sociales in Paris.
Das Sinnenleben ist nicht vollkommen privat
Die Anthropologie reduzierte das Sinnenleben zumeist auf eine flüchtige, vollkommen private Form des individuellen Seelenlebens. Es erscheint für Emanuele Coccia tatsächlich müßig, etwas spezifisch Menschliches in einer unbestimmten Gemeinsphäre finden zu wollen. Denn diese wird mit unendlich vielen Lebensformen geteilt. Diese sind ihrerseits im Hinblick auf ihren Ethos, ihre Gewohnheiten, ihre Maße und Wurzeln unendlich vielfältig. Emanuele Coccia fordert: „Ein Mensch zu werden, sollte bedeuten, ein Leben nach dem Leben erlangen zu können.“ Ebenso schwierig dürfte es sein, das Fundament des Gemeinsamen, des Zusammenlebens mit anderen zu erkennen. Dessen ungeachtet nimmt die menschliche „Vita activa“, das ureigenste Leben, augenscheinlich ihren Anfang bereits in bestimmten Bildern. Durch diese begreift ein Mensch die Welt und ihre Formen. Emanuele Coccia ist Professor für Philosophiegeschichte an der École des Hautes Études en Sciences Sociales in Paris.
Die Geburt ist kein absoluter Anfang
Die Geburt ist die absolute Grenze der Wiedererkennbarkeit. Sie ist die Schwelle, auf der das „Ich“ mit einem anderen verschwimmt. Emanuele Coccia erklärt: „Unmöglich zu sagen, ob der Atem, der uns erlaubt, diese Silbe auszusprechen, wirklich uns gehört. Oder ob er die Fortsetzung des Körpers unserer Mutter ist. Unmöglich zu sagen, ob diese Silbe unseren Körper bezeichnet oder den, aus dem wir gekommen sind.“ Die Geburt ist die Kraft, durch welche die Menschen „ich“ nur sagen können, wenn sie alle Erinnerung verleugnen. Sie müssen vergessen, woher sie kommen. Sie müssen den anderen Körper vergessen, der sie solange beherbergt hat, müssen sich von ihm ent-identifizieren. Emanuele Coccia ist Professor für Philosophiegeschichte an der École des Hautes Études en Sciences Sociales in Paris.
Leben und Wille sind aktive Prinzipien
Der Forschungsgegenstand der Physik war von Anfang an das, was man als „unbelebte Materie“ bezeichnet. Dass das Leben gänzlich anderen Gesetzen folgt, bemerkte schon Isaac Newton. Er schreibt: „Leben und Wille sind aber aktive Prinzipien. Durch diese bewegen wir den Körper. Und aus ihnen erwachsen andere Gesetze der Bewegung, die uns unbekannt sind.“ Seit dem frühen 17. Jahrhundert behaupteten Forscher, dass sich nicht nur die Bewegungen toter Objekte, sondern auch die des Lebens vollständig aus den Prinzipien der Mechanik erklären ließen. Fabian Scheidler erklärt: „Isaac Newton wies jedoch auf die entscheidende Schwäche dieser Auffassung hin. Wenn Lebewesen rein mechanische Apparaturen sind, wie ist dann die Erfahrungstatsache zu erklären, dass wir unseren Körper durch bewusste Entscheidungen bewegen können?“ Der Publizist Fabian Scheidler schreibt seit vielen Jahren über globale Gerechtigkeit.
Der Mensch besitzt zwei Formen der Intelligenz
Einen Geist hat der Mensch ganz sicher. Er ist von Mustern sensorischer Repräsentationen bevölkert, die man Bilder nennt. Aber der Mensch besitzt auch die nichtexpliziten Fähigkeiten, die den einfacheren Organismen so gute Dinge leisten. Antonia Damasio erläutert: „Wir werden von zwei Formen der Intelligenz gesteuert, die auf zwei Formen der Kognition basieren. Die eine ist die Form, die wir Menschen schon seit langem erforschen und schätzen. Ihre Grundlagen sind Vernunft und Kreativität. Sie basiert auf der Handhabung expliziter Informationsmuster, wie wir Bilder nennen.“ Der zweite Typ ist die nicht explizite Fähigkeit, die man auch bei Bakterien findet. Antonio Damasio ist Dornsife Professor für Neurologie, Psychologie und Philosophie. Außerdem ist er Direktor des Brain and Creativity Institute an der University of Southern California.
Die Metamorphose ist die Bestimmung des Menschen
Einmal geboren, haben die Menschen keine Wahl mehr. Emanuele Coccia erklärt: „Die Geburt lässt uns die Metamorphose zur Bestimmung werden. Wir sind nur auf der Welt, weil wir geboren wurden.“ Das Gegenteil trifft aber genauso zu. Geboren zu sein, bedeutet ein Stück dieser Welt zu sein. Gewiss, allerdings eines, dessen Gestalt die Menschen verändern mussten. Die Menschen sind eine Metamorphose dieses Planeten. Und einzig durch Metamorphose haben sie Zugang zu sich selbst und zu allen übrigen Körpern erhalten. Sie haben das Stück Materie, das sie beherbergt, verändert, um auf die Welt zu kommen. Sie haben sich dem Körper und Leben ihrer Eltern anverwandt und deren Lauf verändert. Emanuele Coccia ist Professor für Philosophiegeschichte an der École des Hautes Études en Sciences Sociales in Paris.
Der Geist muss immer wachsam sein
Buddha sagt, dass Wachsamkeit oder Wachheit des Geistes mit deren Anwendung auf Gedanken und Worte beginnen müsse. Wenn man einen gesundheitsschädlichen, krankhaften Gedanken bemerkt, kann man vermeiden, dass er sich weiterentwickelt, indem man wachsam ist. Frédéric Lenoir weiß: „Gedanken haben nicht nur einen beträchtlichen Einfluss auf uns selbst, sondern auch auf andere. Ein böser Gedanke kann ein wahres Gift sein, das unseren Geist und unser Herz verdunkelt.“ Er kann sich auch, wenn der eigene Geist entsprechend negative Energie erzeugt, auf andere auswirken. Was man in bestimmten Kulturen den „bösen Blick“ nennt, ist kein Aberglaube. Die Tatsache, dass man gegenüber jemandem negative Gedanken hat, kann einen realen negativen Einfluss auf diese Person haben. Frédéric Lenoir ist Philosoph, Religionswissenschaftler, Soziologe und Schriftsteller.
Das Sinnliche dominiert die Welt
Die Menschen leben unter dem ständigen Einfluss des Sinnlichen. Dazu zählt Emanuele Coccia Gerüche, Farben, den Geschmack der Speisen, Melodien und ganz banale Geräusche. Sie sind die allererste Ursache, der Zweck und die permanente Gelegenheit des menschlichen Handelns. Emanuel Coccia erklärt: „Unsere Existenz – im Schlaf und im Wachsein – ist ein endloses Bad im Sinnlichen.“ Es sind Bilder, welche die Menschen ständig ernähren und welche die Erfahrungen am Tag und im Traum unentwegt nähren. Sie bestimmen die Wirklichkeit und den Sinn jeder menschlichen Regungen und Bewegungen. Sie sind es, die den Gedanken eines Menschen Wirklichkeit und seinen Begierden Gestalt verleihen. Die Grenzen des kreatürlichen Lebens lassen sich unmöglich an den Grenzen des anatomischen Körpers messen. Emanuele Coccia ist Professor für Philosophiegeschichte an der École des Hautes Études en Sciences Sociales in Paris.
Das Bewusstsein eines anderen ist unergründbar
Es gibt eine besondere Form des Skeptizismus. Diese bleibt auch dann ein Problem, wenn man annimmt, dass das menschliche Bewusstsein nicht das Einzige ist, was es gibt. Dass also die physikalische Welt, die jeder Mensch um sich herum sieht und spürt, den eigenen Körper eingeschlossen, wirklich existiert. Thomas Nagel erläutert. „Es handelt sich um einen Skeptizismus in Bezug auf die Natur oder gar die Existenz eines Bewusstseins außer unserem eigenen oder von Erlebnissen außer unseren eigenen.“ Wie viel weiß man wirklich über das, was im Bewusstsein eines anderen vorgeht? Man beobachtet offenbar nur den Körper eines anderen Wesens, auch eines anderen Menschen. Der amerikanische Philosoph Thomas Nagel lehrt derzeit unter anderem an der University of California, Berkeley und an der Princeton University.
Peter Trawny kennt die unglückliche Liebe
Der Selbstmord in der Liebe ist ein bekanntes Ende. Vertraut ist auch, dass in einer spezifischen philosophischen Sicht der Selbstmord Ausdruck urmenschlicher Freiheit und damit von Souveränität ist. Peter Trawny weiß: „Doch die Autoren, die einen solchen Freitod proklamieren – zum Beispiel Seneca – denken in einem anderen Kontext. Man bringt sich um, weil man in einer politisch ausweglosen Lage steckt, weil man unheilbar krank ist, weil man restlos verarmt ist, aber nicht weil man unglücklich liebt. Die Unendlichkeit ist das Ein und Alles der Liebe. Im Augenblick der Vereinigung schwindet Zeit und Ewigkeit entfaltet sich. Eine andere Erfahrung der Zeit stellt sich ein. Doch das Leben sieht anders aus. Peter Trawny gründete 2012 das Martin-Heidegger-Institut an der Bergischen Universität in Wuppertal, das er seitdem leitet.
Bilder existieren auf nichträumliche Weise
Das Sinnliche ist das Sein der Formen, wenn sie außerhalb sind, wie im Exil, fern des eigenen Ortes. Wie soll man sich diesen zusätzlichen Raum vorstellen, der das absolute Außen ist? Wegen ihrer Außenkörperlichkeit existieren Bilder auf nichträumliche Weise. Wenn ein Spiegel unser Bild aufnimmt, schreibt Albertus Magnus, nimmt er weder an Gewicht noch an Volumen zu. Emanuele Coccia ergänzt: „Während ein Körper Tiefe besitzt, existiert das Bild im Spiegel, ohne sich von dessen Oberfläche abzuheben.“ Das Sein des Sinnlichen, das Bild-sein, determiniert also keinerlei räumliche Existenz. Emanuele Coccia hält fest: „Ein Bild ist das Entweichen einer Form aus dem Körper, dessen Gestalt es ist. Ohne dass diese äußerliche Existenz eines anderen Körpers oder eines anderen Gegenstands determinieren kann.“ Emanuele Coccia ist Professor für Philosophiegeschichte an der École des Hautes Études en Sciences Sociales in Paris.
Mikroben sind zahlreicher als menschliche Zellen
Im Körper eines Menschen leben vermutlich mehr mikrobielle als menschliche Zellen. Symbiotische Organismen kolonisieren diverse Körperregionen. Als Beispiele nennt Lucy F. Jones Mund, Haut, Vagina, Bauchspeicheldrüse, Augen und Lunge. Und viele von ihnen leben im Darmtrakt. Mit ziemlicher Sicherheit leben auf dem Gesicht Hunderte mikroskopisch kleine Milben, vielleicht sogar Tausende. Diese vermehren sich, legen Eier und am Ende ihres Lebens explodieren sie, ohne dass man es bemerkt. Wissenschaftler vermuteten, dass Mikroben im Körper den menschlichen Zellen um ein Zehnfaches überlegen sind. Diese Zahl wurde mittlerweile auf ein Verhältnis von etwa drei zu eins herunterkorrigiert, was immer noch erstaunlich genug ist. Lucy F. Jones ist Journalistin und schreibt regelmäßig zu wissenschaftlichen Themen, Gesundheit, Umwelt und Natur für die BBC, The Guardian und The Sunday Times.
Antonio Damasio erforscht das Bewusstsein
In seinem neuen Buch „Wie wir denken, wie wir fühlen“ beantwortet Antonio Damasio unter anderem folgende Fragen: Was ist Bewusstsein? Welche Rolle übernimmt das Gehirn beim Denken und beim Fühlen und welche der Körper? Philosophen stellen diese Fragen schon seit Jahrhunderten. Seit Neuerem bemühen sich auch die Naturwissenschaften um Antworten. Antonio Damasio verbindet Erkenntnisse aus Philosophie und Hirnforschung, aus Evolutions- und Neurobiologie, aus Psychologie und KI-Forschung zu einer Theorie des Bewusstseins. Dabei schlägt er einen Bogen vom Beginn des Lebens auf der Erde bis zu Gegenwart. Er zeigt dabei, was einen Menschen im Innersten ausmacht – Verstand, aber auch: Emotion. Antonio Damasio ist Dornsife Professor für Neurologie, Psychologie und Philosophie und Direktor des Brain and Creativity Institute an der University of Southern California.
Für Frédéric Lenoir ist die Weisheit eine Lebenskunst
Die Suche nach Weisheit betrifft ebenso stark den menschlichen Geist wie das Herz, die Gefühle und den Körper. Deshalb bezeichnet Frédéric Lenoir die Weisheit vor allem als Lebenskunst. Weisheit ist für ihn das völlige Gegenteil eines asketischen Lebens, das den Körper und die Gefühle verachtet. Sie ist eine Kunst, auf gesunde Weise das Leben zu genießen mit allen Dimensionen des Seins. Frédéric Lenoir ergänzt: „Diesen Weg zu beschreiten, dauert ein ganzes Leben, doch ist er für mich das Schönste überhaupt.“ Wer versucht, ein gutes und glückliches Leben zu führen, beginnt am besten damit, sich dafür zu interessieren, wie er atmet und was er isst. Biologische und regionale Lebensmittel, weniger oder gar kein Fleisch zu essen bedeutet, für sich selbst, für andere und die Welt Sorge zu tragen. Frédéric Lenoir ist Philosoph, Religionswissenschaftler, Soziologe und Schriftsteller.
Das Denken ist noch immer ein Rätsel
Wie jedermann weiß, hängen die Vorgänge im Bewusstsein eines Menschen davon ab, was mit seinem Körper geschieht. Thomas Nagel nennt Beispiele: „Stößt man sich an der Zehe, so tut das weh. Schließt man die Augen, so kann man nicht sehen, was sich vor einem befindet. Haut einem jemand eins über den Kopf, so wird man ohnmächtig.“ Solche Belege zeigen, dass jeder Vorgang im Geist oder im Bewusstsein von einem entsprechenden Vorgang abhängen muss. Die Forschung weiß zwar noch immer nicht, was im Gehirn vor sich geht, wenn ein Mensch denkt. Sie ist sich jedoch ziemlich sicher, dass dort etwas geschieht. Der amerikanische Philosoph Thomas Nagel lehrt derzeit unter anderem an der University of California, Berkeley und an der Princeton University.
Emanuele Coccia kennt den Ort der Bilder
Im Spiegel werden Menschen unvermittelt zum reinen Bild. Sie entdecken sich verwandelt in das reine, immaterielle, unausgeweitete Sein des Sinnlichen. Emanuele Coccia stellt fest: „Unsere Form existiert außerhalb von uns selbst, außerhalb unseres Körpers, außerhalb unseres Bewusstseins. Wir sind zum reinen Sein der Erscheinung geworden, aber nur uns selbst gegenüber.“ Diesseits, in der Welt, in der die Menschen Seele und Materie sind, bietet sich die Erscheinung wie mit etwas anderem vermengt dar. Das ist vielleicht das kleine, große Geheimnis, das Spiegel seit Jahrhunderten in sich tragen. Sie lehren, dass jedes Bild – das Sinnliche als solches – die Existenz einer Form jenseits ihres Ortes ist. Emanuele Coccia ist Professor für Philosophiegeschichte an der École des Hautes Études en Sciences Sociales in Paris.
Tim Parks reist ins Zentrum des Denkens
Tim Parks reist in seinem neuen Buch „Bin ich mein Gehirn?“ in das menschliche Zentrum des Denkens. Dabei konfrontiert er philosophische und neurowissenschaftliche Theorien mit seinen eigenen Erfahrungen. Die meisten Philosophen gehen davon aus, dass die Erfahrung eines Menschen in seinem Gehirn eingeschlossen ist und die äußere Realität unzuverlässig repräsentiert. Farbe, Geruch, Klang, heißt es, ereignen sich nur im eigenen Kopf. Wenn Neurowissenschaftler das Gehirn untersuchen, finden sie nur Milliarden von Neuronen. Diese tausche elektrische Impulse aus und setzen chemischen Substanzen frei. Die Idee zu seinem Buch entwickelte Tim Parks nach einem zufälligen Gespräch mit Riccardo Manzottis radial neuen Theorie des Bewusstseins. Er erzählt dabei die erstaunliche Geschichte eines Paradigmenwechsels. Tim Parks ist ein britischer Schriftsteller und Übersetzer, der seit 1981 in Italien lebt.
Das Klima formt Köper und Geist
Abgeleitet von κλίνω – das griechische Wort für neigen – meint Klima zunächst einmal nicht mehr und nicht weniger als den Einfallswinkel der Sonne an einem gegebenen Ort. Klima ist also ursprünglich, bei Eratosthenes, Hipparchos und Aristoteles, eine geographische Kategorie, ein Breitengrad. Eva Horn fügt hinzu: „Es bezeichnet Zonen oder, mit einem Ausdruck des 18. … Weiterlesen
Der Eros sorgte früh für Chaos
Am Anfang gehört die Liebe den Dichtern. Bevor die Philosophen sie entdecken, feiert man sie in Gedichten und Dramen. Vermutlich steckt hinter dieser historischen Tatsache mehr als nur ein chronologischer Zufall. Als würde erst das Leben sich selbst erzählen müssen, bis der Denker es begreift. Der Eros hatte bei den Denkerinnen schon früh für Chaos gesorgt. Peter Trawny nennt ein Beispiel: „Sappho, die sich selbst Psappho nannte, dichtet lesbische Liebe, hat sich aber der Legende nach wegen eines jungen Mannes namens Phaon von einem Felsen auf der Insel Lesbos ins Meer gestürzt.“ Die Dichterin stirbt im rhythmischen Element der Welle. Ebenso geht es in den Tragödien zu: Selbstmord und Todschlag, wohin das Auge blickt. Peter Trawny gründete 2012 das Martin-Heidegger-Institut an der Bergischen Universität in Wuppertal, das er seitdem leitet.
Die Erotik stellt das Böse und das Diabolische dar
Die Bindung des Lebens an den Tod hat zahlreiche Aspekte. Sie ist in der sexuellen und in der mystischen Erfahrung gleichermaßen wahrzunehmen. Georges Bataille erläutert: „Aber wie immer man sie auch versteht, die menschliche Sexualität wird stets nur in Grenzen zugelassen, über die hinaus sie verboten ist.“ Schließlich tritt überall in der Sexualität eine Regung auf, die den Schmutz einbezieht. Von da an handelt es sich nicht mehr um „gottgewollte“, wohltuende Sexualität, sondern um Verfluchtsein und Tod. Die wohltunende Sexualität steht der animalischen Sexualität nahe. Den Gegensatz dazu bildet die Erotik, die spezifisch menschlich ist und nur im Ursprung mit der Geschlechtlichkeit zu tun hat. Die Erotik, die im Prinzip unfruchtbar ist, stellt das Böse und das Diabolische dar. Der Franzose Georges Bataille (1897 – 1962) gehört zu den kontroversesten Philosophen und Schriftstellern des 20. Jahrhunderts.
Das Nervensystem ist der Diener des Körpers
Eine gute Schätzung verlegt die Entstehung des Nervensystems ins Präkambrium, eine Periode, die vor 560 bis 600 Millionen Jahren endete. Das Leben und sogar vielzelliges Leben kam etwas drei Milliarden Jahre lang gut ohne das Nervensystem zurecht. Antonio Damasio erläutert: „Aus heutiger Sicht schufen die neu auf der Bildfläche erschienenen Nervensysteme für vielzellige Lebewesen die Möglichkeit, die Homöostase im ganzen Organismus besser zu regulieren. Und das wiederum machte eine Vergrößerung von Körper und Funktionsumfang möglich.“ Die Nervensysteme entwickelten sich als Diener für den übrigen Organismus. Oder genauer gesagt, für den Körper – und nicht andersherum. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass sie bis zu einem gewissen Grad auch heute noch Diener geblieben sind. Antonio Damasio ist Professor für Neurowissenschaften, Neurologie und Psychologie an der University of Southern California. Zudem ist er Direktor des dortigen Brain and Creative Institute.
Jeder hält hartnäckig an seinem Körperbild fest
Das Ich-Bewusstsein eines Menschen entwickelt bei seinem Erwachen zwischen dem 14. und 20. Lebensjahr ein Körperbild, an dem es sehr hartnäckig festhält. Daher richten sich an die Heilkunst im Allgmeinen und an die Chirurgie im Besonderen Erwartungen, die auf die Erhaltung und Wiederherstellung dieses Körperbilds hinauslaufen. Sie behaupten sie energisch gegen die Realität. Wolfgang Schmidbauer weiß: „Das chirurgische Modell der Behandlung des narkotisierten Patienten kann kein Vorbild einer psychotherapeutischen Intervention sein.“ Es ist bereits für die medizinische Praxis nur begrenzt tragbar. Ein Anspruch an die Heilkunde, die durch einen Mangel an Selbstfürsorge entstandenen Schäden zu beheben, überlastet alle Beteiligten. Der menschliche Körper ist beides, Grundlage des Selbsterlebens und erlebtes Werkzeug des Ich, mit denen man pfleglich oder nachlässig umgehen kann. Der Psychoanalytiker Wolfgang Schmidbauer ist Autor zahlreicher Fach- und Sachbücher, die sich millionenfach verkauften.