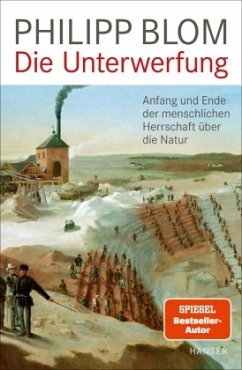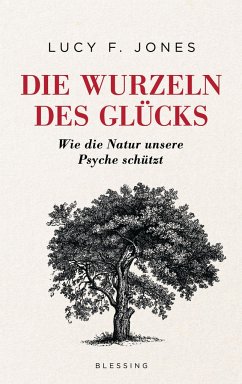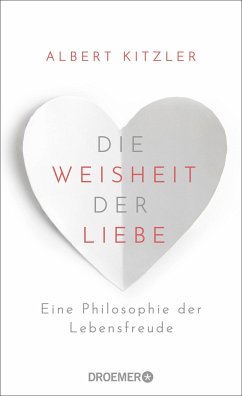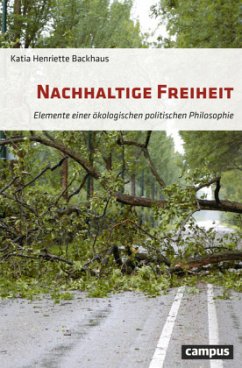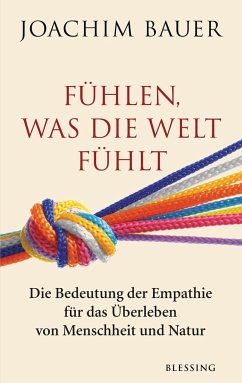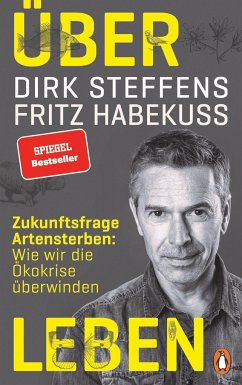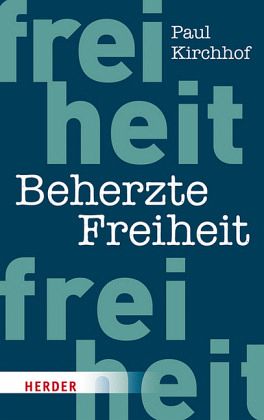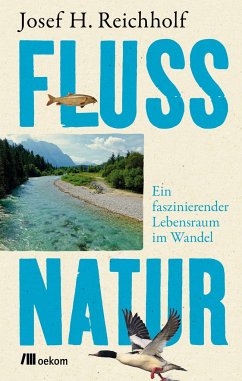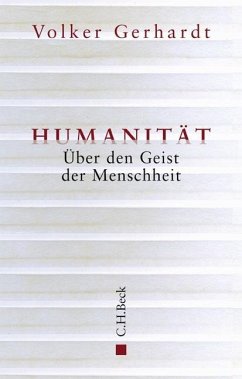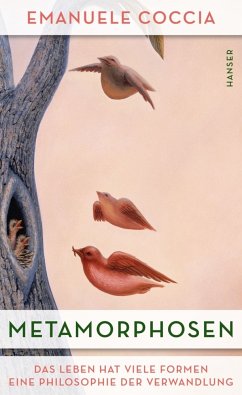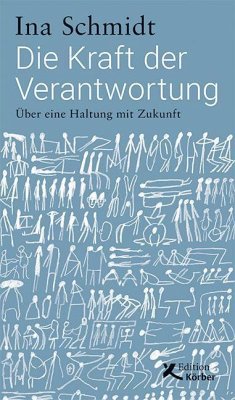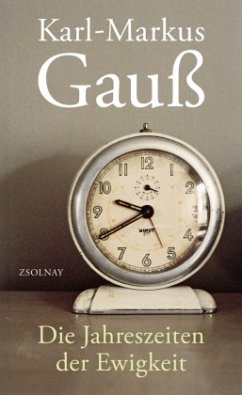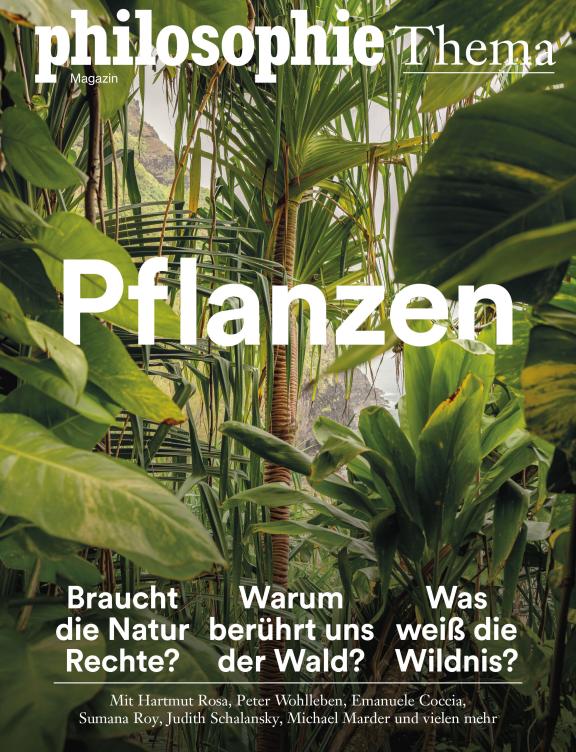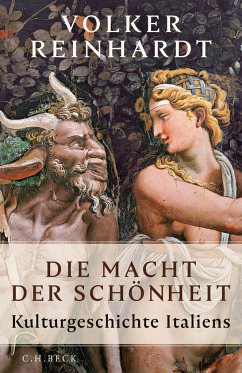Die Philosophie der Gärten füllt Bibliotheken zwischen Japan und England. Sie stellt von Anfang an die Frage, ob es neben der Unterwerfung nicht auch ein kollaboratives Formen und Weiterdenken von Möglichkeiten natürlicher Gestaltung geben könne. Philipp Blom stellt fest: „Im Garten war immer schon die Spannung zwischen Wildnis und Zähmung präsent.“ Im europäischen Mittelalter entstand daraus der „Hortus conclusus“. Nämlich der umhegte Ort, an dem die Jungfrau und das Einhorn in mystischer Eintracht leben. Es handelt sich dabei um einen organisierten Raum, der allegorisch alle Ordnungen der Schöpfung abbilden soll und dessen Pflanzen eine eigene symbolische Sprache sprechen. Der Gegensatz von Natur und Kultur fand seinen Ausdruck in dieser Praxis. Philipp Blom studierte Philosophie, Geschichte und Judaistik in Wien und Oxford. Er lebt als Schriftsteller und Historiker in Wien.
Natur
Die Gegenwart ist von massenhaften Artensterben überschattet
Eine stärkere Verbindung zur Natur würde die Menschen glücklicher und gesünder machen – so weit, so gut. Doch da gibt es ein Problem. Was nützt es, Waldspaziergänge zu verschreiben, wenn weltweit Waldgebiete von Rodungen bedroht sind? Wie sollen die Menschen Zeit im Grünen verbringen, wenn es immer weniger Parks gibt? Wie baut man eine Beziehung zu jemandem auf, der todkrank ist? Lucy F. Jones kritisiert: „In der gesamten westlichen, industrialisierten Welt leben wir zunehmend abgekapselt von der Natur und ignorieren, wie sehr wie sie brauchen. Und damit geht die Katastrophe einher, dass die Natur vor unseren Augen verschwindet; unsere Zeit auf diesem Planeten wird von der gewaltsamen Zerstörung natürlicher Lebensräume und dem massenhaften Artensterben überschattet.“ Lucy F. Jones ist Journalistin und schreibt regelmäßig zu wissenschaftlichen Themen, Gesundheit, Umwelt und Natur für die BBC, The Guardian und The Sunday Times.
Die Natur ist kein Luxus
Lucy F. Jones weiß: „Wie naturnah wir leben, wirkt sich messbar auf unsere Gesundheit aus. Menschen, die in der Nähe von Parks, Wäldern und dem Meer leben, geben an, sich körperlich und geistig besser zu fühlen.“ Die Wahrscheinlichkeit, an Depressionen oder anderen psychischen Problemen zu erkranken, ist bei Menschen, die nicht in zugebauten urbanen Settings leben, sondern nahe der Natur, geringer – ihre Zufriedenheit insgesamt höher. Studien haben gezeigt, dass dies besonders auf Senioren, Hausfrauen und sozial schwache Menschen zutrifft. Die Natur ist kein Luxus. Ob man Zugang zu ihr hat oder nicht, wirkt sich bei unterschiedlichsten Menschengruppen auf die Gesundheit aus. Lucy F. Jones ist Journalistin und schreibt regelmäßig zu wissenschaftlichen Themen, Gesundheit, Umwelt und Natur für die BBC, The Guardian und The Sunday Times.
Nicht jeder Mensch beherrscht die Kunst der Liebe
Man verkennt das Wesen der Liebe, wenn man meint, dies sei nichts weiter als ein Gefühl, das sich einstellt oder nicht und auf das man wenig Einfluss hat. Albert Kitzler ist ganz anderer Ansicht: „Liebe ist eine Kunst, die keineswegs jeder Mensch von Natur aus beherrscht, sondern von den meisten gelernt werden muss, soll ihr Leben gelingen.“ Würden die Menschen die Kunst des Liebens beherrschen, würden die Menschheit in einer anderen Welt leben. Man würde sich dann nicht gegenseitig persönlich angreifen und verletzen, sondern miteinander respektvoll, mitfühlend und verständnisvoll umgehen. Die Völker würden sich nicht bekriegen, ausbeuten und unterdrücken, Gläubige würden Andersgläubige nicht verfolgen, ausgrenzen und töten. Der Philosoph und Medienanwalt Dr. Albert Kitzler gründete 2010 „Maß und Mitte – Schule für antike Lebensweisheit und eröffnete ein Haus der Weisheit in Reit im Winkl.
„Providentia“ vereint drei Elemente
„Providentia“ war jahrhundertelang das Leitwort für menschliches Handeln in Bezug auf die Natur. Der Begriff knüpfte unmittelbar an die christliche Schöpfungslehre an. Er bezeichnete die Lehre von der Erhaltung der Welt und der Fortsetzung der göttlichen Schöpfung. Allerdings war diese Erhaltung- und Fortsetzungslehre von vornherein determiniert. Katia Henriette Backhaus erklärt: „Da die Menschen noch von der Existenz einer göttlichen Vorsehung ausgingen, war ihr Handeln in Bezug auf die Natur eher eine Art ausführender Gehorsam. So verbot sich ein allzu radikales, schädigendes Eingreifen in die Prozesse der Natur.“ Der Oberbegriff der „providentia“ bezeichnet allgemein die Handlung und die Fähigkeit, in die Zukunft hinein zu denken oder sie sogar vorauszusehen. Katia Henriette Backhaus hat an der Universität Frankfurt am Main promoviert. Sie lebt in Bremen und arbeitet als Journalistin.
Die Natur ist eine gewaltige medizinische Ressource
Die Natur dient dem Menschen nicht nur als Lebensraum, sie ist auch eine gewaltige medizinische und soziale Ressource. Joachim Bauer erläutert: „Menschliche Gesundheit, gutes menschliches Zusammenleben und die Bewahrung der Natur stehen in einem Dreiecksverhältnis der Gegenseitigkeit.“ In der Natur zu sein und sie bewusst auf sich wirken zu lassen fördert die körperliche und psychische Gesundheit. Es fördert zudem die Bereitschaft, sich gegenüber Mitmenschen empathisch zu verhalten. Umgekehrt zeigen Menschen mit ausgeprägter Empathie ein höheres Interesse an Fragen des Umweltschutzes und eine stärker ausgeprägte Bereitschaft, sich in Umweltfragen zu engagieren. Joachim Bauer fordert, dass sich die Menschen wieder in eine echte Beziehung zur Natur setzen sollten. Damit ist gemeint, dass man die Natur nicht nur als Kulisse für diverse selbstgefällige oder ehrgeizige sportliche Auftritte benutzt. Prof. Dr. Med. Joachim Bauer ist Neurowissenschaftler, Psychotherapeut und Arzt.
Niemand weiß wie viele Arten es auf der Erde gibt
Die Vielfalt der Natur hat drei Dimensionen: Ökosysteme, Gene und Arten. Dirk Steffens und Fritz Habekuss erläutern: „Letztere haben den praktischen Vorteil, dass man sie relativ einfach zählen kann. Ein Zebra hier, eine Pusteblume da und eine Motte dort. Am Ende addiert sich das auf Millionen. Wie viele Millionen ist unbekannt.“ Denn selbst die scheinbar einfachste Frage ist erstaunlich schwer zu beantworten: Wie viele Arten gibt es überhaupt auf der Erde? Niemand weiß es. Die Forschenden streiten sogar darüber, was eine Art überhaupt ist. Biologen kennen mindestens 24 verschiedene Ansätze, um das Konzept einer Art zu definieren. In ihrem Buch „Über Leben“ erzählen der Moderator der Dokumentationsreihe „Terra X“ Dirk Steffens und Fritz Habekuss, der als Redakteur bei der „ZEIT“ arbeitet, von der Vielfalt der Natur und der Schönheit der Erde.
Der Mensch gewinnt die Herrschaft über die Natur
Paul Kirchhof stellt fest: „Was der Mensch aus eigener Kraft nicht kann, gelingt ihm durch die Herrschaft über die Natur.“ Er gewinnt sie, indem er die Gesetzmäßigkeiten der Natur für seine Ziele einsetzt. Er beherrscht auch andere Menschen, die Gesetzmäßigkeiten der Natur für ihre Zwecke nutzen wollen. Diese werden nun durch Gegenkräfte gehemmt. Je mehr der Mensch seine Fähigkeiten und Kenntnisse erweitert, desto mehr stimmt er sich mit anderen Menschen ab, die auf andere Weise die Natur beherrschen. Die Geschichte der Freiheit beginnt mit dem Kampf gegen die Naturgewalten. Aus diesen löst sich der Mensch nach und nach. Er gewinnt Herrschaft über Teile der Natur. Dr. jur. Paul Kirchhof ist Seniorprofessor distinctus für Staats- und Steuerrecht an der Universität Heidelberg.
Jeder Mensch kann der Natur wertvolle Dienste erweisen
Joachim Bauer betont: „Jeder einzelne Mensch kann der Natur – und damit zugleich seiner eigenen psychischen und körperlichen Gesundheit – wertvolle Dienste erweisen: die Ernährung umstellen, das Mobilitätsverhalten ändern und Müll vermeiden.“ Die Dringlichkeit der Ernährungsumstellung ergibt sich aus der rasend voranschreitenden Vernichtung der großen Wälder dieser Erde. Diese hat ihren Hauptgrund in der Erschließung landwirtschaftlicher Flächen zum Zwecke der Fleischproduktion. Was jeder einzelne Mensch hier, jetzt und sofort tun kann und tun sollte, ist der hedonische – also der nicht in Leidenspose, sondern aus Überzeugung und Liebe zur Natur vorgenommene – komplette Verzicht auf Fleisch. Ein weiterer guter Dienst an der Umwelt besteht darin, soweit als möglich Flugreisen zu reduzieren und vom Kraftfahrzeug auf öffentliche Verkehrsmittel und das Fahrrad umzusteigen. Prof. Dr. Med. Joachim Bauer ist Neurowissenschaftler, Psychotherapeut und Arzt.
Das ökologische System verändert sich ständig
Die gängige Vorstellung vom Gleichgewicht in der Natur würde bestens mit dem mesotrophen Zustand übereinstimmen. Josef H. Reichholf erklärt: „Produktion und Nutzung wären dann ausgeglichen. Und dies auf hohem Niveau, das eine optimale Nutzung von Ressourcen zulässt. Von allem wäre genug im Kreislauf, aber von nichts zu viel.“ Nirgendwo blieben unverwertete Überschüsse zurück. Fast zu schön, um wahr zu sein. Diese Befürchtung ist vollauf berechtigt. Denn tatsächlich ist der mesotrophe Zustand nicht stabil. Er ist ein Durchgangszustand, in dem das Gewässer – oder das ökologische System, ganz allgemein ausgedrückt – nicht von selbst verweilt, sondern sich rasch entweder in die eine oder in die andere Richtung weiter verändert. Josef H. Reichholf lehrte an der Technischen Universität München 30 Jahre lang Gewässerökologie und Naturschutz.
Der Mensch sollte mit der Natur nachhaltig umgehen
Katia Henriette Backhaus erklärt: „Nachhaltigkeit definiert sich über das Verhältnis von Mensch und Natur, das aus drei Perspektiven betrachtet werden kann.“ Die politische Perspektive fragt danach, wie man die Bedürfnisbefriedigung der Menschen zu ihrem Wohl und zum Wohl der Gemeinschaft organisieren kann. Dazu gehört auch der Gedanke an die nachhaltige Stabilisierung der politischen Ordnung. Die ökonomische Perspektive auf das Verhältnis von Mensch und Natur hingegen entspringt der Forderung nach dem „nachhaltigen Erhalt“ und der Sicherung eines nachhaltigen Ertrags. Natur betrachtet man dabei zunächst als Ressourcenlager, das als schützenswert gilt. Der Versuch, Ökologie und Ökonomie zusammenzudenken, prägt die Begriffshistorie der nachhaltigen Entwicklung. Katia Henriette Backhaus hat an der Universität Frankfurt am Main promoviert. Sie lebt in Bremen und arbeitet als Journalistin.
Der Mensch gilt als „Bürger zweier Welten“
Warum macht das Nachdenken über den Menschen es immer wieder nötig, das Offensichtliche seiner Zugehörigkeit zur Natur hervorzuheben? Volker Gerhardt stellt fest: „Vermutlich ist es die im Nachdenken eingenommene reflexive Distanz. Sie lässt es als selbstverständlich ansehen, dass sich das Denken prinzipiell von der Natur unterscheidet.“ Sowohl in ihrer physischen Materialität wie auch in ihrer kausalen Determination steht die Natur der freien Spiritualität des Intellekts in auffälliger Opposition gegenüber. Die Welt scheint spätestens mit dem Auftritt des menschlichen Denkens in zwei Sphären auseinanderzufallen. So hat man sich daran gewöhnt, den Menschen teils als göttlich oder geistig, teils als natürlich anzusehen. Er gilt als „Bürger zweier Welten“. Volker Gerhardt war bis zu seiner Emeritierung 2014 Professor für Philosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Das Internet gilt als Klimakiller
Wenn das Internet ein Land wäre, gehörte es zu den Top Ten der Energieverbraucher, in einer Liga mit Staaten wie den USA, China, Indien, Russland, Japan oder Deutschland. Dirk Steffens und Fritz Habekuss wissen: „Und während in vielen Wirtschaftsbereichen langsam – zu langsam! – der Energiebedarf zu sinken beginnt, wächst der Energiehunger der digitalen Welt um neun Prozent pro Jahr.“ Allein die Streamingdienste sind für etwa 300 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr verantwortlich. Das entspricht immerhin fast einem Drittel der Emissionen des globalen Luftverkehrs. So gesehen sind Katzenvideos fast so klimaschädlich wie Flugreisen. In ihrem Buch „Über Leben“ erzählen der Moderator der Dokumentationsreihe „Terra X“ Dirk Steffens und Fritz Habekuss, der als Redakteur bei der „ZEIT“ arbeitet, von der Vielfalt der Natur und der Schönheit der Erde.
Naturverbundenheit wirkt sich positiv auf die Gesundheit aus
Mehr und mehr erkennt man, dass wichtige Zusammenhänge zwischen dem menschlichen Nervensystem, der Immunfunktion und der Stimmung gibt. Lucy F. Jones ergänzt: „Neueste Fortschritte auf dem Gebiet der Genetik zeigen, dass mit Depressionen assoziierte Gene auch Verbindungen zum Nerven- und Immunsystem haben.“ Naturverbundenheit wirkt sich positiv auf die Immunfunktion des menschlichen Körpers aus, sei es durch eine Entspannung des Nervensystems oder das Verfliegen von Ängsten und Sorgen. Sie verschafft den Menschen durch Phytonzide – die von Bäumen und Pflanzen ausgestoßenen Chemikalien, die das Immunsystem ebenfalls in Schwung bringen können – eine Atempause von verschmutzter Luft. Studien haben gezeigt, dass schon der Blick auf eine natürliche Landschaft zu einem Anstieg entzündungshemmender Zytokine führen kann. Lucy F. Jones ist Journalistin und schreibt regelmäßig zu wissenschaftlichen Themen, Gesundheit, Umwelt und Natur für die BBC, The Guardian und The Sunday Times.
Die Kirche begreift die Geburt als Wunder
Es gibt kaum Literatur zum Thema Geburt. Und wenn es welche gibt, drängt man sie an den Rand „erhabener“ Wissensbestände. Emanuele Coccia stellt fest: „Dafür sind bildliche Zeugnisse im Überfluss vorhanden und haben über die Jahrhunderte die Reflexionen rund um dieses Phänomen genährt.“ Tatsächlich zählt die Nativität zu den häufigsten Motiven der europäischen Malerei. Allerdings ist der Blick der Maler durch das theologische Prisma verzerrt. Die Geburt, die sie schildern, ist kein gewöhnliches, sondern ein einmaliges, nicht darstellbares und widernatürliches Ereignis. Die christliche Theologie hat dazu beigetragen, die Geburt zu etwas Undenkbarem zu machen. Denn sie ließ sie aus jeglichem naturalistischen Rahmen heraustreten, wusste sie gegen die Natur auszuspielen und begriff sie als Wunder. Emanuele Coccia ist Professor für Philosophiegeschichte an der École des Hautes Études en Sciences Sociales in Paris.
Nachhaltigkeit ist ein umfassendes Konzept
Das neue Denken über die Nachhaltigkeit ist unzureichend. Katia Henriette Bachhaus erläutert: „Darüber nachzudenken, wie die Welt und ihre Menschen nachhaltiger werden könnten, ist zu wenig für das, was Nachhaltigkeit verlangt. Denn das Konzept der Nachhaltigkeit ist so sehr ein theoretisches wie ein praktisches. Und nachhaltige Praxis reicht von politischer Gesetzgebung bis in den individuellen Alltag hinein.“ Die Bedeutung der praktischen Seite der Nachhaltigkeit wird jedoch von politiktheoretischen und umweltethischen Ansätzen zuweilen vernachlässigt. Manche Autoren sprechen von einer regelrechten Lücke zwischen der Theorie ökologischer Werte und einer ökologischen Handlungstheorie. Doch das praktische Veränderungen aus theoretischer Überzeugung geschehen, ist eine zu große Hoffnung. Katia Henriette Backhaus hat an der Universität Frankfurt am Main promoviert. Sie lebt in Bremen und arbeitet als Journalistin.
Insekten sind systemrelevant für Ökosysteme
In Deutschland ist die Biomasse von Fluginsekten innerhalb von drei Jahrzehnten um bis zu 75 Prozent zurückgegangen. Dirk Steffens und Fritz Habekuss wissen: „In der Folge des Insektenschwunds sterben auch die Vögel, weil viele sich von Insekten ernähren. Beispiel Nordamerika: Dort sind seit 1970 etwa drei Milliarden Vögel verschwunden. Den Verlust von einzelnen Vogel- oder Säugetierarten können Ökosysteme oft einigermaßen ausgleichen, doch Insekten sind systemrelevant.“ Das Problem ist bereits sehr real. In einigen Regionen Chinas müssen Landarbeiter Obstbäume mittlerweile per Hand bestäuben – was aber nicht nur am Insektensterben liegt. In ihrem Buch „Über Leben“ erzählen der Moderator der Dokumentationsreihe „Terra X“ Dirk Steffens und Fritz Habekuss, der als Redakteur bei der „ZEIT“ arbeitet, von der Vielfalt der Natur und der Schönheit der Erde.
Ohne Freiheit ist Verantwortung nicht möglich
Ina Schmidt schreibt: „Freiheit ist sowohl eine Voraussetzung für verantwortliches Handeln als auch immer wieder ein Hindernis, klare verallgemeinerbare Regelungen im Sinne des vermeintlich Guten durchzusetzen.“ Immer wieder ist es der Verweis auf das hohe Gut der Freiheit, die so mancher ethischen Debatte oder moralischen Vorstellung den Riegel vorschiebt und andererseits die Diskussion darum überhaupt erst eröffnet. Das als gut Anerkannte gebietet möglicherweise eine bestimmte Handlungsweise. Dennoch hat jeder in vielen moralischen Fragen die Freiheit, sich auch anders zu entscheiden. Es geht bei jeder Form von Verantwortung nicht nur um den Schutz, sondern auch um den Gebrauch der eigenen Freiheit. Ina Schmidt ist Philosophin und Publizistin. Sie promovierte 2004 und gründete 2005 die „denkraeume“. Seitdem bietet sie Seminare, Vorträge und Gespräche zur Philosophie als eine Form der Lebenspraxis an.
Kinder können den Eltern sehr gut tun
Zwei jüngere Freundinnen von Karl-Markus Gauß haben jetzt, ehe es zu spät für sie geworden wäre, doch noch Kinder bekommen. Er freut sich für sie, nicht weil er glaubt, dass es die Berufung der Frau wäre, Mutter zu werden. Vielmehr weil Karl-Markus Gauß erfahren hat, wie gut einem Kinder tun können. Ihn haben die seinen von der schweren Krankheit des Zynismus, der ihn an Leib und Seele zu zersetzten drohte, geheilt. So haben sie ihn vor dem selbst verschuldeten Untergang gerettet. Wer Kinder hat, kann sich nicht gemütlich in seinem Weltverdruss einrichten. Ebenso wenig darf er als Kollaborateur des Missglückenden darauf setzen, dass die Dinge ihn schon in der schlechten Meinung, die er von ihnen hat, bestätigen werden. Karl-Markus Gauß lebt als Autor und Herausgeber der Zeitschrift „Literatur und Kritik“ in Salzburg. Seine Bücher wurden in viele Sprachen übersetzt und oftmals ausgezeichnet.
Pflanzen sind die Grundlage der menschlichen Existenz
In der neuen Sonderausgabe des Philosophiemagazins dreht sich alles um das Thema „Pflanzen“. Chefredakteurin Jana Glaese schreibt: „Pflanzen sind die Wurzeln dieser Welt. Ohne sie hätten wir weder Sauerstoff zum Atmen noch Nahrung zum Überleben. Sie sind die Grundlage unserer körperlichen Existenz. Und viel mehr als das.“ Manchen Menschen geben Pflanzen auch eine tiefe seelische Orientierung. Im Wald zum Beispiel finden sie Rückzug und Resonanz, in der Interaktion mit Pflanzen Entschleunigung und innere Ruhe. Überhaupt scheint die Pflanzenwelt immer mehr als Vorbild zu dienen, etwa für andere Formen des Zusammenlebens auf diesem Planeten. Aber das Handeln vieler Menschen gegenüber der Natur zeugt bei Weitem nicht immer von Achtsamkeit und Anschmiegung, sondern oft von Distanz und Herrschaftswillen. Bis heute beansprucht der Mensch seine Verfügungsgewalt über die Flora. Er rodet Wälder, modifiziert Arten, bedient sich der Böden – bis zur Erschöpfung.
Geist und Kultur gehören zusammen
Niemand kann ernsthaft bestreiten, dass der Mensch ein Naturwesen ist und somit zur Natur gehört. Strittig ist lediglich, in welchem Umfang dies der Fall ist und wo man die Grenze zu dem ziehen kann, was nicht oder nicht mehr zur Natur gehört. Einer der letzten philosophischen Autoren, die meinten, hier eine definitive Antwort geben zu können, ist Max Scheler. Dieser glaubte im ausdrücklich gesprochenen „Nein“ des Menschen den Übertritt in eine andere, nicht mehr zur Natur gehörende Sphäre des Geistes entdeckt zu haben. Volker Gerhard betont: „Vom Geist zu sprechen liegt so nahe wie die Rede von der menschlichen Kultur.“ Fraglich ist nur, ob beide derart prinzipiell von der ihr zugrundeliegenden Natur abzugrenzen sind. Volker Gerhardt war bis zu seiner Emeritierung 2014 Professor für Philosophie an der Humboldt-Universität in Berlin.
Durch die Natur versteht der Mensch die Welt
Schon immer haben sich Menschen Aspekten ihrer natürlichen Umgebung zugewandt, um die eigene Existenz zu interpretieren und zu verstehen. Eine besondere Rolle spielten dabei Tiere, Landschaften, Wetterphänomene und biologische Prozesse. Lucy F. Jones betont: „Die Natur hilft uns dabei, die Welt, in der wir uns wiederfinden, zu verstehen und ihr Bedeutung abzugewinnen.“ Selbstverständlich bestehen die frühesten Schöpfungsmythen und Kosmologien aus zahlreichen gemeinsamen Naturmotiven. Dazu zählen Fluten, Schlangen, Eier und animistische Annahmen. Denn die Urahnen der heutigen Menschen waren mit ihrer Umwelt noch wesentlich stärker verbunden. Doch trotz ihrer Entfremdung beziehen sich Menschen auch heute immer noch auf die Natur. Lucy F. Jones ist Journalistin und schreibt regelmäßig zu wissenschaftlichen Themen, Gesundheit, Umwelt und Natur für die BBC, The Guardian und The Sunday Times.
Die Welt leidet an sich selbst
Das Leiden an der Welt ist vor allem ein Leiden an sich selbst. Armin Nassehi sieht im Krisenerleben der Moderne vor allem eine Überforderung der Gesellschaft mit sich selbst. Es geht hier also nicht nur um die Überforderung von handelnden Personen, von Individuen, von Menschen in einer bestehenden Gesellschaft. Es geht auch und vor allem um eine Überforderung gesellschaftlicher Handlungs-, Reaktions- und Gestaltungsmöglichkeiten. Diese haben insbesondere etwas damit zu tun, dass die Strukturen und die Form der Gesellschaft sich selbst überfordern. Die Gesellschaft nutzt ihre Eigenkomplexität zur Lösung von Problemen. Und sie stößt gleichzeitig an die Grenzen ihrer eigenen Verarbeitungskapazität. Das meint Überforderung mit sich selbst. Armin Nassehi ist Inhaber des Lehrstuhls für Allgemeine Soziologie und Gesellschaftstheorie an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Die intensive Landwirtschaft verursacht irreparable Schäden
Moderne Bewässerungstechniken können buchstäblich die Wüste ergrünen lassen. Dirk Steffens und Fritz Habekuss warnen: „Aber oft führen solche Innovationen langfristig zu einer Minderung der Ökosystemleistungen.“ Zu viel Kunstdünger zerstört die Fruchtbarkeit der Böden und tötet Regenwürmer. Zu viel Bewässerung senkt den Grundwasserspiegel und fördert die Versalzung der Böden. Manchmal sind die Schäden irreparabel. Europas größte Gemüsefabrik in der spanischen Region Almeria ist ein besonders krasses Beispiel dafür. Die Gegend rund um das Örtchen El Ejido ist zu trocken, um durstige Pflanzen wie Tomaten, Paprika oder Avocado unter freiem Himmel anzubauen. In ihrem Buch „Über Leben“ erzählen der Moderator der Dokumentationsreihe „Terra X“ Dirk Steffens und Fritz Habekuss, der als Redakteur bei der „ZEIT“ arbeitet, von der Vielfalt der Natur und der Schönheit der Erde.
Die Kultur ist eine Form der Natur
Die Formel von der Kultur als einer Form der Natur verwendet Volker Gerhardt schon seit einigen Jahren. Das ist lange genug, um zu erfahren, dass sie unter Geisteswissenschaftlern Befremden auslöst. Das wundert Volker Gerhardt nicht, hatte er doch selbst eine Beschäftigung mit der „Natur des Bewusstseins“ und der „Naturgeschichte der Freiheit“ nötig. Damit machte er sich klar, dass die Opposition zwischen Natur und Kultur selbst unter einer Prämisse steht, die dem umfänglichen Begriff einer Naturgeschichte im Weg steht. Die Naturgeschichte umfasst die gesamte Entstehungsgeschichte des Weltalls. Und sie ist mit dem Auftritt des Menschen nicht zu Ende. Sie schließt auch das ein, was jetzt noch in der Zukunft liegt. Volker Gerhardt war bis zu seiner Emeritierung 2014 Professor für Philosophie an der Humboldt-Universität in Berlin.