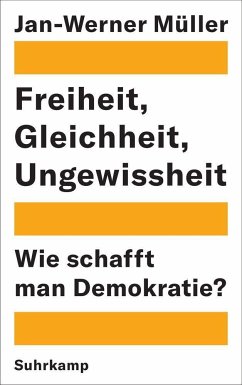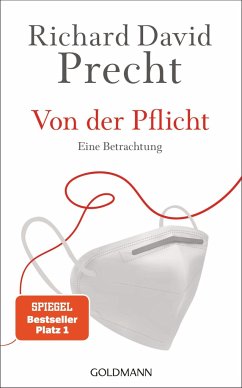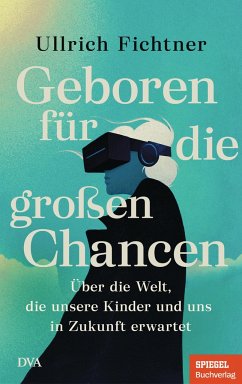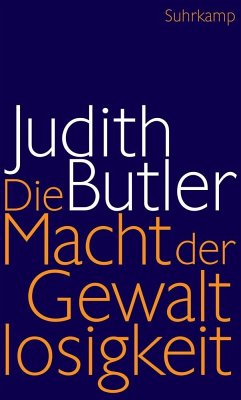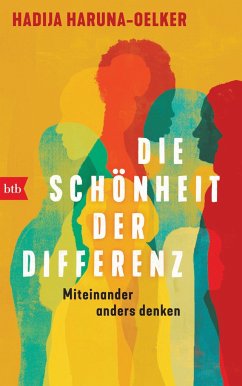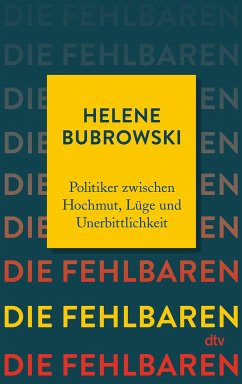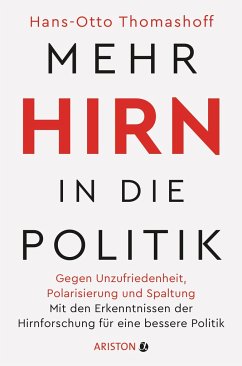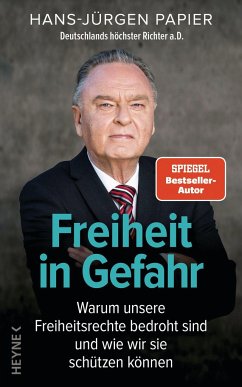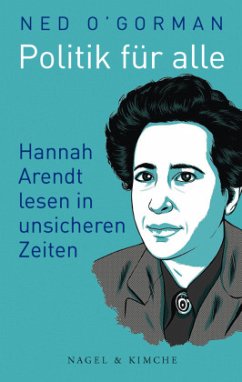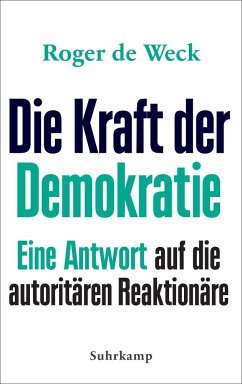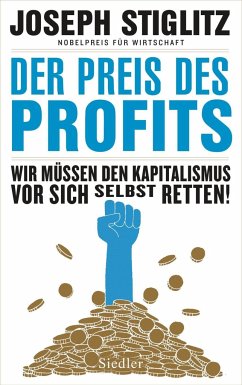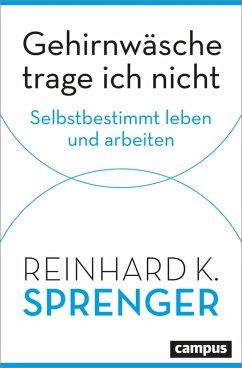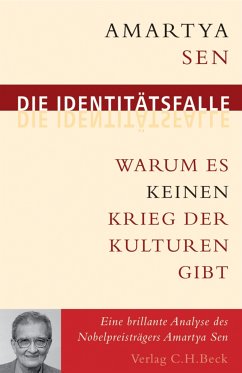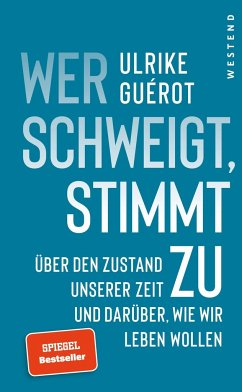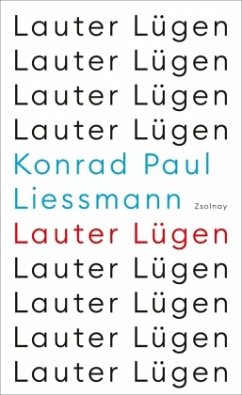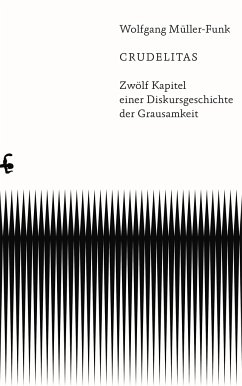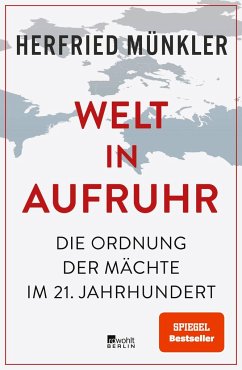Vermittelnde Institutionen erfüllen ihre Aufgaben nicht automatisch von selbst, und offensichtlich operieren sie nicht im luftleeren Raum. Jan-Werner Müller erläutert: „Sie sind vielmehr Teil von Systemen: Parteien bilden Parteiensysteme, Medien bilden Mediensysteme. Deren Struktur kann sich von Land zu Land beträchtlich unterscheiden.“ Welche Art von System jeweils entsteht, hänge ganz wesentlich von dem ab, was der US-amerikanische Soziologe Paul Starr „konstitutive Entscheidungen“ genannt hat. Das lässt sich gut am Beispiel von Parteien nachvollziehen. In den USA einigte man sich 1842 auf das Prinzip der Mehrheitswahl. Das soll heißen: Der Gewinner bekommt alles, der Verlierer nichts.“ In Verbindung mit der Direktwahl des Präsidenten machte diese Entscheidung die Entstehung eines Zweiparteiensystems so gut wie unvermeidlich. Jan-Werner Müller ist Roger Williams Straus Professor für Sozialwissenschaften an der Princeton University.
Politik
Viele Menschen hegen die Liebe zum Reichtum
Alexis de Tocqueville fragt in den 1830er-Jahren, was eigentlich passiert, wenn sich in der Demokratie das Geld zum höchsten erstrebenswerten Gut und Selbstzweck entwickelt. Denn es tritt damit an die Stelle von Stand und Ehr, die Aristokratien über alles andere stellen. Alexis de Tocqueville schreibt: „Die Menschen, die in demokratischen Zeiten leben, haben viele Leidenschaften. Aber die meisten ihrer Leidenschaften münden in der Liebe zum Reichtum, oder sie entspringen ihr. Das rührt nicht daher, dass sie kleinmütiger sind, sondern dass das Geld tatsächlich wichtiger ist.“ Richard David Precht erklärt: „Die ständige Fokussierung auf das Geld prägt die US-amerikanische Gesellschaft wie nichts anderes und ist, wie Tocqueville früh erkennt, das Stigma aller zukünftigen Demokratien.“ Der Philosoph, Publizist und Autor Richard David Precht einer der profiliertesten Intellektuellen im deutschsprachigen Raum.
„Nur“ 0,5 Prozent der Weltbevölkerung sind auf der Flucht
Die von vielen Leuten vor allem in wohlhabenden Ländern gepflegte Vorstellung, die halbe Welt befinde sich irgendwie auf Wanderschaft, liegt meilenweit neben der Realität. In Wirklichkeit sind „nur“ 0,5 Prozent der Weltbevölkerung auf der Flucht. Ullrich Fichtner erläutert: „Solche Irrtümer häufen sich auch deshalb gern, weil wir Menschen mit großen Zahlen schlechter umgehen können, als wir denken. Wir meinen zwar mittlerweile, an die abstrakten Summen gewaltiger Staatsausgaben gewöhnt, mit Milliarden- und Millionenrechnungen selbstverständlich vertraut zu sein, aber das gehört in die Reihe der humanen Selbstüberschätzungen.“ Und übrigens: Die Menschen auf der Flucht wollen nicht alle nach Schweden oder Deutschland oder Großbritannien, keineswegs! Die meisten retten sich in ihre Nachbarländer, bleiben dort und hoffen auf baldige Rückkehr in die Heimat. Ullrich Fichtner ist Reporter des „Spiegel“ und gehört zu den renommiertesten Journalisten Deutschlands.
Der Krieg wirft alles nieder
Die vom Krieg entfesselte Zerstörungskraft löst soziale Bindungen auf und führt zu Zorn, Rache und Misstrauen. Es ist sogar unklar, ob Wiedergutmachung überhaupt noch möglich ist. Der Krieg unterminiert nicht nur die in der Vergangenheit aufgebauten Beziehung, sondern auch die Möglichkeit einer zukünftigen friedlichen Koexistenz. Sigmund Freud bemerkt: „Der Krieg wirft nieder, was ihm im Wege steht.“ Judith Butler fügt hinzu: „In der Nichtbeachtung von Einschränkungen liegt für ihn tatsächlich eines der Ziele des Krieges. Die Soldaten müssen die Erlaubnis zum Töten bekommen.“ Was der Krieg als Erstes zerstört, sind die Einschränkungen, denen die Zerstörung unterliegt. Das unausgesprochene Ziel des Krieges liegt in der Vernichtung der sozialen Grundlage der Politik selbst. Judith Butler ist Maxine Elliot Professor für Komparatistik und kritische Theorie an der University of California, Berkeley.
Parteien und Medien sollten weithin zugänglich sein
Wie sollten intermediäre Institutionen, insbesondere Parteien und Medien, also idealerweise beschaffen sein, um ihre Funktionen für die Demokratie zu erfüllen? Jan-Werner Müller antwortet: „Sie sollten weithin zugänglich sein, und der Zugang darf nicht zu einem Privileg für ohnehin Bessergestellte werden. Sie sollten auf Fakten basieren, selbst wenn Fakten, wie Hannah Arendt bemerkte, stets fragil sind.“ Außerdem sollten sie autonom sein – das heißt, nicht auf korrupte Weise von mehr oder weniger verborgenen Akteuren abhängen. Sie müssen für alle Bürger relativ klar einzuschätzen sein, sodass sie von ihnen auch zur Rechenschaft gezogen werden können. Wie leicht sollte es beispielsweise sein, eine politische Partei zu gründen? Viele Länder verlangen eine Mindestzahl an Mitgliedern und den Nachweis einer ernsthaften Absicht, sich an Wahlen zu beteiligen. Jan-Werner Müller ist Roger Williams Straus Professor für Sozialwissenschaften an der Princeton University.
Identitätspolitik darf keine Kampfzone sein
Es gibt das Kollektiv, und gleichzeitig ist dieses eine Illusion. Und damit ist Identitätspolitik auch etwas, das auf unterschiedliche Art und Weise von Menschen praktiziert wird. Übrigens auch von denjenigen, die das bisher Gängige zu schützen versuchen und wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Hadija Haruna-Oelker ergänzt: „Auch die Norm und ein was normal ist erhalten zu wollen beschreiben einen identitätspolitischen Zustand.“ Wie also miteinander umgehen, übereinander sprechen und miteinander sein? Am Ende geht es ganz simpel um diese Fragen. Hadija Haruna-Oelker plädiert dafür, nicht gleich eine Kampfzone daraus zu machen. Die erste Prämisse wäre: nicht davon ausgehen, dass es primär um Erlaubnisse oder Verbote geht. Hadija Haruna-Oelker lebt als Autorin, Redakteurin und Moderatorin in Frankfurt am Main. Hauptsächlich arbeitet sie für den Hessischen Rundfunk.
Das Eingeständnis eines Fehlers kann sich lohnen
In freiheitlichen Gesellschaften, in denen Journalisten recherchieren und die politische Konkurrenz aufpasst, haben Vertuschungsversuche von Politikern oft kurze Beine. Sie können sich als der größere Fehler erweisen. Aristoteles wird der Satz zugeschrieben: „Eine Fehler durch eine Lüge zu verdecken heißt, einen Flecken durch ein Loch zu ersetzen.“ Wenn man die Sache vom Ende her denkt, liegt ein guter Umgang mit Fehlern im eigenen Interesse. Helene Bubrowski meint: „Und auch kurzfristig kann sich das Eingeständnis eines Fehlers lohnen, denn oft nimmt er einer Empörungswelle die Spitze.“ Die meisten Entschuldigungen erfolgen aus Eigeninteresse – aus dem Kalkül, dass es weniger Nachteile hat, sich zu entschuldigen als es nicht zu tun. Die Bitte um Verzeihung dient aber letztlich doch auch einem gesellschaftlichen Zweck. Helene Bubrowski arbeitet als Politikkorrespondentin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung im Berliner Hauptstadtbüro.
Die Demokratie braucht mündige Bürger
Noch liegt der Großteil der notwendigen weiteren Entwicklungsschritte der Demokratie in den Händen der politischen Entscheidungsträger. Hans-Otto Thomashoff betont: „Doch eben auch wir Bürger können aktiv beitragen zur Sicherung, zum Erfolg und zur evolutionären Weiterentwicklung unseres Gesellschaftssystems. Das übergeordnete langfristige Ziel dabei muss es sein, die Lebensqualität möglichst weitgehend für möglichst alle in der Gesellschaft zu verbessern.“ Um die Demokratie zu schützen und sie nicht in die Hände radikaler Populisten von rechts oder links entgleiten zu lassen, ist es an erster Stelle wichtig, dass man sich selbst als erwachsener, mündiger Bürger seine eigene Meinung bildet. Eine solche fundierte Meinungsbildung zu den Werten, die eine Demokratie prägen und zu den Wegen, die zu diesen Werten führen, erlaubt es in der Regel dann auch an ihnen festzuhalten, wenn gelegentlich die Gefühle hochkochen. Hans-Otto Thomashoff ist Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychoanalyse in eigener Praxis in Wien.
Der politische Gehalt der Freiheit verändert sich ständig
Der politische Gehalt dessen, was Freiheit sein soll, hat sich im Lauf der Zeiten immer wieder verändert. Hans-Jürgen Papier blickt zurück: „Im klassischen Griechenland war die Demokratie Sache der Freien, Besitzenden und Gebildeten. Das schloss die große Mehrheit der Menschen aus. In den feudalen Gesellschaften des Mittelalters herrschten starke Hierarchien und eine unverrückbare Ordnung von Abhängigkeiten. Der Grad an Freiheit des einzelnen Menschen hing vom Grad seiner Macht ab.“ Einer überwiegenden Mehrheit unfreier Bauern stand eine sehr viel kleinere Gruppe von Freien, Lehnsherren und Lehnsleuten gegenüber. Die Lehnsleute wiederum waren ihren Lehnsherren als Vasallen verpflichtet, Dients und Gehorsam zu leisten. Da die Kirche nicht mehr wie im Römischen Reich Staatskirche war, gab es nebeneinander weltliche und kirchliche Herrscher und Hierarchien. Prof. em. Dr. Dres. h.c. Hans-Jürgen Papier war von 2002 bis 2014 Präsident des Bundesverfassungsgerichts.
Konflikte sind nicht problematisch
Jan-Werner Müller weiß: „Gleichheit, ob nun im sozialen Sinne oder im Sinne gleicher politischer Grundrechte, bedeutet nicht Unterschiedslosigkeit oder Homogenität.“ Das Gegenteil von Gleichheit ist nicht Vielfalt – die mit politischer Gleichheit vollkommen verträglich sein kann –, sondern Ungleichheit. Zudem verlangen weder politische noch soziale Gleichheit, dass Menschen immer einer Meinung wären. Eines der am weitesten verbreiteten Missverständnisse bezüglich demokratischer Politik der Gegenwart besagt, Spaltung und Konflikt wären an sich problematisch oder sogar gefährlich. Denn die Bürger haben ganz unterschiedliche Vorstellungen über ein gutes Leben für sich selbst und auch über das Gemeinwohl. Diese Unterschiede lassen sich nicht allein auf Irrationalität, mangelnde Information oder ein Fehlen der rechten politischen Bildung zurückführen. Jan-Werner Müller ist Roger Williams Straus Professor für Sozialwissenschaften an der Princeton University.
Ned O’ Gorman fordert ein Mehr an Politik
Ned O’ Gorman kritisiert politische Kurzsichtigkeit, Malaise und Missgunst. In seinem Buch „Politik für alle“ plädiert er nicht für ein Weniger, sondern für ein Mehr an Politik. Und er fordert, die Politik ernster zu nehmen, statt sie abzuschreiben und ihr eine wohlüberlegte Chance zu geben. Zu diesem Zweck untersucht Ned O’ Gorman das Werk einer der prononciertesten Fürsprecherin der Politik im 20. Jahrhundert: Hannah Arendt (1906 – 1975). Die in Deutschland geborene Jüdin floh in den 1930er-Jahren vor den Nazis und ließ sich in den Vereinigten Staaten nieder. Von nun an arbeitete sie dreißig Jahre lang an „Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft“, einer scharfen Analyse des Totalitarismus. Sie schrieb zudem viele andere Bücher und Artikel, deren Themen von der Revolution bis zur Verantwortung des Menschen für den Erhalt der Welt reichten. Ned O’ Gorman ist Professor für Kommunikationswissenschaften an der University of Illinois.
Die überwiegende Mehrheit will die liberale Demokratie
Liberale Demokratien können ein Vorbild und zuweilen ein Schreckbild abgeben. Trotzdem möchte, quer durch die europäischen Mentalitäten, nur eine winzige Minderheit die demokratische Epoche beenden, die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts begann. Roger de Weck fügt hinzu: „Die überragende Mehrheit will die wirkliche, die liberale Demokratie. Wobei viele spüren, ohne diesem Gefühl eine klare Richtung geben zu können: Wie bisher sollte es nicht weitergehen.“ Das Emporschnellen der Autoritären ist eine Warnung und bald eine ernste Gefahr, falls das Alarmzeichen übersehen wird. Die Erfahrung der Hybris und Inkompetenz von Autoritärdemokraten ist aber gleichzeitig eine Chance – ein Ansporn, sich um die Zukunft einer handlungsfähigen liberalen Demokratie zu bemühen. Kommt erst einmal noch mehr Autoritarismus? Roger de Weck ist ein Schweizer Publizist und Ökonom.
Die Demokratie ist der einzige Weg zur Gerechtigkeit
Politische Gleichheit darf man nicht opfern. Danielle Allen betont: „Meiner Meinung nach ist die Demokratie der Weg zur Gerechtigkeit, und zwar der einzige.“ Es mag zwar sein, dass mildtätige Autokraten für materiellen Wohlstand in der Bevölkerung sorgen, aber sie werden qua Definition niemals die Grundlage für volles menschliches Wohlergehen schaffen. Und deshalb niemals vollumfängliche Gerechtigkeit erreichen. Dennoch gibt es zum Trotz immer Menschen, die einen anderen Weg wählen und auf Demokratie verzichten. Das nimmt Danielle Allen als unvermeidliche Gegebenheit des Lebens hin. Richtig verstandene Gerechtigkeit beruht auf politischer Gleichheit und den ihr zugrunde liegenden Institutionen. Danielle Allen ist James Bryant Conant University Professor an der Harvard University. Zudem ist sie Direktorin des Edmond J. Safra Center for Ethics in Harvard.
Kooperation ist die Grundlage des Gemeinwohls
Der Grundsatz, wonach Menschen durch Kooperation viel mehr erreichen können, als wenn sie allein arbeiten, ist seit Langem anerkannt. Auch die Verfassung der Vereinigten Staaten zeigt, dass die Bürger der gerade unabhängig gewordenen Bundesstaaten die Notwendigkeit kollektiven Handelns einsahen. Josef Stiglitz ergänzt: „Das gemeinsame Handeln schuf die Grundlage des Gemeinwohls, und es geschah nicht nur durch freiwillige Zusammenschlüsse, sondern auch auf Geheiß der Regierung, mit all den Machtbefugnissen, über die sie verfügte.“ Das gesellschaftliche Wohlergehen förderten nicht nur Bauern und Händler, die ihre eigenen Interessen verfolgten. Dazu trug auch eine starke Regierung bei, deren Befugnisse genau definiert und dadurch auch begrenzt waren. Joseph Stiglitz war Professor für Volkswirtschaft in Yale, Princeton, Oxford und Stanford. Er wurde 2001 mit dem Nobelpreis für Wirtschaft ausgezeichnet.
Deutschland hat sich zum Bevormundungsstaat entwickelt
Deutschland wird für einen Menschen, dem Freiheit viel bedeutet, immer unerträglicher. Verglichen mit Deutschland ist der Sozialstaat in der Schweiz noch vernünftig dimensioniert. Reinhard K. Sprenger stellt fest: „Aber nirgendwo in Europa wachsen die Sozialbudgets proportional so wie in der Schweiz. Der wesentliche Unterschied liegt zwischen „geben“ und „nicht nehmen“. In Deutschland nimmt mir der Staat viel weg und gibt mir dann etwas davon zurück.“ Natürlich abzüglich der Kosten für die Umverteiler selbst. In der Schweiz nimmt der Staat nicht so viel und lässt seine Bürger wählen, welche Dienstleistungen sie kaufen wollen. Das ist schon respektvoller. Der deutsche Staat hat sich verselbstständigt, er hat sich vom Rechtsstaat zum Bevormundungsstaat entwickelt. Reinhard K. Sprenger, promovierter Philosoph, ist einer der profiliertesten Führungsexperten Deutschlands.
Es gibt einen Mythos der milden Diktatoren
„Kein Mensch bekämpft die Freiheit. Er bekämpft höchstens die Freiheit des anderen. Jede Art der Freiheit hat daher immer existiert, nur einmal als besonderes Vorrecht, das andere Mal als allgemeines Recht“, schrieb Karl Marx am 12. Mai 1842. Freiheit für alle oder nur für Wenige? Roger de Weck erklärt: „Die Wenigen schätzen eben die Freiheit für Wenige, weil sie riesengroß ist. Weil sie auf die Vielen keine Rücksicht nehmen müssen.“ Nicht nur in Italien hängen sie am Mythos der milden Diktatoren, da „ohne Ordnung keine Freiheit“. Im Handumdrehen ließen sich Konservative und Liberale von Autokraten einwickeln. Zum Beispiel als 1922 in Rom das bürgerliche Parlament Benito Mussolini eine Blankovollmacht erteilte. Er versprach eine „befreiende Gewalt“. Roger de Weck ist ein Schweizer Publizist und Ökonom.
Es gibt keinen Kampf der Kulturen
Der Kampf der Kulturen ist für Amartya Sen eine ausgesprochen globale These über Konflikte. Doch es gibt auch bescheidenere, aber ebenfalls einflussreiche Behauptungen. Auch nach diesen hängen die vielen Konflikte und Gräuel, die man heute in verschiedenen Teilen der Welt beobachtet, mit Gegensätzen von Kulturen und Identitäten zusammen. In den kleineren Varianten dieses Ansatzes sind es lokale Bevölkerungen, die in zerstrittene Gruppen mit unterschiedlicher Kultur und Geschichte zerfallen. Daraus erwächst quasi „naturwüchsig“ eine gegenseitige Feindschaft. Moderne Konflikte sind ohne Berücksichtigung aktueller Ereignisse und Machenschaften nicht zu verstehen. Auf diese Weise bläst man sie zu uralten Fehden auf, in denen die heutigen Akteure in angeblich altüberkommenen Dramen in vorherbestimmten Rollen auftreten. Amartya Sen ist Professor für Philosophie und Ökonomie an der Harvard Universität. Im Jahr 1998 erhielt er den Nobelpreis für Ökonomie.
Das Grundgesetz hat Deutschland ganz wesentlich geeint
Pluralistische Gesellschaften, wie die deutsche, werden nicht mehr vorrangig durch gemeinsame Tradition, Religion oder Kultur zusammengehalten. Hans-Jürgen Papier weiß: „Sie finden stattdessen in der Anerkennung der Verfassung, ihrer Werteordnung und des demokratisch gesetzten Rechts ihre verbindende Grundlage. Auf sie kann sich die Mehrheit der Bevölkerung beziehen, genau wie es die Minderheiten können.“ Für die Bundesrepublik Deutschland lässt sich sagen, dass das Grundgesetz die deutsche Gesellschaft über die Jahrzehnte ganz wesentlich geeint hat. Es hat die Freiheiten definiert und Verfahrensweisen vorgegeben, die es Politik und Gesetzgebung ermöglichen, den sozialen Konsens im Abgleich mit den zivilgesellschaftlichen Diskursen weitgehend offen zu gestalten. Auch heute noch erweist sich die deutsche Verfassung als tragfähiges Gebäude mit den Grundrechten als stützende Pfeiler. Prof. em. Dr. Dres. h.c. Hans-Jürgen Papier war von 2002 bis 2014 Präsident des Bundesverfassungsgerichts.
Die Politik muss für das Wohlgefühl der Bürger sorgen
Das Potenzial, mithilfe abstrakter Vorstellungen gemeinsame Ziele und Perspektiven zu entwickeln und dadurch Verbundenheit und Identität zu fördern, besitzt auch die Politik. Hans-Otto Thomashoff kritisiert: „Aber sie lässt es bei uns seit Jahrzehnten weitgehend ungenutzt.“ Dabei kann Politik Hoffnungen wecken, Visionen, für die die Menschen bereit sind, sich einzubringen. Was als Idee beginnt, kann, einmal entfacht, zu einer Neugestaltung gesellschaftlichen Miteinanders werden, zu einer Revolution – im Guten wie im Schlechten. Eine zukunftsorientierte Politik sollte bewusst und gezielt an der Weiterentwicklung der Gesellschaft arbeiten. Hierzu muss sie Anstoß geben zum Fantasieren, zum Diskutieren und zum konkreten Umsetzen. Sie sollte berücksichtigen, was Menschen brauchen, um sich im Leben wohlzufühlen. Und das ist eben mehr als nur die Absicherung der wirtschaftlichen Existenz. Hans-Otto Thomashoff ist Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychoanalyse in eigener Praxis in Wien.
Die Kernenergie ist sowohl klimafreundlich als auch gefährlich
Ulrike Guérot möchte kurz daran erinnern, dass Atomkraft in Deutschland lange Zeit von einer großen Mehrheit für sicher, sauber und mithin für eine gute Energiequelle gehalten worden ist. In vielen Länder – etwa China und Frankreich – ist das noch heute so und es gibt dafür durchaus gute, wissenschaftliche Argumente. Zum Beispiel ist die Kernenergie laut Ulrike Guérot sehr klimafreundlich, weswegen Frankreich sie in der EU-Taxonomie als „nachhaltig“ einstufen möchte. Die Kernenergie kann möglicherweise unter dem Prisma der Klimaneutralität nachhaltig sein. Das heißt allerdings keineswegs, dass sie nicht anderweitig gefährlich oder umweltschädlich ist, etwa mit Blick auf die Reaktorsicherheit oder die Endlager. Am Ende ist es eine Frage der Bewertung und die hängt wiederum davon ab, auf welches Kriterium man schaut. Seit Herbst 2021 ist Ulrike Guérot Professorin für Europapolitik der Rheinischen-Friedrichs-Wilhelms Universität Bonn.
In der Politik wurde immer schon gelogen
Bei der Gegenwart, so kann man lesen, handelt es sich um ein postfaktisches Zeitalter. Konrad Paul Liessmann stellt fest: „Ungeniert können Populisten Lügen verbreiten, ihre Anhänger wissen das und jubeln trotzdem oder vielleicht gerade deshalb.“ Dem Wahrheitsfreund graut, zumal er ja, so muss man den erschütterten Kommentaren zur „post-truth politics“ entnehmen. Denn er ist in einer Zeit groß geworden, in der Wahrheit in der Politik noch eine entscheidende Kategorie war und sich die Wähler an den besseren und faktengetreuen Argumenten orientierten. Natürlich stimmt diese in die Vergangenheit projizierte Idylle nicht. In der Politik wurde immer schon gelogen und immer schon haben die Anhänger diese Politik das augenzwinkernd akklamiert. Konrad Paul Liessmann ist Professor emeritus für Philosophie an der Universität Wien, Essayist, Literaturkritiker und Kulturpublizist.
Angst ist in der Politik ein Tabu
Wenn Politiker über ihre Fehler sprechen, ist es ein bisschen so, wie wenn man Kandidaten im Bewerbungsgespräch nach ihren Schwächen fragt. Sie sagen irgendetwas, das so klingt wie eine Schwäche, aber in Wahrheit eine Stärke ist. Helene Bubrowski nennt Beispiele: „Ungeduld ist ein Klassiker oder: Ich bin so streng mit mir.“ Beliebt ist auch die Ausflucht in Koketterie. Angst ist in der Politik ein Tabu. Jeder Politiker trägt sie mit sich herum, aber man versteckt sie in der Handtasche, dem Aktenkoffer, Jutebeutel oder Rucksack. Wer würde schon einen Angsthasen wählen? Die meisten Politikberater geben die übliche Empfehlung, sich möglichst unangreifbar zu geben. Das hat auch einen Preis, den man nicht übersehen darf: Die Sprache wirkt seelenlos, sie kommt nicht mehr bei den Leuten an. Helene Bubrowski arbeitet als Politikkorrespondentin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung im Berliner Hauptstadtbüro.
Die Demokratie hat sich als sehr widerstandsfähig erwiesen
Roger de Weck kritisiert: „Der Nationalismus befeuert den Verteilungskampf zwischen Partner und Nachbarn. Der Ultrakapitalismus bringt Umverteilung zugunsten von Reichen und Superreichen. Die Digitalisierung schafft Räume der Hemmungslosigkeit, sei es in den sozialen Medien, sei es in der Weltwirtschaft.“ Die triumphale Rückkehr der Rücksichtslosigkeit signalisiert, dass nicht nur der Zweite Weltkrieg, sondern schleichend auch die Nachkriegszeit in Vergessenheit gerät. Allerdings wirkt sie noch in die Gegenwart hinein. Europa hat bislang weder die soziale Marktwirtschaft vollends abgeschrieben noch die Evidenz verlernt, dass die Nation für die großen Probleme zu klein und für die kleinen Probleme zu groß ist, wie der Soziologe Daniel Bell schrieb. Und in vielen Ländern haben sich die bedrängten Institutionen der Demokratie als außerordentlich widerstandsfähig erwiesen. Roger de Weck ist ein Schweizer Publizist und Ökonom.
Terror und Gewalt führen zu keiner stabilen Macht
Gewalt und Macht lassen sich mit Hannah Arendt dadurch unterscheiden, dass Erstere prozessual, dynamisch und zeitlich begrenzt ist. Letztere stellt dagegen eine strukturelle Größe dar, die dauerhaft, und, was fast dasselbe ist, institutionalisiert ist. Gewalt ist ein Komplement von Macht, insofern sie, wie Michel Foucault dargelegt hat, auf einem System von möglichen psychischen und/oder physischen Bestrafungen basiert, die gleichsam den symbolischen Horizont aller Macht bildet. Wolfgang Müller Funk ergänzt: „Das, was als politischer Körper bezeichnet wird, wäre gewissermaßen der Foucaultsche Aspekt des Zusammenhangs von Macht und Gewalt. Jenseits der Befunde des französischen Denkers besteht der Verdacht, dass keine Macht, die allein auf Terror und Gewalt beruht, dauerhaft stabil ist. Wolfgang Müller-Funk war Professor für Kulturwissenschaften in Wien und Birmingham und u.a. Fellow an der New School for Social Research in New York und am IWM in Wien.
Das Ende des Kalten Krieges ging tendenziell gewaltfrei vonstatten
Nach dem überraschenden Ende des Kalten Krieges, der Europa vier Jahrzehnte lang in Bann gehalten hatte, schien vieles möglich, was zuvor als ausgeschlossen galt. Denn die Umwälzung dieses Ausmaßes ging tendenziell gewaltfrei vonstatten. Zudem konnte ein waffenstarrendes System buchstäblich über Nacht implodieren. Die Politik löste die eben noch schwer bewachten Grenzen mit einer nie erlebten Leichtigkeit auf. Herfried Münkler fügt hinzu: „Die bewaffnete Konfrontation beider Blöcke hatte sich binnen weniger Monate in nichts aufgelöst, und die vormaligen Feindschaften erschienen mit einem Mal als ein einziges großes Missverständnis.“ Von diesem wusste im Nachhinein keiner mehr so recht zusagen, weswegen es eigentlich so lange das politische Denken und Empfinden beider Seiten bestimmt hatte. Herfried Münkler ist emeritierter Professor für Politikwissenschaft an der Berliner Humboldt-Universität. Viele seiner Bücher gelten als Standardwerke, etwa „Imperien“ oder „Die Deutschen und ihre Mythen“.