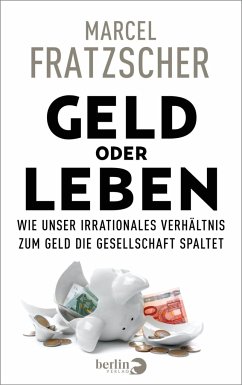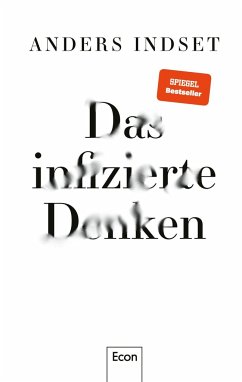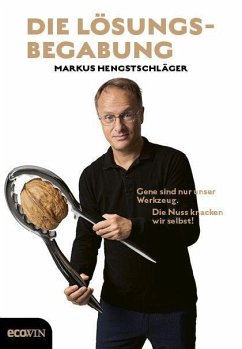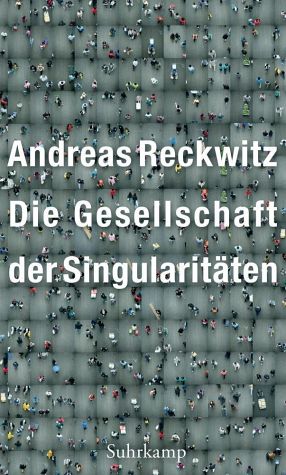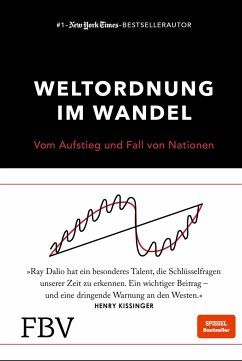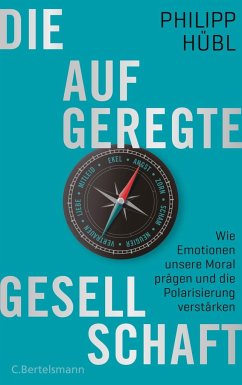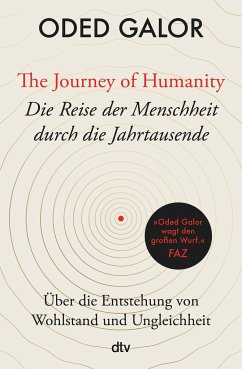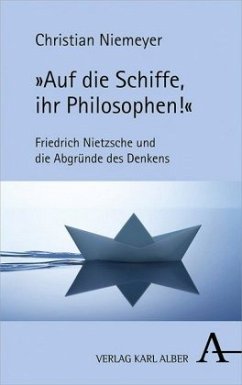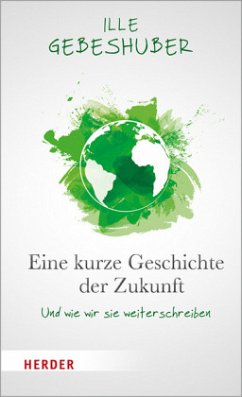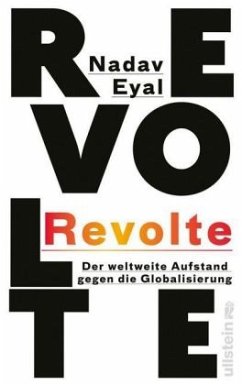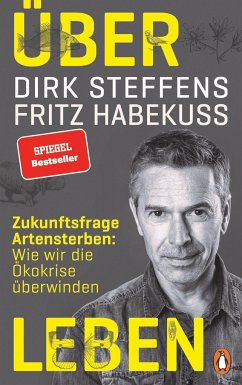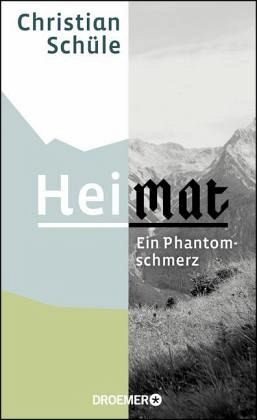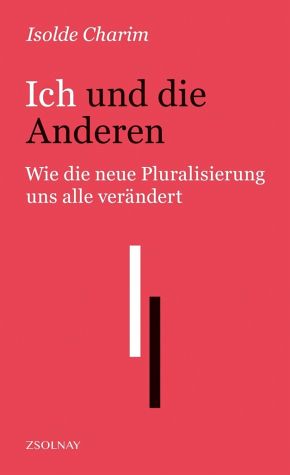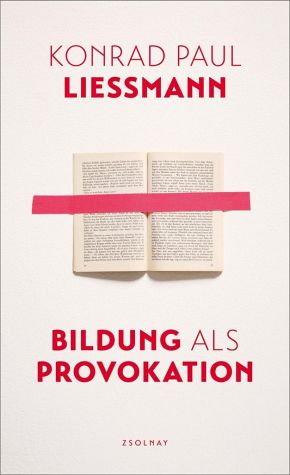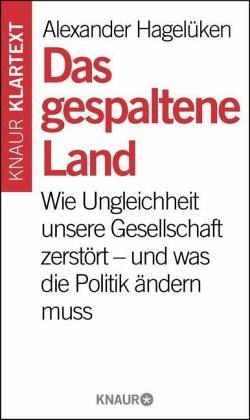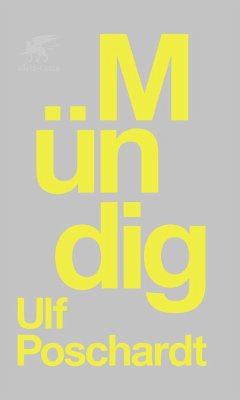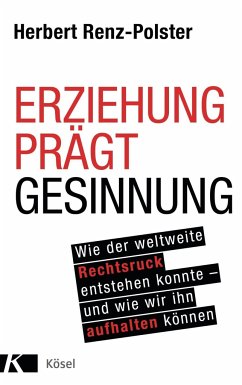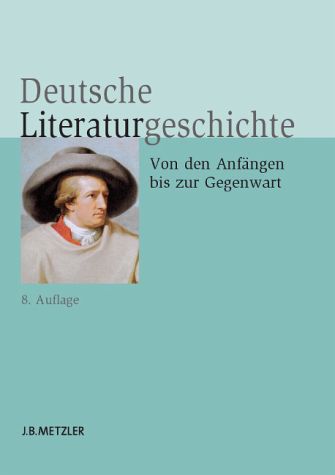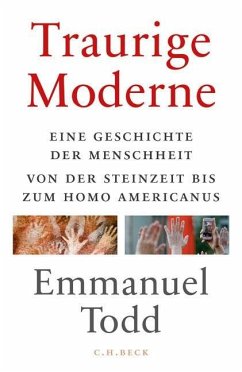Es gibt viele Beispiele, bei denen Schulden von Privatpersonen weder moralisch noch ökonomisch verwerflich erscheinen. Marcel Fratzscher nennt Beispiele: „Schulden für Investitionen in die eigene Qualifikation oder die Bildung der Kinder, für das Eigenheim oder das eigene Unternehmen sind in den meisten Fällen gute Investitionen.“ Nun mag man einwenden, dass selbst solche Schulden nicht immer sinnvoll sein müssen, vor allem nicht dann, wenn die Schuldner sie langfristig nicht zurückzahlen können. Es gibt also verschiedene Facetten, wann und unter welchen Umständen Schulden sinnvoll und notwendig sind und wann nicht. In zahlreichen Fällen sind höhere Schulden kurzfristig notwendig und richtig, um sie langfristig schneller abbauen zu können. Marcel Fratzscher ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) und Professor für Makroökonomie an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Bildung
Viele Menschen werden in starre Lebensläufe gezwungen
Sogenannte „Fachidioten“ führen ihre Follower in die Gefangenschaft der eigenen Selbstverständlichkeiten. Diese verleiten zu einem sehr gegrenzten Handeln. Die „Filter-Bubble“ ist nicht nur ein Phänomen des Digitalen, sondern zeigt sich auch im Analogen, in der Bildung. Anders Indset kritisiert: „Die Wissensgesellschaft ist ein Produkt des fatalen Nickerchens, in der trotz der Aktivierung und der Aufbruchstimmung der Sechzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts die Menschen im Wesentlichen in starre und vorbestimmte Lebensläufe gezwungen werden.“ Der Lebensplan steht bereits in der Kindheit fest. Man weiß, was einen im Leben erwartet – der Job wartet. So dient die sich zur Absolutheit gesteigerte Wissensgesellschaft der Förderung der Wirtschaft und des ökonomischen Wachstums. Auf einem kontrollierten und messbaren Bildungsweg begeben sich die Menschen in ein Leben der Konformität. Anders Indset, gebürtiger Norweger, ist Philosoph, Publizist und erfolgreicher Unternehmer.
Die Bildung prägt die Persönlichkeit eines Menschen
Auf formaler Ebene fasst man Bildung einerseits als ein Produkt, als die Ausprägung der Persönlichkeit eines Menschen, auf. Und andererseits beschreibt der Begriff „Bildung“ auch den Prozess, wie diese Persönlichkeitsausprägungen vermittelt werden. Markus Hengstschläger erklärt: „Auf inhaltlicher Ebene gilt es zu fragen, welche Persönlichkeitsausprägungen gesellschaftlich wünschenswert sind. Gerade die Ansichten darüber ändern sich aber mit der Zeit.“ Es gab Zeiten, in denen abrufbares Faktenwissen dabei im Vordergrund stand. Heute wird neben fachlichen Qualifikationen immer mehr auch auf soziokulturelle Kompetenzen Wert gelegt. Unter Kompetenzen versteht man in der Regel Fähigkeiten und Fertigkeiten, die es ermöglichen zu handeln, Situationen zu bewältigen, Aufgaben auszuführen und Probleme zu lösen. Was man unter „Wissen“ versteht, ist in der heutigen Zeit oft Inhalt unendlich erscheinender Diskussionen. Professor Markus Hengstschläger ist Vorstand des Instituts für Medizinische Genetik an der MedUni Wien.
Erziehung und Bildung erleben einen sozialen Wandel
Das Engagement, das Erziehung und Schule in den Familien der akademischen Mittelklasse seit den 1990er Jahren beansprucht, ist immens. Andreas Reckwitz erläutert: „Der alltägliche Umgang mit den Kindern, ihre Förderung und Begleitung ihrer Schullaufbahn erreichen eine ausgeprägte Intensität.“ Erziehung und Schule sind der Ort, an dem sich die beiden wichtigsten Motive der Lebensführung der Akademikerklasse, aufs Engste miteinander verbinden. Nämlich ihr Wunsch nach Selbstentfaltung und das Streben nach sozialem Prestige. In der industriellen Moderne stellte die Schule ein herausragendes gesellschaftliches Feld der formalen Rationalisierung und Standardisierung dar. Die soziale Logik des Allgemeinen und des Gleichen war prägend. Die Massenbildung ist eine „industrielle“ Bildung gewesen und ist es nach wie vor. Andreas Reckwitz ist Professor für Kultursoziologie an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt / Oder.
Das Wissen verwandelt sich zum neuen Öl
Die Einbildung ist der Todesstoß der Bildung. Statt nachhaltigem Lernen, Wachsen und Versehen heißt es Verbildlichen und Liken. Sogar in der Mathematik und Physik zieht man ästhetische Modelle und Hypothesen vor. Anders Indset stellt fest: „Wir brauchen diese Kompensation, da sie uns Stabilität und Halt gibt, aber gleichzeitig macht sie uns starr und schafft eine trügerische Ruhe. Wir sterben in Schönheit, leben aber nicht den Fortschritt.“ Das starre Wissen, das man in bestimmten Institutionen vermittelt bekommt, setzt man absolut. Es wird für den einen abschließenden Test gelernt. Befristetes Wissen führt zur Qualifikation und Bildung zum sozialen Grad. Das heutige Bildungssystem ist ein endliches Modell, das auf Speichern von Daten ausgerichtet ist. Anders Indset, gebürtiger Norweger, ist Philosoph, Publizist und erfolgreicher Unternehmer.
Es gibt circa 18 Messgrößen für die Stärke eines Landes
Die Kerngröße für Wohlstand und Macht entspricht in etwa dem Durchschnitt aus 18 Messgrößen für die Stärke eines Landes. Zu den zentralen Werten zählt Ray Dalio Bildung, Wettbewerbsfähigkeit, Innovation und Technologie, Wirtschaftsleistung, Anteil am Welthandel, militärische Stärke, Bedeutung als Finanzzentrum und Reservewährungsstatus. Die gängige Reservewährung – ebenso wie die Weltsprache – hatte in aller Regel noch Bestand, als der Niedergang eines Imperiums bereits eingesetzt hatte. Denn man verwendete sie auch noch weiter, als die Stärken, die zu dieser breiten Verwendung geführt hatten, schon geschwunden waren. Ray Dalio hebt noch einmal hervor, dass all diese Messgrößen für Stärke eines Imperiums erst zu- und dann abnehmen. Ray Dalio ist Gründer von Bridgewater Associates, dem weltgrößten Hedgefonds. Er gehört mit zu den einflussreichsten Menschen der Welt.
Die Gesellschaft ist nicht gebildet sondern eingebildet
Auch wenn zunehmend neue Bildungskonzepte entstehen, hat man es größtenteils mit einer Gesellschaft zu tun, die einen traditionellen Ansatz der Bildung verfolgt. Dort manifestiert man Absolutheiten. Man legt keinen Wert auf das Lernen, das Miteinander oder das Wohl der zukünftigen Generationen. Sondern man fördert ausschließlich die Optimierung eines Individuums, die Vorbereitung auf Karriere und Wettkampf. Anders Indset kritisiert: „So sind wir eingebildet. Unsere Gesellschaft ist eingebildet. Wir meinen, wir seinen gebildet. Doch letztlich bilden wir uns das nur ein.“ Der Begriff „Bildung“ ist ausgehöhlt, nichtssagend. Er ist tragischerweise zu einem prätentiösen Begriff geworden. Man kokettiert und schwadroniert mit ihm. Es fallen Aussagen wie „Bildungsrepublik“, „Wir müssen mehr in Bildung investieren“, „Bildung ist der Schlüssel zum Erfolg“. Anders Indset, gebürtiger Norweger, ist Philosoph, Publizist und erfolgreicher Unternehmer.
Hoher Bildungsstand sorgt für moralischen Fortschritt
Bildung ist ein wichtiger Faktor für moralischen Fortschritt. Deutsche mit niedriger Bildung sind eher menschenfeindlich. Sie lehnen beispielsweise Muslime zu 24 Prozent oder Langzeitarbeitslose zu 55 Prozent ab. Bei Deutschen mit einem hohen Bildungsstand liegt dieser Anteil bei 8 und bei 35 Prozent. Philipp Hübl ergänzt: „Auch die Anfälligkeit für populistische Parteien befindet sich bei Deutschen mit niedriger und mittlerer Bildung über dem Durchschnitt, bei Hochgebildeten darunter.“ Der Bildungsstand hängt jedoch nicht unmittelbar von den emotionalen Dispositionen ab. Daher ist es naheliegend, dass man mit der Erziehung ein progressives Emotionsprofil erworben oder als Nebeneffekt emotionale Selbstkontrolle erlernt hat. Noch wahrscheinlicher ist, dass man eingesehen hat, dass Fairness und Mitgefühl vernünftig und allgemein geboten sind, weil man sie auch von anderen für sich selbst erwartet. Philipp Hübl ist Philosoph und Autor des Bestsellers „Folge dem weißen Kaninchen … in die Welt der Philosophie“ (2012).
In Deutschland herrscht eine geringe Chancengleichheit
Die Ungleichheit bei den Markteinkommen in Europa zählt hierzulande zu den höchsten und ist fast so hoch wie in den USA. Das reflektiert eine geringe Chancengleichheit und damit auch eine niedrige soziale Mobilität. Marcel Fratzscher weiß: „Das liegt darin begründet, dass das Einkommen der Spitzenverdiener überwiegend aus Unternehmensbesitz resultiert. Fast 80 Prozent dieser Unternehmen befinden sich in der Hand von Familien.“ Diese können ihren Besitz dank großzügiger Ausnahmeregelungen der Erbschaftssteuer fast steuerfrei an die nächste Generation weitergeben. Zum anderen sind die zu geringe Qualität und die fehlende Inklusion innerhalb des Bildungssystems eine Ursache dafür. In Deutschland hängen die Bildungs- und Berufschancen nur sehr begrenzt von den Talenten und Fähigkeiten der jungen Menschen, sondern viel mehr von Einkommen und Bildungsgrad ihrer Eltern ab. Marcel Fratzscher ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) und Professor für Makroökonomie an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Die Lebensqualität hat sich dramatisch verbessert
Vor dem Erscheinen des Homo sapiens als eigene Spezies vor fast 300.000 Jahren, war das Leben der Menschen bestimmt von Überlebensinstinkt und Vermehrungstrieb. Der Lebensstandard entsprach mehr oder weniger dem Existenzminimum und veränderte sich weltweit im Lauf der Jahrtausende kaum. Oded Galor stellt fest: „Erstaunlicherweise haben sich jedoch unsere Daseinsbedingungen in den letzten paar Jahrhunderten radikal gewandelt. Im Verhältnis zur langen Geschichte unserer Spezies hat die Menschheit praktisch über Nacht eine dramatische und beispielslose Verbesserung der Lebensqualität erfahren.“ Lange herrschte die Ansicht vor, die Lebensstandards seinen schrittweise über die gesamte Menschheitsgeschichte hinweg gestiegen. Doch das ist ein verzerrtes Bild. Oded Galor ist israelischer Wirtschaftswissenschaftler und mehrfach ausgezeichneter Professor an der Brown University, USA. Er forscht vor allem zum Thema Wirtschaftswachstum.
Wahrheit ist der Wille der Überwältigung
Für Friedrich Nietzsche bedeutet der Wille zur Wahrheit: „Ich will nicht täuschen, auch mich selbst nicht.“ Und hiermit befindet er sich auf dem Boden der Moral. Im Nachlass vom Herbst 1887 findet sich sogar noch eine Steigerungsform. Wahrheit sei ein Name „für den Willen der Überwältigung. Wahrheit hineinlegen, als ein aktives Bestimmen, nicht als Bewusstsein von etwas, das an sich fest und bestimmt wäre. Es ist ein Wort für den Willen zur Macht.“ Christian Niemeyer weist darauf hin, dass man gegen diese Pointe das Bedenken vortragen könnte, Friedrich Nietzsche moralisiere hiermit das Wahrheitsproblem. Und er verfehle die in seinem Grundansatz an sich die sehr viel zwingendere Psychologisierung des Moralbegriffs. Der Erziehungswissenschaftler und Psychologe Prof. Dr. phil. habil. Christian Niemeyer lehrte bis 2017 Sozialpädagogik an der TU Dresden.
Das deutsche Steuersystem ist ungerecht
Wie kann es sein, dass in einem so reichen Land wie Deutschland so viele Menschen nur wenig oder gar keine Ersparnisse bilden können? Marcel Fratzscher nennt zentrale Gründe: „Der erste zentrale ist die Einkommensungleichheit. Denn nicht nur bei den Vermögen, sondern auch bei den Einkommen ist die Schere in den letzten dreißig Jahren weiter auseinandergegangen.“ Die einkommensschwächsten 20 Prozent der Bevölkerung haben vom allgemeinen Anstieg der Einkommen nicht profitiert. Sie gingen leer aus. Noch schlimmer: Betrachtet man nur die letzten beiden Jahrzehnte, dann muss diese Gruppe sogar fallende reale Einkommen hinnehmen. Das hat Auswirkungen. Wenn Einkommen stagnieren oder sogar fallen, dann versuchen Menschen als Erstes, ihren Lebensstandard zu sichern. Marcel Fratzscher ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) und Professor für Makroökonomie an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Jeder Mensch sollte einige Grundregeln beherrschen
Eine Flut von Wissen ist für Ille C. Gebeshuber genauso schlecht wie fanatischer, blinder Glaube, der nichts hinterfragt. Deshalb ist es notwendig, das in der generellen Ausbildung das additive Wissen der Wissenschaft durch mutatives, also angepasstes Wissen zu ersetzen. Dieses reduziert man auf ein klares, aber anwendbares Minimum. Dabei ist es im Prinzip nur notwendig, ein gesichertes Maß an Grundregeln zu besitzen. Daneben sollte man die Regeln kennen, mit denen die verfügbaren Informationen zu neuem Wissen zusammengefügt werden können. Ille C. Gebeshuber erklärt: „Mit der Erfahrung einiger Lebensjahre können wichtige Zusammenhänge so selbst erkannt und verstanden werden.“ Den riesigen Haufen an Wissen, der überall verfügbar ist, kann man zur Überprüfung der eigenen Schlüsse heranziehen. Ille C. Gebeshuber ist Professorin für Physik an der Technischen Universität Wien.
Ideen verbesserten die Umstände des Menschseins
Die Umstände des Menschseins verbesserten sich nicht dank eines kosmischen Ereignisses oder eines Geschenks der Götter. Es waren Ideen, die alles veränderten. Ideen, die der wissenschaftlichen Revolution und der Aufklärung zugrunde lagen. Die Rettung der Menschheit aus dem erschütternden Elend ihrer Vorväter kam mit der Anerkennung von Gedankenfreiheit. Ebenso wichtig war die Befreiung von Knechtschaft und Aberglaube. Dazu kam noch die Zerschlagung des kirchlichen Monopols durch das Wissen und die Achtung der Autonomie des Individuums. Nadav Eyal ergänzt: „Die Werte der Aufklärung, darunter Freiheit und Gerechtigkeit, bildeten die Grundstein für den Aufbau sozialer Einrichtungen und den Schutz privaten Eigentums.“ Sie brachten einen erheblichen Fortschritt in die Lebensumstände der Menschen. Nadav Eyal ist einer der bekanntesten Journalisten Israels.
Bildung begrenzt das Bevölkerungswachstum
Dirk Steffens und Fritz Habekuss erklären: „Bildung und Wohlstand begrenzen das Bevölkerungswachstum der Menschheit. Doch sie tragen in sich den Keim für einen noch weit zerstörerischen Kern in sich.“ Der Erdsystemforscher Will Steffen warnt und rechnet vor: „Bevölkerung mal Reichtum mal Technologie ergibt in Summe ein Maß für den Impact, den eine Gesellschaft auf der Erde hat. Der Faktor Bevölkerung ist dabei vielleicht der am wenigsten wichtige, denn der Konsum wächst davon unabhängig.“ Man kann nicht einfach die Zahl der Menschen mit dem Schaden für die Umwelt gleichsetzen, denn das würde die Tatsachen völlig auf den Kopf stellen. In ihrem Buch „Über Leben“ erzählen der Moderator der Dokumentationsreihe „Terra X“ Dirk Steffens und Fritz Habekuss, der als Redakteur bei der „ZEIT“ arbeitet, von der Vielfalt der Natur und der Schönheit der Erde.
Es ist eine neue Unterklasse entstanden
Spiegelbildlich zum Aufstieg der neuen Akademikerklasse ist eine neue Unterklasse entstanden. Denn die Expansion einfacher Dienstleistungsberufe und einer neuen geringqualifizierten Dienstleistungsklasse ist ein ebenso wichtiges Merkmal der postindustriellen Sozialstruktur. Andreas Reckwitz stellt fest: „Die neue Unterklasse insgesamt ist eine durchaus heterogene Gruppe von einfachen Dienstleistern, semiqualifizierten Industrieberufen, prekär Beschäftigten, Arbeitslosen und Sozialhilfeempfängern.“ Diese machen gegenwärtig ebenfalls etwa bis zu einem Drittel der westlichen Bevölkerung aus. Sie bewegt sich hinsichtlich ihres Einkommens, Vermögens und sozialen Status deutlich unterhalb des Niveaus der alten Mittelstandsgesellschaft. Die gesellschaftlichen Ursachen für ihre Entstehung sind spiegelbildlich zu jenen, welche die Ausbildung der neuen Mittelklasse befördern. Die Umwälzung zur postindustriellen Ökonomie bedeutet beispielsweise eine rapide Erosion der Industriearbeiterschaft. Andreas Reckwitz ist Professor für Kultursoziologie an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt / Oder.
Die Singularitäten prägen die Spätmoderne
Die Etablierung einer postindustriellen Ökonomie der Singularitäten und der Aufstieg der digitalen Kulturmaschine bilden das strukturelle Rückgrat der spätmodernen Gesellschaft der Singularitäten. Das spätmoderne Selbst unterscheidet sich grundlegend von jenem Sozialcharakter, der die klassische Moderne der Industriegesellschaft dominierte. Seit den 1980er Jahren sind darüber eine Reihe prominenter soziologischer Analysen veröffentlicht worden. Dazu zählt Andreas Reckwitz Ulrich Becks Arbeiten zur Selbstreflexion und zum Risikobewusstsein von Bastelbiografien. Zu nennen sind auch Anthony Giddens` Analysen zum hochmodernen Selbst als Projekt. Ebenso dazu gehört Zygmunt Bauman These der „flüssigen“, vor allem am Konsum orientierten Identitäten. Beispielhaft sind auch Richard Sennetts Arbeiten zur umfassenden Flexibilisierung spätmoderner Lebensformen und Manuel Castells These vom Netzwerk-Subjekt. Andreas Reckwitz ist Professor für Kultursoziologie an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt / Oder.
Integration braucht den Willen zur Zuwendung
Neben „Bildung“ geht vielen Zeitgenossen nur noch ein Begriff aus dem Arsenal spätmoderner Problemlösungsrhetorik schneller über die Lippen: Integration. Als wäre mit dem Aussprechen des Worts bereits das Programm benannt. Als wäre Integration eine Währung, die sich einfach so konvertieren ließe. Ohne auch nur zu fragen, ob damit womöglich nicht ein viel zu hoher Anspruch formuliert ist, ob es sich nicht um Inflationsgefahr handeln könnte und man sich besser über Inklusion, Annäherung oder temporäre Hospitalität unterhalten sollte. Christan Schüle ergänzt: „Oft werden besagte Leitbegriffe gekoppelt in der Annahme, durch mehr Bildung erreiche man bessere Integration.“ Integration setzt Integrität voraus: den Willen zur Zuwendung, sonst wäre sie ein reich sozialtechnisches Verfahren über die Köpfe der Menschen hinweg. Diese nehmen eine derartige Fremdbestimmung, so ist zu vermuten, auf Dauer nicht hin. Seit dem Sommersemester 2015 lehrt Christian Schüle Kulturwissenschaft an der Universität der Künste in Berlin.
Die homogene Gesellschaft ist eine Illusion
Die Deutschen leben in einer pluralisierten Gesellschaft. Das ist nicht nur ein relativ neues Faktum. Das ist auch ein unhintergehbares Faktum: Es gibt keinen Weg zurück in eine nicht-pluralisiert, in eine homogene Gesellschaft. Isolde Charim erklärt: „Um die Reichweite und das ganze Ausmaß der Neuheit zu ermessen, muss man sich den „prä-pluralen“ Gesellschaften, also den Gesellschaften Westeuropas vor ihrer Pluralisierung zuwenden.“ Denn diese geben das Vergleichsmodell ab. Diese homogenen Gesellschaften, also diese Gesellschaften einer relativen ethischen, religiösen und kulturellen Einheitlichkeit sind gewissermaßen die Negativfolie. Der Hintergrund, von dem sich die heutige, pluralisierte Gesellschaft abhebt. Diese homogenen Gesellschaften waren nicht einfach da. Sie sind nicht einfach gewachsen, sozusagen natürlich. Die Philosophin Isolde Charim arbeitet als freie Publizistin und ständige Kolumnistin der „taz“ und der „Wiener Zeitung“.
Bildung sorgt für individuelles Glück
Dass sich Menschen und Gesellschaften durch Bildung verändern lassen, gehört zu den zentralen Mythen moderner Bildungsideologien. Konrad Paul Liessmann erläutert: „Vielen gilt Bildung als jenes Instrumentarium, mit dem nicht nur die Menschen ihr individuelles Glück finden, sondern mit dem man auch die sozialen, politischen und ökonomischen Probleme unserer Zeit lösen kann.“ Wer einen Menschen aus dem Netz rassistischer oder sexistischer Vorurteile befreien und zum Positiven verändern möchte, empfiehlt, ihn zu bilden. Wer eine Gesellschaft gerechter und friedlicher haben möchte, empfiehlt, damit in der Schule zu beginnen. Konrad Paul Liessmann stellt sich die Frage, ob Bildung hält, was man sich hier von ihr verspricht. Prof. Dr. Konrad Paul Liessmann ist Professor für Methoden der Vermittlung von Philosophie und Ethik an der Universität Wien und wissenschaftlicher Leiter des Philosophicum Lech.
In Deutschland gibt es keine Chancengerechtigkeit
Das deutsche Bildungssystem funktioniert nicht, wie es sollte. Für die Frage, wie viel Geld einer nach Hause bringt, spielt der Berufsabschluss eine zentrale Rolle. Wer ein Uni-Diplom hat, verdient in Deutschland im Durchschnitt 70 Prozent mehr als ein Realschüler, der eine Lehre macht. Alexander Hagelüken fügt hinzu: „Jedes Jahr, das ein mittelalter Arbeitnehmer vor seinem Job länger mit seiner Bildung verbringt, zahlt sich für ihn aus: Mit einem zehn Prozent höheren Einkommen.“ Das macht schnell den Unterschied zwischen einem mäßig bezahlten Job und einem Platz in der Mittelschicht. Wenn sich der Verdient so stark nach dem Abschluss richtet, ist natürlich entscheidend, wovon es abhängt, welchen Abschluss einer macht. Alexander Hagelüken ist als Leitender Redakteur der Süddeutschen Zeitung für Wirtschaftspolitik zuständig.
Ohne Mündigkeit droht die Entmenschlichung
Ulf Poschardt klagt an: „In der Erziehung kommt der mündige Einzelne zu kurz.“ Auch das versteht Theodor W. Adorno als etwas sehr Deutsches. In der Bildung scheinen Autonomie und Mündigkeit oft das Ideal zu sein. Aber zu oft sind Autorität und Bindung die Realität. Mündigkeit durch Bildung lässt sich nur in einer freien Gesellschaft vermitteln. Theodor W. Adorno versteht Bildung auch als eine Art Immunisierung gegen den Drang zum Kollektiv. Denn beim Aufgehen in einem Kollektiv kommt es zum Verlust der Mündigkeit und Autonomie. Theodor W. Adorno schreibt: „Menschen, die blind in Kollektive sich einordnen, machen sich selbst schon zu etwas mit Material, löschen sich als selbstbestimmte Wesen aus.“ Ohne Mündigkeit droht die Entmenschlichung. Für Ayn Rand war das Individuum „the smallest minority on earth“. Seit 2016 ist Ulf Poschardt Chefredakteur der „Welt-Gruppe“ (Die Welt, Welt am Sonntag, Welt TV).
Die Schule ist eine „autoritäre“ Institution
Für Herbert Renz-Polster stellt sich die Frage, ob das Bildungssystem vielleicht selbst dafür sorgt, dass sich autoritäre Haltungen bei Schülern verfestigen. Wenn dies auch unbeabsichtigt geschieht. Denn in einem gewissen Sinne ist die Schule eine „autoritäre“ Institution. In dem Sinne nämlich, dass sie die Schüler einer von ihnen selbst kaum hinterfragten Ordnung unterwirft. Herbert Renz Polster kritisiert: „Bis heute verbringen Schüler den größten Teil ihrer Kindheit damit, Fragen zu beantworten, die sie selbst nicht gestellt haben.“ Je besser sie diese Fragen beantworten und je reibungsloser sie diese beantworten, desto besser fällt ihre Benotung durch ihre pädagogischen „Führer“ aus. Die Lehrpläne, die Bildungsinhalte, die Methoden – die alle waren schon längst da, bevor das Kind auch nur die Schule betreten hat. Der Kinderarzt Dr. Herbert Renz-Polster hat die deutsche Erziehungsdebatte in den letzten Jahren wie kaum ein anderer geprägt.
Der Held im Bildungsroman ist immer ein Mann
Die Rehabilitierung des Romans als Literaturgattung war eine Leistung der Aufklärung, aber erst in der Kunstepoche erlangte der Roman weltliterarische Geltung und trat gleichberechtigt neben das Drama. Als Kunstepoche bezeichnete Heinrich Heine die Zeit zwischen der Französischen Revolution 1789 und dem Tod Johann Wolfgang von Goethes 1832. Johann Wolfgang von Goethes „Werther“ (1774) und Christoph Martin Wielands „Agathon“ (1766/67) stellten die ersten Versuche dar, Erfahrungen und Entwicklungen des bürgerlichen Individuums episch zu erfassen. Beide Romane waren jedoch noch weit davon entfernt, die hoch gesteckten Hoffnungen zu erfüllen, die Friedrich von Blanckenburg in seiner „Theorie des Romans“ (1774) mit dem bürgerlichen Roman verbunden hatte. „Werther“ bot nur einen höchst subjektivistischen Ausschnitt der Gesellschaft. „Agathon“ war in ein antikes Gewand gehüllt und verdeckte die bürgerliche Identitätsproblematik mehr, als dass er sie verdeutlichte.
An der Oberfläche der Geschichte herrscht das Bewusste
Ein einfaches Modell ermöglicht eine geschichtliche Darstellung der menschlichen Gesellschaften und ihrer Veränderungen. Emmanuel Todd erläutert: „An der Oberfläche der Geschichte entdecken wir das Bewusste, die Wirtschaft der Ökonomen, die täglich in den Medien präsent ist und deren neoliberale Ideologie in einer merkwürdigen Rückbesinnung auf den Marxismus verkündet, dass sie das Ausschlaggebende sei. Zu diesem Bewussten, dem Schrillen, wie man sagen könnte, gehört natürlich auch die Politik.“ Etwas tiefer stößt man auf ein Unterbewusstes der Gesellschaft, auf die Bildung, eine Schicht, deren Bedeutung die Bürger und Kommentatoren erkennen, wenn sie an ihr reales Leben denken, während sich die orthodoxe Sicht weigert, vollauf anzuerkennen, wie entscheidend sie ist und wie stark sie auf die darüberliegende bewusste Schicht einwirkt. Emmanuel Todd ist einer der prominentesten Soziologen Frankreichs.