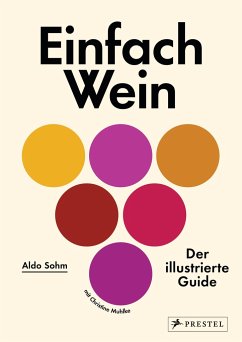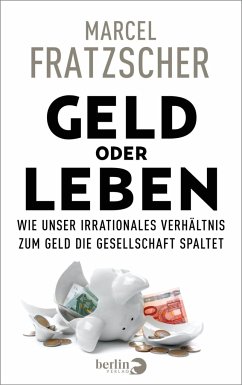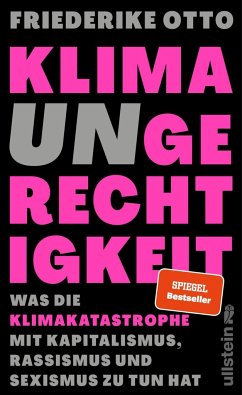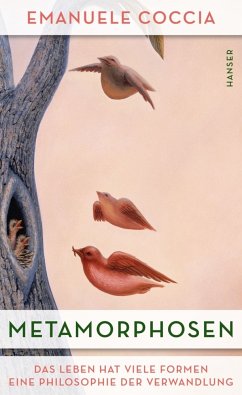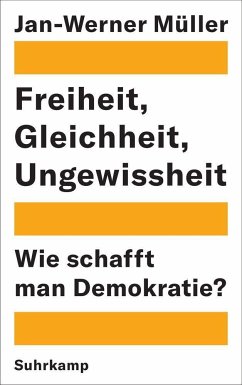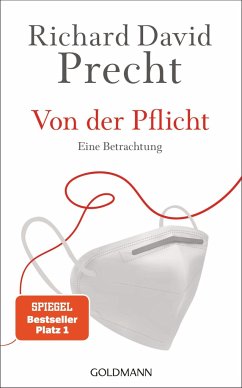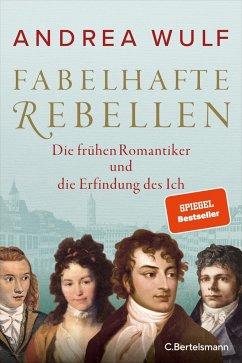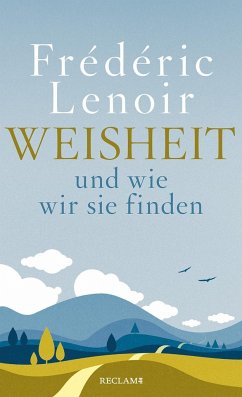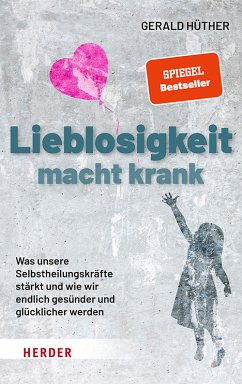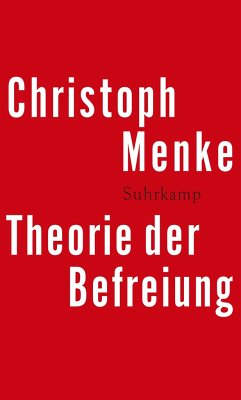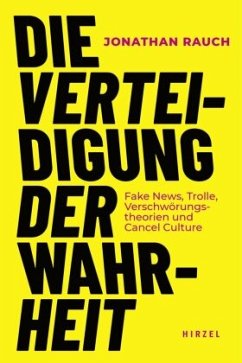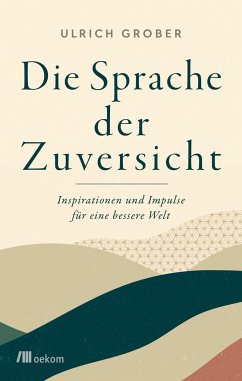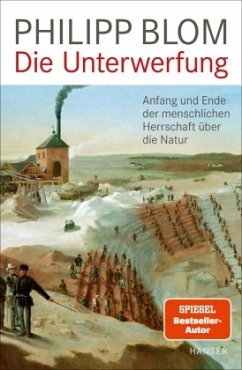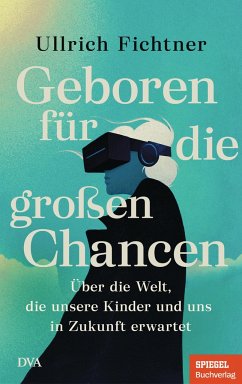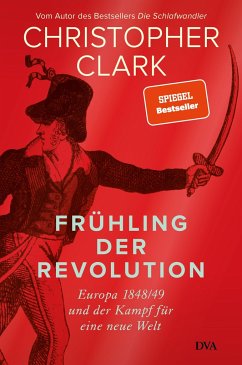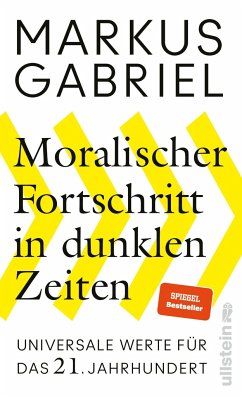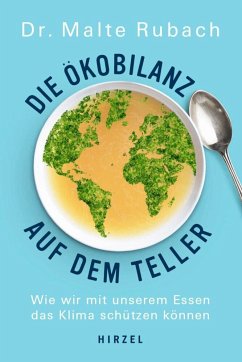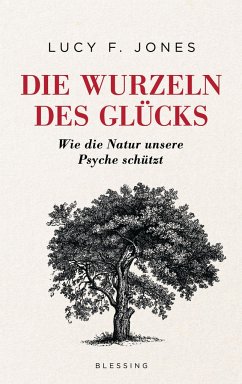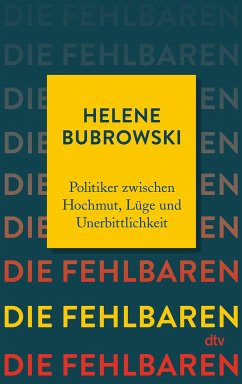Bettina Schulte schreibt in ihrem Buch „Neid“: „Der Neid ist das verbotenste aller Gefühle – und ist die Todsünde, die überhaupt keinen Spaß macht.“ Trotzdem scheint er für die Entwicklung von Gesellschaften notwendig zu sein. Denn der Neidische fühlt sich dem anderen überlegen. Das spornt ihn an, des dem Beneideten gleichzutun. Die Neidproduzenten von heute heißen Influencer. Die sozialen Medien Facebook und Instagram sind die größten Neidmaschinen der Gegenwart. Neidisch sind immer nur die anderen. Nur weiß im Normalfall keiner vom Neid. Denn er ist tabu. Heutzutage gehört der Neid zu den letzten Gefühlen, die geheim gehalten werden. „Bewunderung ist glückliche Selbstverlorenheit, Neid unglückliche Selbstbehauptung“, fasst der dänische Philosoph Sören Kierkegaard den Unterschied zwischen neidloser Anerkennung eines anderen und neidischer Selbstbezogenheit in einem klugen Aphorismus zusammen. Die Kulturjournalistin Bettina Schulte promovierte über Heinrich von Kleist und war mehr als zwanzig Jahre leitende Redakteurin im Feuilleton der Badischen Zeitung.
In Argentinien und Chile findet eine Weinrevolution statt
Aldo Sohm vertritt folgende These: „In Argentinien und Chile findet eine Weinrevolution statt.“ Die traditionellen, vollmundigen Weine waren von den üppigen, von den Anden herausgewaschenen Böden in Kombination mit dem warmen Klima und kühlenden Höhenlagen geprägt. Französische Winzer, die auf der Suche nach bezahlbarem Land und ebensolchen Arbeitskräften waren, haben hier stark investiert. Südamerika hat auch den Vorteil wurzelechter, nicht gepfropfter Reben, denn die Reblaus Phylloxera, die im späten 19. Jahrhundert Rebflächen in ganz Europa vernichtet hat, kam nie bis nach Chile. Wie viele junge Weinnationen, die ihre Tradition zugunsten international beliebter Weine vernachlässigt haben, wurde die Balance neu ausgerichtet. Der Österreicher Aldo Sohm ist einer der renommiertesten Sommeliers der Welt, eine Legende seiner Branche. Christine Muhlke ist Redakteurin des Feinschmecker-Magazins „Bon Appétit“.
Schulden können durchaus sinnvoll sein
Es gibt viele Beispiele, bei denen Schulden von Privatpersonen weder moralisch noch ökonomisch verwerflich erscheinen. Marcel Fratzscher nennt Beispiele: „Schulden für Investitionen in die eigene Qualifikation oder die Bildung der Kinder, für das Eigenheim oder das eigene Unternehmen sind in den meisten Fällen gute Investitionen.“ Nun mag man einwenden, dass selbst solche Schulden nicht immer sinnvoll sein müssen, vor allem nicht dann, wenn die Schuldner sie langfristig nicht zurückzahlen können. Es gibt also verschiedene Facetten, wann und unter welchen Umständen Schulden sinnvoll und notwendig sind und wann nicht. In zahlreichen Fällen sind höhere Schulden kurzfristig notwendig und richtig, um sie langfristig schneller abbauen zu können. Marcel Fratzscher ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) und Professor für Makroökonomie an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Jugendliche erleben die intensivsten Freundschaften
Die aktuelle Sonderausgabe Nr. 30 des Philosophie Magazins stellt so gut wie alle Formen der Freundschaft vor. Manche Freude begleiten einen Menschen ein Leben lang, andere nur für einen kurzen Abschnitt oder zu einem bestimmten Zweck. Die Kindheitsfreunde finden sich zu zweit, zu dritt oder erkunden als Bande die Welt. Jugendliche erleben daran anschließend oft die intensivsten Freundschaften. Helena Schäfer schreibt: „Jugendfreundschaften sind prägend. Sie begleiten durch einen aufwühlenden Lebensabschnitt, in dem wichtige Stationen des Erwachsenwerdens gemeinsam durchlaufen werden. In der Rebellion gegen Eltern und Normen formt sich in dieser Phase ein eigenständiges Selbst.“ Dagegen teilt man mit manchen Freunden nicht den Alltag, nicht alle tiefen Emotionen oder Gedanken, sondern ein Interesse. Dabei handelt es sich um die sogenannten Hobby-Freunde.
Mit 1,2 Grad Erwärmung ist die Erde heißer als jemals zuvor
Die globale Mitteltemperatur ist seit dem Beginn der industriellen Revolution um mehr als ein Grad gestiegen. Friederike Otto weiß: „Die Anfang 2023 herrschenden 1,2 Grad Celsius globaler Erwärmung mögen nicht nach viel klingen, aber das täuscht. Für einen Planeten – und vor allem seine Bewohner – ist es ein riesiger Unterschied, ob die durchschnittliche, über alle Land- und Wassermassen gemessene Temperatur bei 14 oder 15,2 Grad liegt.“ Ähnlich wie es auch für einen menschlichen Körper einen enormen Unterschied macht, ob die Körpertemperatur bei 37 oder 38,2 Grad liegt. Mit 1,2 Grad Erwärmung ist die Erde heute wärmer als jemals zuvor in der Geschichte der menschlichen Zivilisation – wärmer als jene Welt, die ein Mensch bisher gekannt hat. Friederike Otto forscht am Grantham Institute for Climate Chance zu Extremwetter und dessen Auswirkungen auf die Gesellschaft. Sie hat das neue Feld der Zuordnungswissenschaft – Attribution Science – mitentwickelt.
Die Technik gleicht das Defizit der biologischen Entwicklung aus
Emanuele Coccia erklärt: „Ein Kokon ist ein postnatales Ei, das vom Individuum gleichsam fabriziert wird. Er umreißt eine Sphäre, wo Sein und Machen in einer dritten Dimension verschmelzen.“ Diese Evidenz ist bestimmend für eine Eigenschaft des metamorphischen Phänomens: dessen rein technische Natur. Bei jeder Verwandlung konstruiert das Lebendige notwendigerweise die eigene Gestalt, die somit nichts Natürliches oder Spontanes an sich hat. Mehr noch, die Natur der Technik selbst geht tief gewandelt daraus hervor. Die meisten Menschen sind es gewohnt, die Technik als Folge eines biologischen Defizits des Individuums zu begreifen. Seit Platon und seinem Mythos von Prometheus und Epimetheus ist man es gewohnt, die Technik nicht nur als einen rein menschlichen Zug zu begreifen. Emanuele Coccia ist Professor für Philosophiegeschichte an der École des Hautes Études en Sciences Sociales in Paris.
Parteien und Medien bilden Systeme
Vermittelnde Institutionen erfüllen ihre Aufgaben nicht automatisch von selbst, und offensichtlich operieren sie nicht im luftleeren Raum. Jan-Werner Müller erläutert: „Sie sind vielmehr Teil von Systemen: Parteien bilden Parteiensysteme, Medien bilden Mediensysteme. Deren Struktur kann sich von Land zu Land beträchtlich unterscheiden.“ Welche Art von System jeweils entsteht, hänge ganz wesentlich von dem ab, was der US-amerikanische Soziologe Paul Starr „konstitutive Entscheidungen“ genannt hat. Das lässt sich gut am Beispiel von Parteien nachvollziehen. In den USA einigte man sich 1842 auf das Prinzip der Mehrheitswahl. Das soll heißen: Der Gewinner bekommt alles, der Verlierer nichts.“ In Verbindung mit der Direktwahl des Präsidenten machte diese Entscheidung die Entstehung eines Zweiparteiensystems so gut wie unvermeidlich. Jan-Werner Müller ist Roger Williams Straus Professor für Sozialwissenschaften an der Princeton University.
Beim Schutz von Vulnerablen geht Freiheit auf allen Seiten verloren
Die Kennzeichnung von Menschen als vulnerable dient dazu, deren Anliegen und Interessen als besonders bedeutsam zu markieren und die Gesellschaft darauf aufmerksam zu machen. Was allerdings eher neu zu sein scheint, ist der Umfang, in dem Vulnerabilitäten ernstgenommen werden. Frauke Rostalski schreibt in ihrem neuen Buch „Die vulnerable Gesellschaft“: „Aktuelle Debatten über Vulnerabilität lassen sich deshalb zugleich für ein Zeichen dafür deuten, dass eine Wertediskussion ansteht und ein Wertewandel im Gang ist – ein Wandel, der nicht zuletzt mit rechtlichen Mitteln vollzogen werden soll.“ Damit tritt aber eine weitere Kategorie auf den Plan, die für das gesellschaftliche Miteinander von besonderer Bedeutung ist: die Freiheit. Frauke Rostalski ist Professorin für Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechtsphilosophie, Wirtschaftsrecht, Medizinstrafrecht und Rechtsvergleichung an der Universität zu Köln.
Viele Menschen hegen die Liebe zum Reichtum
Alexis de Tocqueville fragt in den 1830er-Jahren, was eigentlich passiert, wenn sich in der Demokratie das Geld zum höchsten erstrebenswerten Gut und Selbstzweck entwickelt. Denn es tritt damit an die Stelle von Stand und Ehr, die Aristokratien über alles andere stellen. Alexis de Tocqueville schreibt: „Die Menschen, die in demokratischen Zeiten leben, haben viele Leidenschaften. Aber die meisten ihrer Leidenschaften münden in der Liebe zum Reichtum, oder sie entspringen ihr. Das rührt nicht daher, dass sie kleinmütiger sind, sondern dass das Geld tatsächlich wichtiger ist.“ Richard David Precht erklärt: „Die ständige Fokussierung auf das Geld prägt die US-amerikanische Gesellschaft wie nichts anderes und ist, wie Tocqueville früh erkennt, das Stigma aller zukünftigen Demokratien.“ Der Philosoph, Publizist und Autor Richard David Precht einer der profiliertesten Intellektuellen im deutschsprachigen Raum.
Goethe war ein literarischer Superstar
Das Buch „Die Leiden des jungen Werthers“ waren Johann Wolfgang von Goethes bedeutendster Beitrag zum sogenannten Sturm und Drang. Dabei handelt es sich um eine literarische Bewegung, die sich gegen den Rationalismus der Aufklärung wandte. Die Schriftsteller des Sturm und Drang zelebrierten Emotionen in all ihren Extremen. Sie schrieben von leidenschaftlicher Liebe bis zur düsteren Melancholie, von selbstmörderischer Sehnsucht bis zu rasender Freude. Und Johann Wolfgang von Goethe wurde damit zum literarischen Superstar. Andrea Wulf weiß: „Der achtzehn Jahre alte Herzog Carl August war von dem Roman so angetan, dass er Goethe 1775 einlud, bei ihm im Herzogtum Sachsen-Weimar zu leben und zu arbeiten.“ Als Autorin zeichnete man Andrea Wulf mit einer Vielzahl von Preisen aus, vor allem für ihren Weltbestseller „Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur“ 2016, der in 27 Sprachen übersetzt wurde.
Jede Handlung ruft eine Wirkung hervor
Die Inder sind völlig überzeugt, dass es ein universelles Kausalitätsgesetz gibt: Jede Handlung ruft eine Wirkung hervor. Frédéric Lenoir ergänzt: „Sie denken außerdem, dass jedes Lebewesen ein Körnchen des Göttlichen – des unpersönlichen Brahman – in sich trägt: den Atman.“ Der Atman wandert von Leben zu Leben, von Körper zu Körper, bis es ihm gelingt, den endlosen Kreislauf der Wiedergeburten zu durchbrechen, weil es sich von der Unwissenheit befreit. Dadurch wird ihm bewusst, dass er nicht mit dem Ich übereinstimmt, sondern mit einem Körnchen des Göttlichen. Dies ist die Verwirklichung des Selbst. Durch spirituelle Bewusstseinsfindung befreit er sich sowohl vom Unwissen als auch aus dem Gefängnis der Leidenschaften. Indem er vom Ich zum Selbst kommt, gelangt der Mensch zur Erlösung, welche die Buddhisten „Erwachen“ nennen. Frédéric Lenoir ist Philosoph, Religionswissenschaftler, Soziologe und Schriftsteller.
Krankmachende Vorstellungen behindern die Selbstheilungskräfte
Am Beispiel des Nocebo-Effektes lässt sich die krankmachende Wirkung krankmachender Vorstellungen am leichtesten verstehbar machen. Gerald Hüther weiß: „Der menschliche Organismus verfügt über Selbstheilungskräfte, die ihre Wirkung insbesondere über die im gesamten Organismus ausgebreiteten integrativen Systeme entfalten: das autonome Nervensystem, das Hormonsystem, das kardiovaskuläre System und das Immunsystem.“ Gesteuert und koordiniert wird deren Aktivität im Gehirn nicht von der Hirnrinde, sondern von neuronalen Netzwerken, die in entwicklungsgeschichtlich älteren und tiefer im Hirn gelegenen Bereiche lokalisiert sind. Diese Netzwerke dienen der Regulation der im Körper ablaufenden Prozesse. Sie sind nicht daran beteiligt, wenn sich ein Mensch etwas vorstellt oder ausdenkt. Deshalb gibt es diese Netzwerke auch schon bei den Krokodilen. Solange sie in ihren Aktivitäten und ihrem Zusammenwirken durch nichts gestört werden, ist alles gut. Gerald Hüther ist Neurobiologe und Verfasser zahlreicher Sachbücher und Fachpublikationen.
Die Freiheit ist die Kraft des Anfangens
Es gibt zwei selbstwidersprüchliche Auffassungen des Werdens der Freiheit. Christoph Menke erklärt: „Die eine Auffassung, als Geschehen, versteht nicht das Werden der Freiheit; sie gelangt nicht bis zur Freiheit. Die andere Auffassung, als Tat, versteht nicht das Werden der Freiheit; sie beginnt schon mit der Freiheit.“ Das Werden der Freiheit lässt sich nur begreifen, wenn man diesen Gegensatz von Aktivität und Passivität aufzulösen vermag. Die Befreiung muss sich von diesem Gegensatz befreien; sie muss das Werden befreien. Es gibt zwei verschiedene Konzeptionen des Denkens und seiner Freiheit: ein idealistisches und ein ästhetisch-materialistisches Konzept des Denkens. Die Freiheit ist wesentlich negativ. Sie ist die Negation der Unfreiheit. Christoph Menke ist Professor für Philosophie an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main.
Das Gehirn negiert nicht zuträgliche Informationen
Jonathan Rauch stellt fest: „Wenn Ihr gesellschaftliches Ansehen und Ihre Gruppenidentität davon abhängen, dass Sie etwas glauben, dann werden Sie auch einen Weg finden, es zu glauben. Tatsächlich wird Ihnen Ihr Gehirn dabei sogar helfen, indem es Informationen, die diesem Vorhaben zuträglich sind, bereitwillig akzeptiert und sich an sie erinnert, während es nicht zuträgliche Informationen vergräbt und ignoriert.“ Das ist der Grund dafür, dass Intelligenz keinen Schutz vor falschen Überzeugungen bietet. Sie macht Menschen im Gegenteil sogar noch besser im Rationalisieren. Wie Jonathan Haidt in „The Righteous Mind“ schreibt, sind extrem kluge Menschen besser als andere dazu in der Lage, Argumente zur Untermauerung ihrer eigenen Ansichten zu finden. Jonathan Rauch studierte an der Yale University. Als Journalist schrieb der Politologe unter anderem für das National Journal, für The Economist und für The Atlantic.
Die Staaten der Welt stehen vor gigantischen Herausforderungen
In seinem neuen Buch „Das Jahrhundert der Toleranz“ beschreibt Richard David Precht die großen Herausforderungen, die auf die Staaten der Welt im 21. Jahrhundert zukommen. Außerdem fragt er, wie ein halbwegs friedliches Miteinander möglich sein könnte und wie es sich vermeiden lässt, dauerhaft in alte Muster der Feindschaft und Konfrontation zurückzufallen. Dabei nimmt er eine philosophische Perspektive ein und bietet seinen Lesern daher keine schnellen Lösungen. Denn in der Gesellschaft, in Politik und Kultur werden Herausforderungen und Krisen nicht durch Lösungen aus der Welt geschafft. Richard David Precht erläutert: „Für welche Maßnahmen man auch immer sich entscheidet, stets werden Schwierigkeiten verlagert, überformt, in den Hintergrund gestellt oder durch andere Schwierigkeiten ersetzt.“ Der Philosoph, Publizist und Autor Richard David Precht zählt zu den profiliertesten Intellektuellen im deutschsprachigen Raum.
Uralt ist das Streben nach Glück
Das Leben ist gut – wie es auch sei. Es gibt bei vielen Menschen die Sehnsucht, seinem Leben und Erleben Glanz zu verleihen. Dazu gesellt sich die Entschlossenheit, das Schöne, das Wunder, den Zauber ins eigene Leben hereinzuholen. Diese Wünsche haben ihre Dynamik in der der prekären Gegenwart keineswegs verloren. Ulrich Grober betont: „Und das ist gut so. Dieser Wille gehört untrennbar zum Streben nach Glück, ist uralt und ewig jung. Er sucht sich immer neue Kanäle und Ausdrucksformen.“ Doch wie die sozialen Medien, ja das Netz insgesamt, ist gerade das Wortfeld WOW heillos verstrickt in die Sprache der Werbung und die Welt der Warenästhetik. Es wird seines Zaubers beraubt von endlosen Plakaten zu Lippenstiften und Anzeigen zum nächsten Wochenendtrip. Den Publizisten und Buchautor Ulrich Grober beschäftigt die Verknüpfung von kulturellem Erbe und Zukunftsvisionen.
Von der Unruhe kommt man nicht so leicht los
Das Titelthema des neuen Philosophie Magazins 05/2024 beschäftigt sich mit der Frage: „Wie komme ich zur Ruhe?“ Die Ruhe ist eine große Sehnsucht vieler Menschen, doch sie ist nur schwer zu erreichen, wie bereits die Stoiker in der Antike wussten. Heute inmitten digitaler Ablenkung, politischer Krisen und spätmoderner Leistungsansprüche scheint sie weiter entfernt denn je. Der Philosoph Ralf Konersmann schreibt: „Charakteristisch für die Situation ist unser ambivalentes Verhältnis zur Unruhe: Wir leiden unter ihr, möchten sie aber auch nicht missen. Ich habe deshalb die Unruhe, unsere moderne Unruhe, eine Passion genannt.“ Inzwischen sind jedoch Trends wie Arbeitszeitreduktion zugunsten der Familien oder die Priorisierung von Hobbys auf dem Vormarsch. Ralf Konersmann erkennt in solchen Initiativen den Versuch, Alternativen zu entwickeln. Dennoch haben auch sie das Potential, neue Unruhe zu erzeugen. Die Unruhe ist also etwas, von dem man nicht so leicht loskommt.
Gärten changieren zwischen Wildnis und Zähmung
Die Philosophie der Gärten füllt Bibliotheken zwischen Japan und England. Sie stellt von Anfang an die Frage, ob es neben der Unterwerfung nicht auch ein kollaboratives Formen und Weiterdenken von Möglichkeiten natürlicher Gestaltung geben könne. Philipp Blom stellt fest: „Im Garten war immer schon die Spannung zwischen Wildnis und Zähmung präsent.“ Im europäischen Mittelalter entstand daraus der „Hortus conclusus“. Nämlich der umhegte Ort, an dem die Jungfrau und das Einhorn in mystischer Eintracht leben. Es handelt sich dabei um einen organisierten Raum, der allegorisch alle Ordnungen der Schöpfung abbilden soll und dessen Pflanzen eine eigene symbolische Sprache sprechen. Der Gegensatz von Natur und Kultur fand seinen Ausdruck in dieser Praxis. Philipp Blom studierte Philosophie, Geschichte und Judaistik in Wien und Oxford. Er lebt als Schriftsteller und Historiker in Wien.
„Nur“ 0,5 Prozent der Weltbevölkerung sind auf der Flucht
Die von vielen Leuten vor allem in wohlhabenden Ländern gepflegte Vorstellung, die halbe Welt befinde sich irgendwie auf Wanderschaft, liegt meilenweit neben der Realität. In Wirklichkeit sind „nur“ 0,5 Prozent der Weltbevölkerung auf der Flucht. Ullrich Fichtner erläutert: „Solche Irrtümer häufen sich auch deshalb gern, weil wir Menschen mit großen Zahlen schlechter umgehen können, als wir denken. Wir meinen zwar mittlerweile, an die abstrakten Summen gewaltiger Staatsausgaben gewöhnt, mit Milliarden- und Millionenrechnungen selbstverständlich vertraut zu sein, aber das gehört in die Reihe der humanen Selbstüberschätzungen.“ Und übrigens: Die Menschen auf der Flucht wollen nicht alle nach Schweden oder Deutschland oder Großbritannien, keineswegs! Die meisten retten sich in ihre Nachbarländer, bleiben dort und hoffen auf baldige Rückkehr in die Heimat. Ullrich Fichtner ist Reporter des „Spiegel“ und gehört zu den renommiertesten Journalisten Deutschlands.
Armut war kollektiv vorhanden und strukturell bedingt
Die im Umfeld der sozialen Frage erzeugten Energien fanden ihren Weg zurück in die Politik. Die von Friedrich Engels in „Die Lage der arbeitenden Klasse in England“ aufgestellten Thesen prägten maßgeblich das „Kommunistische Manifest“, das er gemeinsam mit Karl Marx verfasste. Christopher Clark erklärt: „Armut war keineswegs ein neues Phänomen. Aber der „Pauperismus“ zu Beginn des 19. Jahrhunderts unterschied sich von den hergebrachten Formen der Armut. Die Abstraktheit der neuen Wortschöpfung gibt trefflich wieder, was als die systematische Eigenart des Phänomens angesehen wurde.“ Es war kollektiv und strukturell bedingt, hing nicht von individuellen Eventualitäten wir Krankheit, Todesfällen, Verwundung oder Missernten ab. Christopher Clark lehrt als Professor für Neuere Europäische Geschichte am St. Catharine’s College in Cambridge. Sein Forschungsschwerpunkt ist die Geschichte Preußens.
Vielen Menschen ist am Schutz von Minderheiten gelegen
Markus Gabriel stellt fest: „Minderheiten kann man keineswegs stets den Anspruch zugestehen, Gehör zu finden und bei Entscheidungsprozessen mit am Tisch zu sitzen.“ Pädokriminelle, Antidemokraten, eindeutige Verfassungsfeinde, Mörder usw. haben aufgrund ihrer moralischen Defizite schlichtweg nicht das Recht, als Minderheiten vor institutioneller Härte geschützt zu werden. Vielen Menschen ist jedoch zu Recht am Schutz von Minderheiten gelegen. Zu schützende Minderheiten sind meistens solche, denen man nachweisbar Unrecht angetan hat. Man muss sie besonders schützen, um ihnen das volle moralische und juristische Recht zukommen zu lassen, dessen man sie beraubt hat. Es gehört zu der moralisch empfehlenswerten Seite der Demokratie, dass sie zu Unrecht unterdrückten Minderheiten Gehör verschafft. Markus Gabriel hat seit 2009 den Lehrstuhl für Erkenntnistheorie und Philosophie der Neuzeit an der Universität Bonn inne. Zudem ist er dort Direktor des Internationalen Zentrums für Philosophie.
Die Generation Angst hat kein Enddatum
Das neue Buch „Generation Angst“ von Jonathan Haidt erzählt die Geschichte der Generation, die nach 1995 geboren wurde, allgemein als Generation Z bezeichnet. Dabei handelt es sich um jene Generation, die auf die sogenannten Millennials – geboren 1981 bis 1995 – folgte. Jonathan Haidt glaubt nicht, dass die Generation Z – die ängstliche Generation – ein Enddatum hat. Sie endet nur dann, wenn die Erwachsenen die Bedingungen für eine Kindheit verändern, die junge Menschen so ängstlich macht. Jonathan Haidt schreibt: „Generation Z wurde die erste Generation in der Geschichte, die ihre Pubertät mit einem Portal in der Tasche durchlebte, das sie fort von den Menschen um sie herum in ein alternatives Universum rief, das aufregend, suchterzeugend, instabil und – wie ich zeigen werde – für Kinder und Heranwachsende ungeeignet war.“ Jonathan Haidt ist Professor für Sozialpsychologie an der New York University. Seine Forschungsschwerpunkte sind die psychischen Grundlagen von Moral, moralische Emotionen und Moralvorstellungen in verschiedenen Kulturen.
Zwei Drittel der Fische kommen aus Aquakulturen
Meeresfische muss man zwar auf Eis gekühlt transportieren und in den Handel bringen. Doch diese Mengen gefrorenes Wasser sind vernachlässigbar. Einen Unterschied macht dagegen die Aquakultur. Malte Rubach weiß: „Zwei Drittel des weltweiten Fischaufkommens werden laut Welternährungsorganisation inzwischen aus der Aquakultur gewonnen. 2011 war es noch nur etwas mehr als ein Drittel, der Anstieg ist also enorm.“ Doch man nutzt nur rund 60 Prozent des Fisches aus Aquakulturen und Ozeanen für den menschlichen Verzehr. Man produziert ihn wiederum gezielt als Futtermittel für andere Aquakultur-Fische. Dennoch ist die Aquakultur auch mit ihren derzeitigen Schwächen wie dem Einsatz von Antibiotika, Pestiziden und tierischen Futtermitteln wohl die einzige Antwort auf die Überfischung der Meere. Der Referent und Buchautor Dr. Malte Rubach hat Ernährungswissenschaften in Deutschland, der Türkei und den USA studiert.
Die Gegenwart ist von massenhaften Artensterben überschattet
Eine stärkere Verbindung zur Natur würde die Menschen glücklicher und gesünder machen – so weit, so gut. Doch da gibt es ein Problem. Was nützt es, Waldspaziergänge zu verschreiben, wenn weltweit Waldgebiete von Rodungen bedroht sind? Wie sollen die Menschen Zeit im Grünen verbringen, wenn es immer weniger Parks gibt? Wie baut man eine Beziehung zu jemandem auf, der todkrank ist? Lucy F. Jones kritisiert: „In der gesamten westlichen, industrialisierten Welt leben wir zunehmend abgekapselt von der Natur und ignorieren, wie sehr wie sie brauchen. Und damit geht die Katastrophe einher, dass die Natur vor unseren Augen verschwindet; unsere Zeit auf diesem Planeten wird von der gewaltsamen Zerstörung natürlicher Lebensräume und dem massenhaften Artensterben überschattet.“ Lucy F. Jones ist Journalistin und schreibt regelmäßig zu wissenschaftlichen Themen, Gesundheit, Umwelt und Natur für die BBC, The Guardian und The Sunday Times.
In der Luftfahrt ist die Idee des Fehlermanagements entstanden
Die Ursprünge von Fehlerkultur liegen in einem Bereich, der mit Psychogeschwätz rein gar nichts zu tun hat: in der Luftfahrt. Helene Bubrowski erklärt: „Fehler sind hier besonders gefährlich. Man möchte sich vorstellen, dass Piloten und Towerlotsen zu Menschen gewordene Präzisionsgeräte sind, denen nichts entgeht, die immer sofort und richtig reagieren.“ Auf den ersten Blick erscheint es daher paradox, dass sich gerade hier die Idee vom Fehlermanagement entwickelt hat. Aber eben nur auf den ersten Blick. Nach schweren Unfällen in der Luftfahrt machte sich die amerikanische Luftfahrtbehörde auf die Suche nach strukturellen Problemen. Ein erster Befund war, dass in der großen Mehrheit der Fälle, mehr als achtzig Prozent, der Kapitän am Steuer saß. Helene Bubrowski arbeitet als Politikkorrespondentin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung im Berliner Hauptstadtbüro.