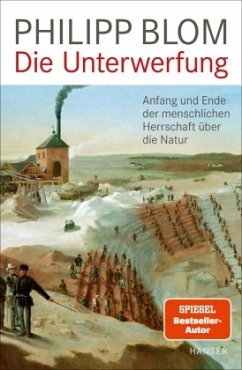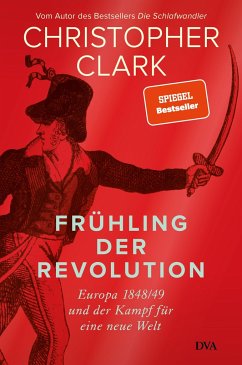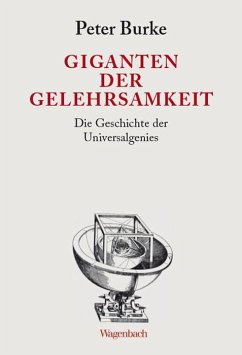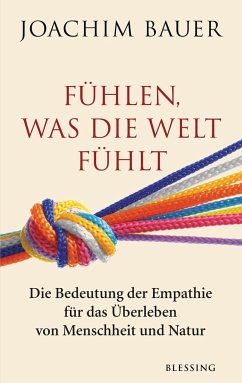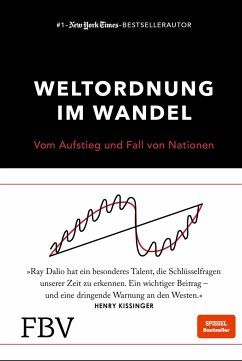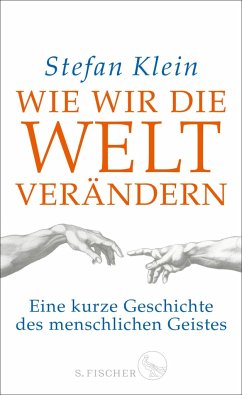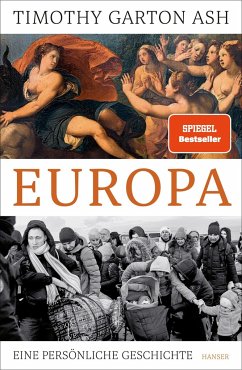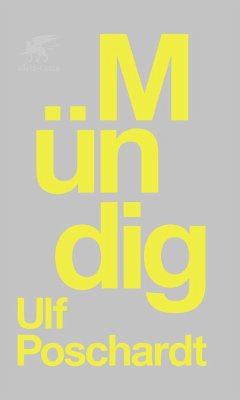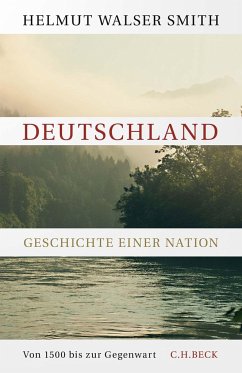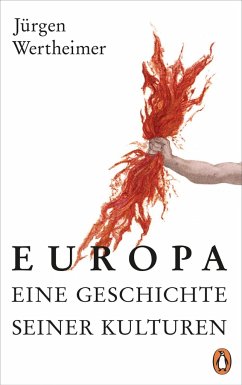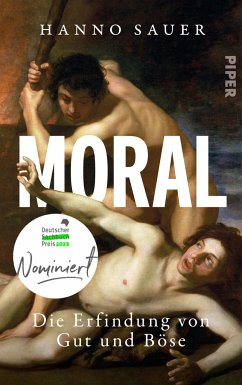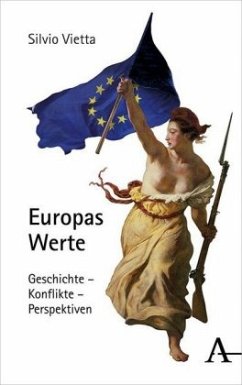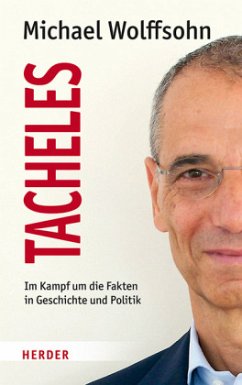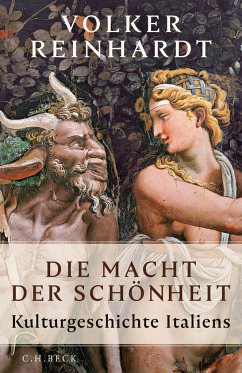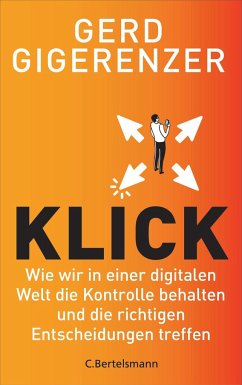Die Philosophie der Gärten füllt Bibliotheken zwischen Japan und England. Sie stellt von Anfang an die Frage, ob es neben der Unterwerfung nicht auch ein kollaboratives Formen und Weiterdenken von Möglichkeiten natürlicher Gestaltung geben könne. Philipp Blom stellt fest: „Im Garten war immer schon die Spannung zwischen Wildnis und Zähmung präsent.“ Im europäischen Mittelalter entstand daraus der „Hortus conclusus“. Nämlich der umhegte Ort, an dem die Jungfrau und das Einhorn in mystischer Eintracht leben. Es handelt sich dabei um einen organisierten Raum, der allegorisch alle Ordnungen der Schöpfung abbilden soll und dessen Pflanzen eine eigene symbolische Sprache sprechen. Der Gegensatz von Natur und Kultur fand seinen Ausdruck in dieser Praxis. Philipp Blom studierte Philosophie, Geschichte und Judaistik in Wien und Oxford. Er lebt als Schriftsteller und Historiker in Wien.
Geschichte
Armut war kollektiv vorhanden und strukturell bedingt
Die im Umfeld der sozialen Frage erzeugten Energien fanden ihren Weg zurück in die Politik. Die von Friedrich Engels in „Die Lage der arbeitenden Klasse in England“ aufgestellten Thesen prägten maßgeblich das „Kommunistische Manifest“, das er gemeinsam mit Karl Marx verfasste. Christopher Clark erklärt: „Armut war keineswegs ein neues Phänomen. Aber der „Pauperismus“ zu Beginn des 19. Jahrhunderts unterschied sich von den hergebrachten Formen der Armut. Die Abstraktheit der neuen Wortschöpfung gibt trefflich wieder, was als die systematische Eigenart des Phänomens angesehen wurde.“ Es war kollektiv und strukturell bedingt, hing nicht von individuellen Eventualitäten wir Krankheit, Todesfällen, Verwundung oder Missernten ab. Christopher Clark lehrt als Professor für Neuere Europäische Geschichte am St. Catharine’s College in Cambridge. Sein Forschungsschwerpunkt ist die Geschichte Preußens.
Immanuel Kant interessiere sich keinesfalls nur für Philosophie
Eine äußerst bemerkenswerte Ansammlung von Universalgelehrten im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert fand sich in Deutschland, einer Kulturnation, die seinerzeit noch kein Nationalstaat war. Peter Burke nennt ein Beispiel: „Der Schweizer Albrecht von Haller, Professor für Medizin, Anatomie und Botanik in Göttingen, war auch als Literaturkritiker, Dichter und Romancier aktiv.“ Immanuel Kant könnte ebenfalls mit einbezogen werden, da sich seine Interessen keineswegs auf Philosophie beschränkten. Was man heute als Psychologie und Anthropologie bezeichnet – Disziplinen, zu denen er Beiträge lieferte – bildete zu seiner Zeit zwar noch einen Teil der Philosophie, doch Kant schrieb zudem über Kosmologie und physische Geographie. Sechzehn Jahre lehrte Peter Burke an der School of European Studies der University of Sussex. Im Jahr 1978 wechselte er als Professor für Kulturgeschichte nach Cambridge ans Emmanuel College.
Die „soziale Frage“ war eingebettet in eine Studienkultur
Es war die Literatur, di unter dem Schlagwort „soziale Frage“ bekannt wurde. Christopher Clark erläutert: „In ihr verschmolzen amtliche Berichte, in Auftrag gegebene Studien, preisgekrönte Aufsätze, Journalismus und Genretexte miteinander und beeinflussten sich gegenseitig.“ Das Ganze war eingebettet in eine „Studienkultur“ Mitte des 19. Jahrhunderts in Europa. Bei der sozialen Frage handelte es sich in Wirklichkeit jedoch um ein Bündel unzähliger Fragen zur allgemeinen Gesundheit und Gefahr der Ansteckung, zu Berufskrankheiten, zum Verlust des sozialen Zusammenhalts, zu den Auswirkungen der Industrialisierung, Verbrechen, Sexualmoral, städtischem Wohnraum, Bevölkerungswachstum, Arbeitslosigkeit und Kinderarbeit. Dazu gehörten auch Fragen zu den potenziell zersetzenden Wirkungen der wirtschaftlichen Konkurrenz, zum Einfluss der Stadt auf Leben und Einstellung ihrer Bewohner und zum vermeintlichen Rückgang der Religiosität. Christopher Clark lehrt als Professor für Neuere Europäische Geschichte am St. Catharine’s College in Cambridge. Sein Forschungsschwerpunkt ist die Geschichte Preußens.
Soziale Unzufriedenheit verursacht keine Revolutionen
Christopher Clark befasst sich in seinem neuen Buch „Frühling der Revolution“ mit den Gesellschaften Europas vor 1848. Dabei liegt das Augenmerk auf Bereichen der Repression, Verdrängung, Unterdrückung und des Konflikts. Christopher Clark stellt fest: „Soziale Unzufriedenheit „verursacht“ keine Revolutionen – wenn sie das täte, käme es viel häufiger zu Revolutionen.“ Dennoch war die materielle Not der Europäer Mitte des 19. Jahrhunderts der unverzichtbare Hintergrund für jene Prozesse der politischen Polarisierung, welche die Revolutionen erst ermöglichten. Sie war ausschlaggebend für die Motivation vieler Teilnehmer an städtischen Unruhen. Ebenso wichtig wie die Realität und das Ausmaß des Leids waren die Mittel und Wege, mit denen diese Ära soziale Missstände wahrnahm und einordnete. Christopher Clark lehrt als Professor für Neuere Europäische Geschichte am St. Catharine’s College in Cambridge. Sein Forschungsschwerpunkt ist die Geschichte Preußens.
Die Sumer entwickelten die Keilschrift
Ein überaus wichtiger Schritt für die Menschheit als Ganzes war die Erfindung der ersten Schrift, der Keilschrift. Joachim Bauer blickt zurück: „Sie wurde gegen Ende des 4. Jahrhunderts vor Christus in Sumer entwickelt, dem ältesten der Reiche des Zweistromlandes.“ Schriftliche Überlieferungen und die Analyse von Material, das man durch archäologische Grabung zutage förderte, erwiesen sich in den vergangenen Jahrzehnten als überaus ergiebige Erkenntnisquellen. Als besonders wertvoll stellte sich die Möglichkeit heraus, ausgegrabene Materialen mit radiochemischen Methoden auf ihr Alter zu bestimmen. Die kombinierte Anwendung verschiedener Methoden hat das Forschungsgebiet der Archäobotanik entstehen lassen. Wissenschaftler in diesem Bereich untersuchen, wo, wann und mit welchen Pflanzen oder Bäumen die Erde zu verschiedenen Zeiten der Erdgeschichte bewachsen war. Prof. Dr. Med. Joachim Bauer ist Neurowissenschaftler, Psychotherapeut und Arzt.
Ein Zyklus steuert den Aufstieg und Fall von Weltreichen
Die Menschheit erlebt derzeit eine archetypische gewaltige Veränderung des relativen Wohlstands- und Machtgefüges sowie der gesamten Weltordnung. Dies wird sich auf allen Ländern grundlegend auswirken. Es gibt einen archetypischen großen Zyklus, der den Aufstieg und Fall von Weltreichen steuert. Die wichtigsten Zyklen der langfristige Kredit- und Kapitalmarktzyklus sowie der innen- und der außenpolitische Zyklus von Ordnung und Chaos. Ray Dalio erläutert: „Diese Zyklen lösen Pendelbewegungen zwischen den beiden Extremen aus – zwischen Frieden und Krieg, Hochkonjunktur und Rezession, der Machtergreifung der Linken und der Rechten, der Entstehung und Auflösung von Weltreichen und mehr.“ Diese Pendelbewegungen treten in der Regel auf, weil die Menschen bis zum Äußersten gehen und die Situation aus dem Gleichgewicht bringen. Ray Dalio ist Gründer von Bridgewater Associates, dem weltgrößten Hedgefonds. Er gehört mit zu den einflussreichsten Menschen der Welt.
Johannes Gutenberg erfindet den Buchdruck
Die moderne Weise zu denken entstand im Lauf einer Reihe von Krisen. Diese erschütterten ab dem Jahr 1500 Europa und breiteten sich später über die ganze Welt aus. Stefan Klein blickt zurück: „Viele Konflikte dieser Zeit erinnern an die Auseinandersetzungen, die unsere Gesellschaften heute aus dem Gleichgewicht bringen. Globalisierung und die explosive Verbreitung neuer Medien stellten auch damals die soziale Ordnung in Frage.“ Technischer Fortschritt entschied über wirtschaftlichen Erfolg, und die Gewissheiten der Religion galten nicht mehr. So gut wie alle Lebensbereiche veränderten sich. Ausgelöst hatte den Umbruch die bis heute folgenreichste Innovation seit der Antike. Die Anfänge dieser Erfindung liegen im Dunklen. Stefan Klein zählt zu den erfolgreichsten Wissenschaftsautoren der deutschen Sprache. Er studierte Physik und analytische Philosophie in München, Grenoble und Freiburg.
Jede nationale Geschichte Europas hat denselben Grundgedanken
Persönliche Erinnerungen, angefangen mit denen an die Hölle, die sich die Europäer auf Erden geschaffen haben, gehören zu den stärksten Triebkräften für alles, was Europa seit 1945 getan hat und geworden ist. Timothy Garton Ash nennt das den Erinnerungsmotor. Mehrere Generationen von Baumeistern Europas haben den Kontinent zu dem gemacht, was er zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist. Wenn man sich anschaut, welche Argumente man für die europäische Integration in den verschiedenen Ländern von den 1940er bis zu den 1990er Jahren vorbrachte, scheint jede nationale Geschichte auf den ersten Blick sehr unterschiedlich zu sein. Aber wenn man etwas tiefer gräbt findet man immer denselben Grundgedanken. Timothy Garton Ash ist Professor für Europäische Studien an der Universität Oxford und Senior Fellow an der Hoover Institution der Stanford University.
Der Verstand kann Großartiges leisten
„Die Akte des weißen Entdeckers“ nennt der amerikanische Anthropologe Joseph Henrich seine gesammelten Geschichten von Menschen, die sich weitab aller Zivilisation durchschlagen mussten. Meist handelte es sich dabei um europäische Schiffbrüchige. Diese strandeten in einer fremden Umgebung und mussten dort ohne Aussicht auf Rettung ausharren. Stefan Klein fügt hinzu: „Manche fanden sich allein in ihrer Notlage, andere in Gemeinschaft von Leidensgenossen. Aber jede Hilfe war fern. Jetzt hing das Überleben nur noch vom Glück ab – und von guten Einfällen.“ Das Ringen der Verschollenen zeigt, was der Verstand eines Menschen leisten kann. Vor allem, wenn er ohne jede Unterstützung und Anregung von außen eine unbekannte Situation bewältigen muss. Stefan Klein zählt zu den erfolgreichsten Wissenschaftsautoren der deutschen Sprache. Er studierte Physik und analytische Philosophie in München, Grenoble und Freiburg.
Das 17. Jahrhundert war zugleich ein Zeitalter des Zweifels
Das 17. Jahrhundert war eine Blütezeit des allgemeinen Gelehrten. Die intellektuelle Geschichte dieser Epoche weist jedoch auch eine dunkle Seite auf. Denn das 17. Jahrhundert war zugleich ein Zeitalter des Zweifels. Peter Burke fügt hinzu: „Die Jahre um 1650 offenbaren eine Krise des Bewusstseins beziehungsweise eine Krise des europäischen Geistes.“ Diese sind Bestandteil, der von Historikern so genannten allgemeinen Krise des 17. Jahrhunderts. Der Begriff Krise ist so häufig und auf so viele verschiedene Arten von Veränderung angewendet worden, dass er an intellektuellem Wert eingebüßt hat. In der antiken griechischen Medizin bezeichnet eine „Krise“ jenen Moment im Krankheitsverlauf, der über Genesung oder Tod des Patienten entscheidet. Sechzehn Jahre lehrte Peter Burke an der School of European Studies der University of Sussex. Im Jahr 1978 wechselte er als Professor für Kulturgeschichte nach Cambridge ans Emmanuel College.
Die Bürger möchten wie die Adeligen sein
Die gesellschaftliche und politische Emanzipation des Bürgers fand auch und ganz besonders alltagsnah im Konsum statt. Ulf Poschardt stellt fest: „Das ehrgeizige Bürgertum robbte sich gebückt an den Lebensstil des Hofes und der Adeligen heran.“ Molières „Bürger als Edelmann“ versucht eine Art Travestie höfischen Lebens, um sich gewissen Privilegien anzunähern. Diese hatten Adel und Kirche in Gestalt von Kleider- und Trachtenordnungen erlassen. Gewissen Stoffe und Farben, aber auch luxuriöse Pelze waren nur Privilegierten zu tragen erlaubt. Und so entwickelte sich ab dem 17. Jahrhundert in Frankreich eine bürgerliche Streberkultur. Deren Traum war es, prassen und prunken zu dürfen wie der hohe Adel und die Edelmänner. Seit 2016 ist Ulf Poschardt Chefredakteur der „Welt-Gruppe“ (Die Welt, Welt am Sonntag, Welt TV).
Johannes Böhm untersucht die Sitten der Deutschen
Das tiefere Empfinden einer deutschen Nation begann mit einer gesteigerten Aufmerksamkeit für das deutsche Volk. Das dreibändige Werk „Omnium gentium mores, leges et ritus“, das 1520 erschien, gilt als eine der ersten modernen Überblicksdarstellungen zu Völkern auf der ganzen Welt. Und es erhält die erste ernsthafte Untersuchung zu den Sitten und Gebräuchen des „vierten Standes der Deutschen“. Helmut Walser Smith weiß: „Verfasst hat dieses Opus ein Deutschordensbruder namens Johannes Böhm.“ Dabei knüpfte er an die Renaissance der klassischen Literatur des 15. Jahrhunderts an, insbesondere an Lorenzo Vallas Übersetzung von Herodot ins Lateinische. Johannes Böhm übernahm Herodots Verständnis der Völker und orientierte sich an der Neugier seines antiken Vorbilds für Dinge wie Kleidung, Ernährung und Wohnung. Helmut Walser Smith lehrt Geschichte an der Vanderbilt University in Nashville, Tennessee.
Universalgelehrte wollen das Wissen vereinheitlichen
Was veranlasste Gelehrte früherer Zeiten, derart viele unterschiedliche Themen zu studieren? Im Falle Conrad Gessners mag es schlicht und einfach eine füchsische Neugier gewesen zu sein. Davon abgesehen dürften seine leidenschaftliche Ordnungsliebe und sein Bedürfnis, die „Unordnung der Bücher“ zu beseitigen, fraglos eine gewissen Rolle gespielt haben. Peter Burke fügt hinzu: „Bei anderen Universalgelehrten, den „Igeln“ war das Hauptziel die Vereinheitlichung des Wissens.“ Pico della Mirandola zum Beispiel bietet das eindeutige Beispiel eines Universalgelehrten, der vom Wunsch getrieben ist, widerstreitende Ideen – etwa die von Platon und Aristoteles – in Einklang zu bringen. Sechzehn Jahre lehrte Peter Burke an der School of European Studies der University of Sussex. Im Jahr 1978 wechselte er als Professor für Kulturgeschichte nach Cambridge ans Emmanuel College.
Der „europäische Geist“ erlebte eine Krise
War man um die Mitte des 17. Jahrhunderts durch die zermürbende Erfahrung des Krieges klüger geworden? ES kann jedenfalls kein Zufall sein, dass mehr oder weniger simultan europaweit Tendenzen zu beobachten sind, an allem, was mit überkommenen Machtstrukturen zu tun hat, Kritik zu üben. Jürgen Wertheimer weiß: „Das betrifft Regierungsformen wie Denkstile. England unter der republikanischen Diktatur Oliver Cromwells oder die Revolte der Niederlande gegen die spanische Hegemonie sind nur zwei Beispiele für die beginnende Korrosion traditioneller Herrschaftsgefüge.“ Weit deutlicher jedoch als im Bereich der Politik zeigen sich die Zeichen eines generellen Umbruchs im Bereich der Künste und Wissenschaften. Denn der „europäische Geist“ erlebte in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts eine massive Krise. Jürgen Wertheimer ist seit 1991 Professor für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft und Komparatistik in Tübingen.
Die Kunst schweißt die Menschen zusammen
Kunst schafft Symbole und verwandelt so menschliche Gruppen in Überlebensmaschinen. Sie schweißt die Menschen zusammen. Stefan Klein erklärt: „Kunst wurde demnach umso bedeutender, je mehr Personen zusammenlebten. Zu Schmuckstücken umgewandelte Muscheln etwa können Status und Individualität signalisieren.“ Wenn nämlich Menschen geistig dazu imstande sind, in einem Gegenstand ein Zeichen für etwas ganz anderes zu sehen, hören die bemalten Muscheln auf, nur Kalkschalen von Weichtieren zu sein. Sie sind Zeichen für das Zusammenleben geworden. Solange die Menschen nur sehr wenige waren und kaum Austausch mit anderen pflegten, benötigten sie keine solchen Symbole. Niemand legt im engsten Familienkreis ein Collier an. Stefan Klein zählt zu den erfolgreichsten Wissenschaftsautoren der deutschen Sprache. Er studierte Physik und analytische Philosophie in München, Grenoble und Freiburg.
Die Evolution des Menschen beginnt vor rund fünf Millionen Jahren
Die Evolutionsgeschichte der ersten „Hominini“ ist die Geschichte der frühesten protomenschlichen Vorläufer nach der Abspaltung von dem Vorfahren, den die Menschen der Gegenwart mit den anderen heute noch lebenden Menschenaffen teilen. Hanno Sauer erläutert: „Diese kritische erste Phase unserer Evolution lässt sich ungefähr auf die Zeit vor fünf Millionen Jahren eingrenzen.“ Die erhaltenen Fossilien finden sich hauptsächlich im östlichen Afrika, Äthiopien, Kenia und Tansania. Die zweite Hauptkonfrontation von Fossilienfunden liegt in Südafrika. Heute sind die versteinerten Überbleibsel in paläoanthropologischen Forschungsinstituten auf der ganzen Welt zerstreut. Die Geschichte der Menschwerdung, die diese Funde erzählen, ist vorläufig. Sie bleibt in der „Geiselhaft empirischer Daten“ und droht jederzeit durch neue Entdeckungen revidiert, korrigiert oder überholt zu werden. Hanno Sauer ist Associate Professor of Philosophy und lehrt Ethik an der Universität Utrecht in den Niederlanden.
In Europa gab es lange keine Demokratie
Es ist für Silvio Vietta eigentlich unfassbar, wie lange nach der römischen Republik und deren Zusammenbruch dann die Demokratie in Europa ruht. Es war eine Art Grabesruhe für Jahrhunderte. Im Mittelalter gab es zaghafte Neuansätze in den sich bildenden Stadtkulturen. Die Schweiz macht sich nach dem erfolgreichen Kampf gegen die Habsburger Vorherrschaft in der Schlacht von Sempach 1386 frei von deren Vorherrschaft. Das kleine Land in Mitteleuropa beschritt damit einen Weg hin zu einer halb-direkten Demokratie. Silvio Vietta fügt hinzu: „Ansätze zu einer parlamentarischen Demokratie gab es vor allem in England, wo ab dem 13. Jahrhundert der Monarchie ein Parlament gegenübertrat.“ Prof. em. Dr. Silvio Vietta hat an der Universität Hildesheim deutsche und europäische Literatur- und Kulturgeschichte gelehrt.
Rom erhob den Anspruch auf Universalherrschaft
Der Name „Europa“ kam zwar nicht vor, doch das Imperium Romanum wurde zu seinem Synonym. „Brot und Spiele“ für die Stabilisierung nach innen. Die Losung der „Pax Romana“ für die Befriedung der wahrlich imponierenden Außengrenzen. Jürgen Wertheimer erklärt: „Ein durchgehender Ring römisch beherrschter Gebiete umschloss das Mittelmeer, Gallien, Teile Germaniens und die südliche Hälfte Britanniens war gleichfalls in das Reich integriert.“ Die neue Form einer Herrschpersönlichkeit des Caesars oder ursprünglich des Imperators hielt das Imperium zusammen und dominierte es. Er war kein „König“ als Oberherr eine Clans, eines Volkes, eines Stammes, sondern ein Herrscher in befehlshabender Funktion über alle regionalen Grenzen hinweg. Ursprünglich eher militärisch definiert, wurde der „Kaiser“ spätestens seit Augustus zum Symbol für „Rom“ un die römische Herrschaft. Jürgen Wertheimer ist seit 1991 Professor für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft und Komparatistik in Tübingen.
Das christliche Abendland ist mehr Fiktion als Fakt
Wenn vom „Christlichen Abendland“ die Rede ist, muss laut Michael Wolffsohn zuerst einmal geistiger Müll beseitigt werden. Dasselbe gilt für die „Christlich-Jüdische“ Prägung des Abendlands. Das alles ist mehr Fiktion als Fakt. Das „Christlich-Jüdische“ Abendland ist eine reine Sprache der Wiedergutmachung, weil ein nicht nur deutsches Kollektiv sein schlechtes Gewissen dauerhaft beruhigen möchte. Der nicht selten geistlose Zeitgeist missversteht den Begriff des Christlichen oder Christlich-Jüdischen Abendlandes. Michael Wolffsohn stellt fest: „Da gibt es eher stammtischlerisch grölende Zeitgenossen. Sie wollen die „Islamisierung des Abendlandes“ verhindern. Dabei reden sie sich und anderen ein, das Abendland vor dem neuerlichen Untergang zu retten.“ Das ist der eine Meinungsstrom. Prof. Dr. Michael Wolffsohn war von 1981 bis 2012 Professor für Neuere Geschichte an der Universität der Bundeswehr in München.
Romeo und Julia gehören fest zu Verona
Romantische Italienreisen führen über Verona. Dort bekommen verliebte Paare und einsame Singles das Haus und den Balkon gezeigt, auf dem sich Julia und Romeo ewige Liebe schworen und damit eine Tragödie in Gang setzten. Sie entstammen verfeindeten Familien der Capuletti und der Montecchi, die Verona mit ihren erbitterten Fehden in Atem halten. Daher müssen sie ihre Liebe geheim halten, und heimlich ist auch ihre Heirat. Volker Reinhardt weiß: „Tragisch, wie ihre Liebe begann, endet sie auch. Romeo hält Julia, die nur einen Schlaftrunk zu sich genommen hat, für tot und bringt sich darauf selbst um. Als Julia erwacht und den Toten neben sich sieht, ergreift sie dessen Dolch und folgt ihm in den Tod nach.“ Volker Reinhardt ist Professor für Geschichte der Neuzeit an der Universität Fribourg. Er gehört international zu den führenden Italien-Historikern.
Die Reformation verursachte einen Flächenbrand
Was große Religionskriege der Moderne betrifft, hat Europa eine beachtliche Vorreiterrolle gespielt. Jürgen Wertheimer nennt ein Beispiel: „Mit seinen vermutlich über sechs Millionen Toten ist der sogenannte Dreißigjährige Krieg eine der blutigsten und verheerendsten Katastrophen.“ Was die Zahl der Opfer betrifft, liegt der damit auf Augenhöhe mit dem Zweiten Weltkrieg. Europa war in der beginnenden Neuzeit auf dem Sprung zu einer kultivierten Wissensgesellschaft. Wie konnte es zu diesem gedanklichen und emotionalen Rückschritt kommen? Dynastische Spannungen, Auseinandersetzungen zwischen den Kontinentalmächten Frankreich, Spanien und der Insel, England, gab es im gesamten Mittelalter bis zur Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert. Doch erst mit dem Ereignis der Reformation erhielten die Konflikte jene ideologische Schärfe, die aus ihnen einen verheerenden Flächenbrand machen sollte. Jürgen Wertheimer ist seit 1991 Professor für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft und Komparatistik in Tübingen.
Die Erfindung des Buchdrucks veränderte die Welt
Die Erfindung des Buchdrucks in den 1450er Jahren veränderte die Welt. Sie machte aus Büchern „fliegende Teppiche“ und verlieht Texten „buchstäblich Flügel“. Diese Revolution war weitreichend und unumkehrbar. Helmut Walser Smith erklärt: „Der Buchdruck verschaffte der Sprache eine neue Dauerhaftigkeit, weil er die Sprachdrift aufhielt und Zerfall sowie Zersplitterung neuer Erkenntnisse verlangsamte.“ Wörter wurden von ihrem Verfasser getrennt und gewannen ein Eigenleben. Auf einer Seite angeordnet, ließen sie sich leichter analysieren und sezieren, widerlegen und verbessern. Zudem verschaffte die Druckerpresse Ideen ein breiteres Publikum, nicht nur in den großen Städten, sondern auch in kleineren Orten und Dörfern. Dort trugen lesekundige Menschen die Bücher laut vor und ersetzten so den Geschichtenerzähler. Helmut Walser Smith lehrt Geschichte an der Vanderbilt University in Nashville, Tennessee.
Es entwickelt sich eine neue Form des Rechnens
Die Französische Revolution wollte eine aristokratische Gesellschaft vernichten, die ein glanzvolles Leben geführt und Millionen für üppige Festbanketts ausgegeben hatte. Die Aristokraten kümmerten sich nicht im Mindesten darum, wenn die Bauern unter der Last maßloser Steuern verhungerten. Gerd Gigerenzer ergänzt: „Ein Nebeneffekt der Revolution war der Versuch, die Messsysteme rationaler zu gestalten: ein Dezimalsystem zur Messung von Gewicht, Länge und fast allem anderen einzuführen.“ Das neue System verlangte die Berechnung von logarithmischen und trigonometrischen Tabellen. Das war eine schwierige Aufgabe, die man bisher mathematischen Ausnahmetalenten überlassen hatte. Doch die Französische Revolution entwickelte auch eine neue Version des Rechnens. Gerd Gigerenzer ist ein weltweit renommierter Psychologe. Das Gottlieb Duttweiler Institut hat Gigerenzer als einen der hundert einflussreichsten Denker der Welt bezeichnet.
Das Böse liegt im Menschen selbst
Ohne Geld gibt es keine Kunst, denn Bauwerke, Statuen und Fresken sind teuer. Volker Reinhardt weiß: „Wer Geld hat, braucht Kunst, um seinen wirtschaftlichen Erfolg, seinen sozialen Rang oder seine Macht zu zeigen. Wenn das Geld auf anrüchige Art und Weise verdient wurde, fällt der Kunst sogar die Aufgabe zu, Geld zu waschen.“ Das für Christen schmutzigste aller Geschäfte hat Giotto um 1304 an der Ostwand der Cappella degli Scrovegni in Padua gemalt. Diese nennt man meist Arenakapelle, weil man sie 1300 auf dem Grundstück des verfallenen römischen Amphitheaters errichtete. Die jüdischen Hohepriester wollen den Heiland ins Verderben stürzen und haben zu diesem Zweck einen heimtückischen Plan ausgeheckt. Volker Reinhardt ist Professor für Geschichte der Neuzeit an der Universität Fribourg. Er gehört international zu den führenden Italien-Historikern.