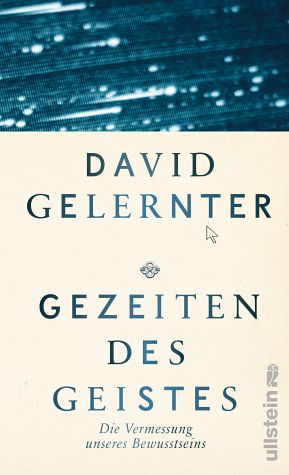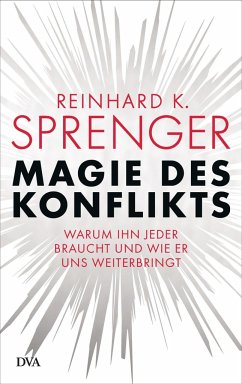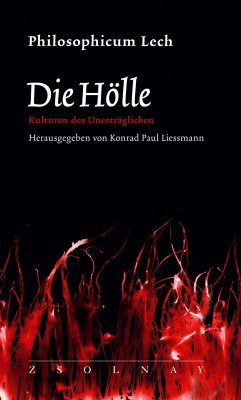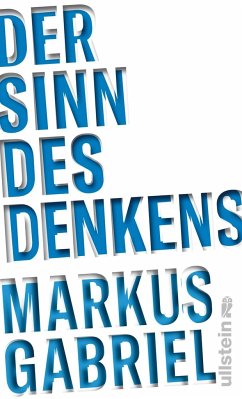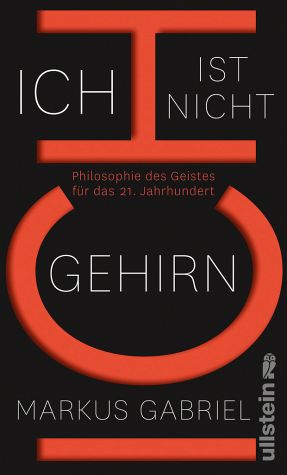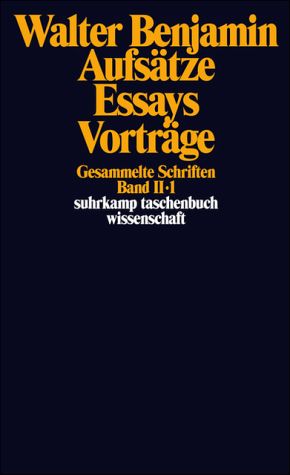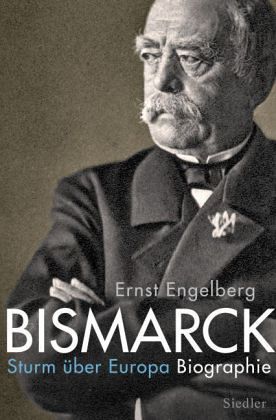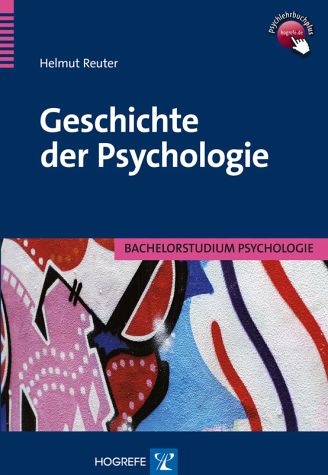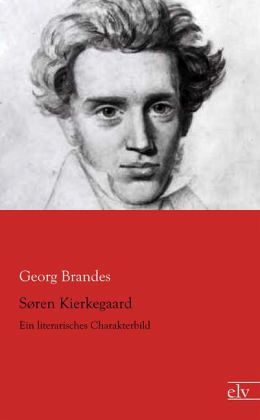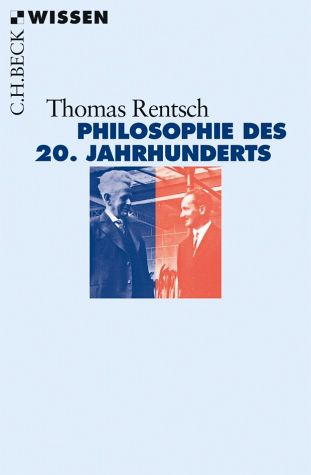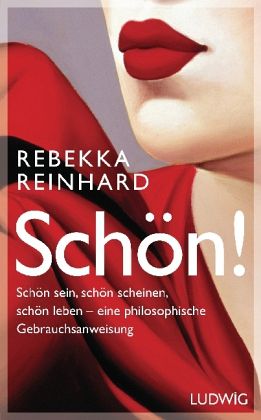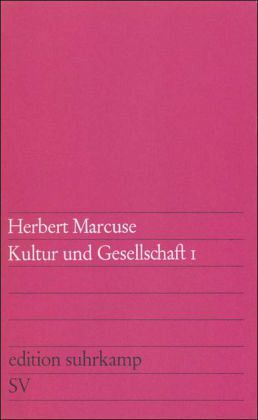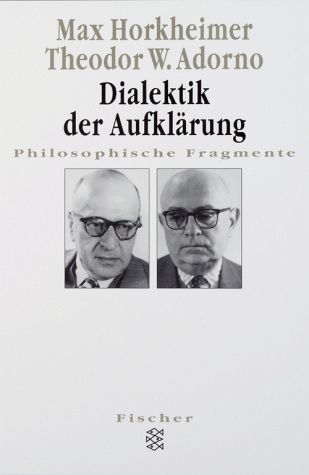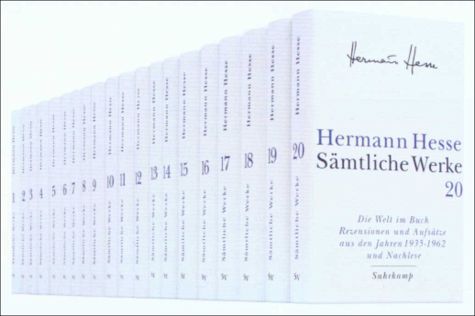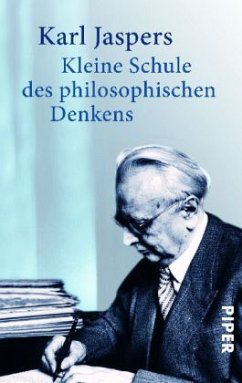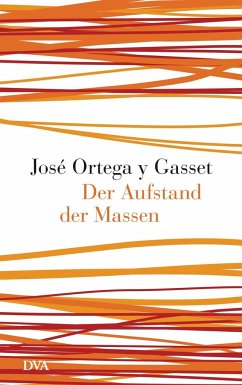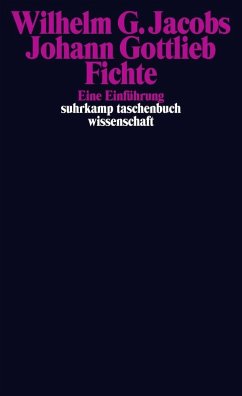Der Geist ist ein Zimmer mit Aussicht: Aus dem Zimmer beobachten die Menschen sowohl die Außenwelt als auch die private Innenwelt. David Gelernter erläutert: „Mental sind wir in unserem Zimmer eingeschlossen, genau wie wir physisch in unserem Körper eingeschlossen sind.“ Die Aussicht ist großartig. Und das ist auch sehr gut so, denn die Menschen können das Zimmer niemals verlassen. In der Philosophie drehen sich viele große, tiefgreifende Fragen um die zweiteilige Realität des Geistes. Immanuel Kant stützt seine beiden grundlegenden, ewig wahren Anschauungen auf den Gegensatz von „innerer“ und „äußerer“ Realität. Die Idee des Raumes unterliegt der Anschauung der Außenwelt. Aber noch vor dem Raum kommt die Zeit, und sie ist eine Anschauung der inneren Welt. David Gelernter ist Professor für Computerwissenschaften an der Yale University.
Objektivität
Das Leben fließt nie konfliktfrei dahin
Harmonie bedeutet laut Reinhard K. Sprenger nicht Gleichklang, sondern Zusammenklang. Letzteres funktioniert nur bei „Gegenstimmen“. Harmonie ist also ein kluger Umgang mit Gegenstimmen. Befreien muss man sich aber vor allem von der Erwartung, das Leben müsse irgendwie konfliktfrei fließen. Jede Verhandlung im Geschäftsleben ist im Grunde konfliktär. Als Beispiel nennt Reinhard K. Sprenger die Tarifverhandlungen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden. Auch in Projekten und Teams ist Konfliktfreiheit wirklichkeitsfremd. Im Grunde ist jede Veränderung mit Spannung verbunden, weil sie alle jene zum Gegner hat, die aus dem Status quo ihre Vorteile ziehen. Das Bild vom ruhigen Fluss führt also in die Irre. Das Gegenteil ist richtig: Konflikt ist das Normale. Reinhard K. Sprenger zählt zu den profiliertesten Managementberatern und wichtigsten Vordenkern der Wirtschaft in Deutschland.
Fake-News sind der Versuch einer gezielten Verwirrung
Bei aller Unsicherheit ist eines sicher: Irgendwo da draußen wird gerade jetzt, in diesem Moment, ziemlich intensiv daran gearbeitet, die traditionelle Idee einer Nachricht, Inbegriff seriöser Information, nach allen Regeln der Kunst zu zersetzen. Bernhard Pörksen erläutert: „Es kursieren in den sozialen Netzwerken jede Menge frei erfundene Behauptungen, die als Nachrichten präsentiert und als solche ausgeflaggt werden.“ Die Welt der Fake-News bildet eine eigene Realitätssphäre, ein sehr spezielles, von Fieberschüben der Erregung geprägtes Sinnbiotop, in dem das Drama die neue Normalität geworden ist und die spektakuläre Enthüllung zur alltäglichen Erfahrung. Wie aber funktioniert das Geschäft mit den Falschnachrichten? Das zentrale Prinzip ist der Versuch einer gezielten Verwirrung, die letztlich die Unterscheidbarkeit von belegbaren Annahmen und bloßen, gänzlich haltlosen Gerüchten unterminiert. Prof. Dr. Bernhard Pörksen lehrt Medienwissenschaft an der Universität Tübingen.
Die Wahrnehmung stellt den Kontakt mit dem Wirklichen her
Die Wahrnehmung nimmt nicht nur Informationen auf, indem die Sinnesorgane eines Menschen Teil der Natur sind, die er wahrnimmt. Markus Gabriel erklärt: „Das liegt daran, dass die Wahrnehmung intern strukturiert ist und Unterschiede erschließt, etwa den Unterschied zwischen rot und blau oder süß und sauer.“ Wenn ein Mensch etwas wahrnimmt, schaut er nicht auf eine sinnliche Wirklichkeit, von der er ausgeschlossen ist. Er blickt nicht von außen in die Wirklichkeit hinein oder hört mal kurz ins Universum. Das bedeutet, ein Mensch muss sich nicht mittels der Wahrnehmung einer fremden Außenwelt annähern, sondern ist dank ihr bereits mit dem Wirklichen in Kontakt. Seit 2009 hat Markus Gabriel den Lehrstuhl für Erkenntnistheorie und Philosophie der Neuzeit an der Universität Bonn inne und ist dort Direktor des Internationalen Zentrums für Philosophie.
Das Ich will an die Stelle von Gott treten
Das Ich hat sich zum kleinen Gott auf Erden entwickelt. Alle reden vom Ich. Markus Gabriel nennt Beispiele: „Es geht um die Frage, inwieweit der Egoismus gerechtfertigt sein soll, um die Ich-AG und vieles mehr.“ Neurozentriker schwanken zwischen der Identifikation des Ich mit dem Gehirn und der Bestreitung seiner Existenz – auf die man zurückgreift, wenn man merkt, dass der Reduktionismus in keiner Spielart so recht auf das Ich passen will. An dieser Stelle rät Markus Gabriel einen Blick auf die Geistesgeschichte zu werfen. Einer der Ersten, die das Personalpronomen „ich“ in der deutschen Sprache zu „das Ich“ substantiviert haben, war der mittelalterliche Philosoph Meister Eckhart (1260 – 1328). Markus Gabriel hat seit 2009 den Lehrstuhl für Erkenntnistheorie und Philosophie der Neuzeit an der Universität Bonn inne und ist dort Direktor des Internationalen Zentrums für Philosophie.
Markus Gabriel stellt Johann Gottlieb Fichte vor
In der Wissenschaftslehre von Johann Gottlieb Fichte gibt es drei Grundsätze. Sie zeigen, worum es beim Ich eigentlich geht. Markus Gabriel erklärt: „Der erste Grundsatz der Wissenschaftslehre lautet: „Ich = Ich“.“ Das sieht auf den ersten Blick trivial aus, ist es aber nicht. Denn man könnte ja meinen, dass man alles mit sich selbst uninformativ gleichsetzen könne. Dies nennt man eine Tautologie. Damit etwas mit sich selbst identisch sein kann, muss es anscheinend überhaupt existieren können. Das Ich bedeutet zunächst nichts weiter als diejenige, derjenige, dasjenige, das etwas weiß. Dies kann man nicht bestreiten. Markus Gabriel hat seit 2009 den Lehrstuhl für Erkenntnistheorie und Philosophie der Neuzeit an der Universität Bonn inne und ist dort Direktor des Internationalen Zentrums für Philosophie.
Menschen sind zum Guten und zum Bösen fähig
Eine Antwort auf die Frage, warum Menschen nicht einfach nur gnadenlose egoistische Raubtiere sind – obwohl sie sich so verhalten können –, lautet, dass Menschen die Fähigkeit haben einzusehen, dass andere Menschen respektiert werden sollen. Um dies weiter zu begründen, weist Markus Gabriel darauf hin, dass auch andere Menschen ein bewusstes Leben führen. Ein bewusstes Leben zu führen heißt, sich als subjektives Zentrum eines Geschehens, als Ich zu erleben. Das menschliche bewusste Leben verfügt überdies über die Möglichkeit, verstehen zu können, dass es andere Zentren des Geschehens gibt als das eigene. Diese Einsichten hält der amerikanische Philosoph Thomas Nagel für die Grundlage der Ethik. Markus Gabriel hat seit 2009 den Lehrstuhl für Erkenntnistheorie und Philosophie der Neuzeit an der Universität Bonn inne und ist dort Direktor des Internationalen Zentrums für Philosophie.
Walter Benjamin stellt seine Philosophie der Zukunft vor
Für Walter Benjamin ist es die zentrale Aufgabe der kommenden Philosophie die tiefsten Ahnungen, die sie aus der Zeit und dem Vorgefühl einer großen Zukunft schöpft, durch die Beziehung auf das Philosophiesystem von Immanuel Kant zu Erkenntnis werden zu lassen. Walter Benjamin begründet dies wie folgt: „Denn Kant ist von denjenigen Philosophen, denen es nicht unmittelbar um den Umfang und die Tiefe, sondern vor Allem, und zu allererst, um die Rechtfertigung der Erkenntnis ging der jüngste und nächst Platon auch wohl der Einzige.“ Der deutsche Philosoph, Literaturkritiker und Übersetzer Walter Benjamin wurde am 15. Juli 1892 in Berlin geboren. Am 26. September 1940 nahm er sich auf der Flucht vor der Gestapo an der spanischen Grenze das Leben.
Ohne Otto von Bismarck hätte es kein Deutsches Reich gegeben
Die große Biographie von Ernst Engelberg über Otto von Bismarck wird von vielen Historikern und Politikwissenschaftlern als ein Meisterwerk deutscher Geschichtsschreibung bezeichnet. Ernst Engelberg, einer der bedeutendsten Historiker des 20. Jahrhunderts, schuf darin das faszinierende Bild einer einzigartigen Persönlichkeit und einer herausragenden politisches Werkes, das zuletzt allerdings Züge von Tragik annahm. Zum 200. Geburtstag Otto von Bismarcks liegt der Klassiker nun in einer aktualisierten und gekürzten Neuausgabe im Siedler Verlag vor. In seiner Biographie über Otto von Bismarck breitet Ernst Engelberg gleichzeitig vor seinen Lesern das breite Panorama einer Epoche und ihrer widerstreitenden Kräfte aus. Er beschreibt den Lebensweg Otto von Bismarcks, der mit der Schaffung des Deutschen Reiches letztlich jenes Altpreußen aufhob, dem er mit allen Wurzeln anhing und dem seine ganze Liebe gehörte.
Die Erinnerung ist die Schwester des kritischen Bewusstseins
Die Geschichtsschreibung ist eine uralte Form der Dokumentation der Vergangenheit. Als Beispiele für frühe Dokumentoren nennt Helmut Reuter Caesar, Tacitus und Herodot. Eine solche Arbeit hat mehrere Funktionen, die offenen und versteckten Zielsetzungen, Ideologien oder Zeitstilen folgen. Die Geschichtswissenschaft erklärt, welche Akzente dabei eine Rolle spielen und wie diese Akzente sich abhängig vom gesellschaftlichen und politischen Wandel verbünden können. Als Beispiel nennt Helmut Reuter zunächst die Geschichte der großen Männer, eine weit bis in das 20. Jahrhundert als selbstverständlich verwendete Form der Darstellung. Neueren Datums ist dagegen die Beschreibung des sozialen Wandels einer Gesellschaft, oft mit einem deutlichen Akzent von unten. Damit sind die Erzählungen und die Lebenserfahrungen des Alltags und der Menschen, die den Alltag gestalten, gemein. Helmut Reuter ist seit 2004 Professor am Institut für Psychologie und Kognitionsforschung (IPK) der Universität Bremen.
Sören Kierkegaard hofft auf die göttliche Erlösung
Der Däne Sören Kierkegaard (1813 – 1855) entwickelt schon bei seinem Studium in Berlin die ersten Grundzüge einer Philosophie der subjektiven Existenz und wird dadurch zu einem der Begründer der späteren Existenzphilosophie. Sören Kierkegaard stammte aus einem streng religiösen Elternhaus und studierte auf Wunsch seines Vaters Theologie und hing einer freigeistigen Romantik an. Später entwickelte er sich zum engagierten, religiösen Schriftsteller, der das bürgerliche Schein- und Sonntagschristentum anprangerte. Nachdem er sich lange hinter Pseudonymen versteckt hatte, wandte er sich zuletzt in aller Öffentlichkeit gegen die Kirche und starb, nach einem Zusammenbruch auf der Straße, völlig mittellos im Alter von 42 Jahren.
Die menschliche Existenz ist absurd und vom Zufall bestimmt
Jean-Paul Sartre, der von 1905 bis 1980 lebte, wurde nach dem Zweiten Weltkrieg zu dominierenden Identifikationsfigur des französischen Existentialismus. Angesichts der katastrophalen und auch ideellen Zerstörungen und Verwüstungen schien lediglich die aus sich selbst zurückgeworfene einzelne Existenz übrigzubleiben. Jean-Paul Sartre analysiert diese Situation umfassend in seinem Hauptwerk „Das Sein und das Nichts“. Darin stellt er das Für-sich-sein des Menschen in Bewusstsein und Freiheit, dass bewusstlose An-sich-sein der Objektivität gegenüber. Das Für-sich-sein ist durch das Nichts begründet. Existenzdialektisch formuliert, heißt das dann: Die Menschen sind, was sie nicht sind, und sie sind nicht, was sie sind. Faktizität und Transzendenz bestimmen einander. Entsprechend radikal ist das Verständnis der Freiheit bei Jean-Paul Sartre: Die Menschen sind zur Freiheit verurteilt. Die menschliche Existenz ist vom Zufall bestimmt und absurd.
In der Erotik bestimmen individuelle Vorlieben die Schönheit
Der große Denker Immanuel Kant schrieb über die Schönheit folgenden Satz: „Ein jeder muss eingestehen, dass dasjenige Urteil über Schönheit, worin sich das mindeste Interesse mengt, sehr parteilich und kein reines Geschmacksurteil sei.“ Triebhaftigkeit hat bei ihm keinen Platz. Für Rebekka Reinhard ist das Motiv dafür klar. Ihrer Meinung nach bringt nichts die Herrschaft des kühl urteilenden Verstandes schneller zu Fall als der animalische Drang nach Schönheit. Rebekka Reinhard fügt hinzu: „Liebe ist aufgrund des ihr eigenen erotischen Trachtens die natürliche Feindin zweckfreier Kontemplation.“ Dr. Rebekka Reinhard studierte Philosophie, Amerikanistik und Italianistik und promovierte über amerikanische und französische Gegenwartsphilosophie. Zu ihren erfolgreichen Büchern zählen „Die Sinn-Diät“, „Odysseus oder Die Kunst des Irrens“ und „Würde Platon Prada tragen?“
Die Vernunft setzt sich gegen das Glück der Menschen durch
Die idealistische Philosophie der bürgerlichen Epoche hatte das Allgemeine, das sich in den isolierten Menschen durchsetzen sollte, unter dem Titel der Vernunft zu verstehen versucht. Der Mensch erscheint als ein gegen die anderen in seinen Trieben, Gedanken und Interessen vereinzeltes Ich. Die Überwindung dieser Vereinzelung, der Aufbau einer gemeinsamen Welt geschieht laut Herbert Marcuse durch die Reduktion der konkreten Individualität auf das Subjekt des bloßen Denkens, das vernünftige Ich. Herbert Marcuse erklärt: „Die Gesetze der Vernunft bringen unter Menschen, deren jeder zunächst nur seinem besonderen Interesse folgt, schließlich eine Gemeinsamkeit zustande.“ Dabei können einige Formen der Anschauung und des Denkens als allgemeingültig sichergestellt werden. Aus der Vernünftigkeit eines Individuums lassen sich gewisse allgemeine Maximen des Handelns gewinnen.
Walter Benjamin hinterfragt das Wesen der sittlichen Bildung
Walter Benjamin untersucht in einer kleinen theoretischen Abhandlung aus dem Jahr 1913, wie sich der Moralunterricht zu absoluten pädagogischen Forderungen verhält. Dabei stellt er sich auf den Boden der Ethik von Immanuel Kant, der zwischen Legalität und Moralität unterscheidet. Bei Immanuel Kant heißt es: „Bei dem, was moralisch gut sein soll, ist es nicht genug, dass es dem sittlichen Gesetz gemäß sei, sondern es muss auch um desselben Willen geschehen.“ Damit ist für Walter Benjamin zugleich eine weitere Bestimmung des sittlichen Willens gegeben: er ist frei von Motiven, ausschließlich bestimmt durch das Sittengesetz, die Norm, die da heißt: handle gut. Der deutsche Philosoph, Literaturkritiker und Übersetzer Walter Benjamin wurde am 15. Juli 1892 in Berlin geboren. Am 26. September 1940 nahm er sich auf der Flucht vor der Gestapo an der spanischen Grenze das Leben.
Theodor W. Adorno macht sich Gedanken über den Fortschritt
Theodor W. Adorno ist fest davon überzeugt, dass man den Begriff Fortschritt gar nicht grob genug verwenden kann. Denn Pedanterie in seinem Gebrauch betrügt seiner Meinung nach nur um das, was er verheißt, Antwort auf den Zweifel und die Hoffnung, dass es endlich besser werde, dass die Menschen einmal aufatmen dürfen. Theodor W. Adorno schreibt: „Schon darum lässt nicht genau sich sagen, was sie unter Fortschritt sich vorstellen sollen, weil es die Not des Zustandes ist, dass jeder diese fühlt, während das lösende Wort fehlt. Wahrheit haben nur solche Reflexionen über den Fortschritt, die in ihn sich versenken und doch Distanz halten, zurücktreten von lähmenden Fakten und Spezialbedeutungen.“ Theodor W. Adorno, geboren am 11. September 1903 in Frankfurt am Main, gestorben am 6. August 1969, lehrte in Frankfurt als ordentlicher Professor für Philosophie und Direktor des Instituts für Sozialforschung an der Johann Wolfgang Goethe-Universität.
Herbert Schnädelbach philosophiert über Sinn und Bedeutung
Für Herbert Schnädelbach schillert der Sinnbegriff in allen Farben. Er sieht ein Spektrum vor sich, das sich vom Gesichtssinn über den Uhrzeigersinn, den Sinn von Wort und Taten bis zum Sinn des Lebens erstreckt. Die Philosophen interessieren sich vor allem für den Mitteilungssinn und den Handlungssinn. Die beiden dementsprechenden Begriffspaare „Sinn und Bedeutung“ sowie „Sinn und Zweck“ sind den Menschen auch im Alltagsgespräch vertraut. Herbert Schnädelbach wirft einen Blick zurück in die Geschichte und erklärt: „Erst im 19. Jahrhundert stieg „Sinn“ zu einem zentralen Problemtitel der Philosophie auf, und dies nicht nur im Zusammenhang mit der Frage nach dem Sinn des Lebens, die in dieser Formulierung dem 18. Jahrhundert noch nicht geläufig war, sondern vor allem vor dem Hintergrund des Endes der klassischen Metaphysik, das den Gedanken nahelegte, das Ganze der Welt könnte sinnlos sein. Vor seiner Emeritierung war Herbert Schnädelbach Professor für Philosophie an den Universitäten Frankfurt am Main, Hamburg und an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Hermann Hesse liebt das Wort Glück seit Knabentagen
Für Hermann Hesse ist der Mensch mit einem Organ für das Schöne geboren, das ihm die Fähigkeit verleiht, sich an Dingen zu freuen, auch wenn sie ihm nicht nützen. An der Freude des Menschen am Schönen sind seiner Meinung nach stets der Geist und die Sinne im gleichen Maß beteiligt. Solange die Menschen dazu fähig sind, sich mitten in den Drangsalen und Gefährdungen ihres Lebens, sich an scheinbar Nebensächlichem zu erfreuen, wird er seinem Dasein immer wieder einen Sinn zuschreiben können. Hermann Hesse zählt zu diesen Dingen beispielsweise ein Farbenspiel in der Natur, das Kopfdrehen einer spielenden jungen Katze oder das Variationenspiel einer Sonate.
Eine illustrierte Reise durch das philosophische Denken
David Papineau, Professor für Philosophie an der Universität London, schreibt als Herausgeber in der Einführung zum Buch „Philosophie“: „Nur wenige Menschen sind dazu berufen, der Philosophie alles zu opfern; aber auch sonst gibt es Faktoren genug, warum Philosophie für jeden von uns von Bedeutung ist.“ Seiner Meinung nach müssen alle verantwortungsvollen Menschen zumindest zu bestimmten Zeiten ihres Lebens innehalten, um nachzudenken, ob sie tatsächlich das Richtige tun. David Papineau glaubt sogar, dass eine Gesellschaft, in der die Menschen niemals nach der fundamentalen Natur der Realität fragen, um einiges ärmer wäre. Philosophie wird für ihn immer dann benötigt, wenn ein Individuum mit Fragen konfrontiert wird, die nicht nur wichtig, sondern auch intellektuell ungewöhnlich sind.
Friedrich Hegel definiert den Endzweck der Menschheit
Das Ziel der Weltgeschichte ist laut Friedrich Hegel, dass der Geist zum Wissen dessen gelangt, was er wahrhaftig ist, und dies Wissen gegenständlich macht, es zu einer vorhandenen Welt verwirklicht, sich als objektiv hervorbringt. Das Wesentliche dabei ist, dass dies Ziel ein Hervorgebrachtes ist. Friedrich Hegel definiert den Geist als einen, der sich hervorbringt und sich zu dem macht, was er ist. Das Sein des Geistes ist kein ruhendes Dasein, sondern ein absoluter Prozess. In diesem Prozess sind wesentliche Stufen enthalten, und die Weltgeschichte ist die Darstellung des göttlichen Prozesses, indem der Geist sich selbst verwirklicht. Das funktioniert allerdings nur, wenn er seine Wahrheit weiß.
Karl Jaspers erforscht den Ursprung der Philosophie
Die Geschichte der Philosophie beginnt als methodisches Denken vor zweieinhalb Jahrtausenden, als mythisches Denken aber schon viel früher. Der Ursprung ist laut Karl Jaspers vielfach. Aus dem Stauen der Menschen folgen die Fragen und daraus wieder die Erkenntnis. Aus dem Zweifel am Erkannten folgt die kritische Prüfung und daran anschließend die klare Gewissheit. Als letztes folgt aus der Erschütterung des Menschen, aus dem Bewusstsein seiner Verlorenheit heraus, die Frage nach sich selbst. Karl Jaspers zitiert bei seiner Suche nach den Wurzeln der Philsophie den Griechen Platon, der den Ursprung der Philosophie im Erstaunen festmachte.
José Ortega Y Gasset erforscht das Denken
Das Denken ist für José Ortega Y Gasset eine Lebensfunktion wie die Verdauung und der Blutkreislauf. Ein Urteilsakt ist ein Elementarteilchen des menschlichen Lebens, ein Willensakt nicht minder. Sie sind Ausstrahlungen oder Momente in dem kleinen menschlichen Kosmos, dem organischen Lebewesen. Das Denken ist ein Vorgang wie die Nahrungsaufnahme oder die Arbeit des Herzens, wenn es das Blut durch die Adern pumpt. In allen diesen Fällen handelt es sich um vitale Notwendigkeiten. In einem Menschen als organischem Wesen liegen der Seinsgrund und die Rechtfertigung seines Denkens beschlossen. Das Denken ist ein Instrument, ein Organ des Menschen und wird vom Leben reguliert und gelenkt.
Die Philosophie des absoluten Idealismus
Johann Gottlieb Fichte wurde am 19. Mai 1762 in Rammenau bei Bischofswerda in ärmlichen Verhältnissen geboren. Ein Adliger, der das geistige Potential des Jungen erkannte, ermöglichte ihm eine gute Ausbildung. Zuerst erhielt Johann Gottlieb Fichte Privatunterricht bei einem Pastor, besuchte anschließend die Fürstenschule Schulpforta und studierte schließlich an der Universität in Jena. Nach seinem Studium lebte der Philosoph in großer Armut, da sein Gönner gestorben war. Johann Gottlieb Fichte wurde gleich mit seinem ersten philosophischen Werk „Versuch einer Kritik aller Offenbarung“, dass 1792 anonym erschien, bekannt.