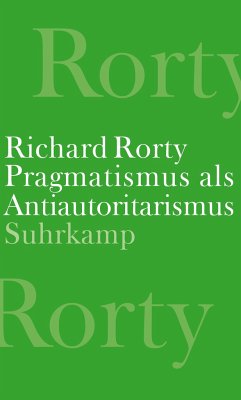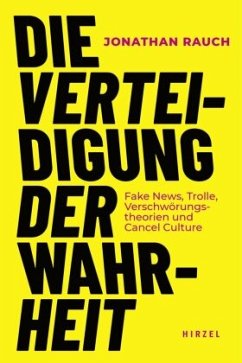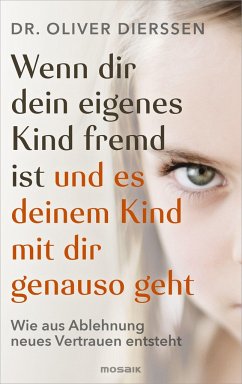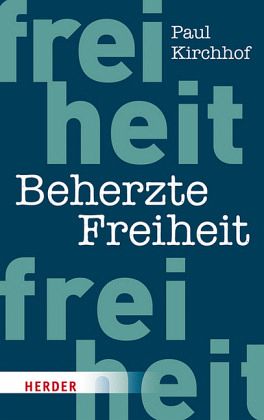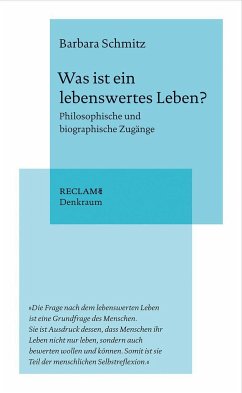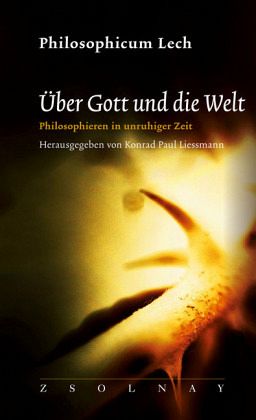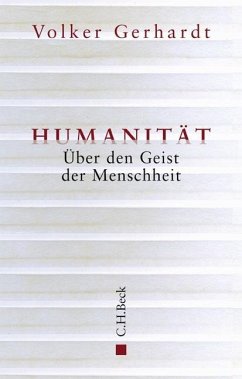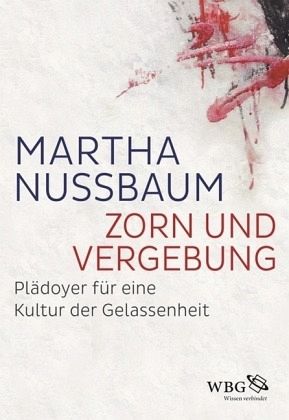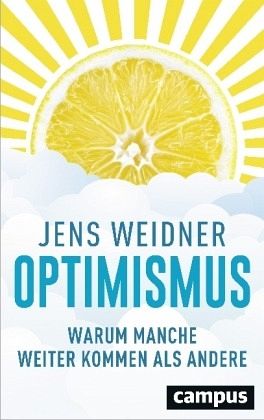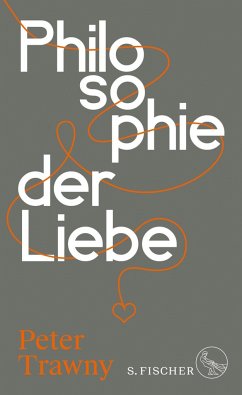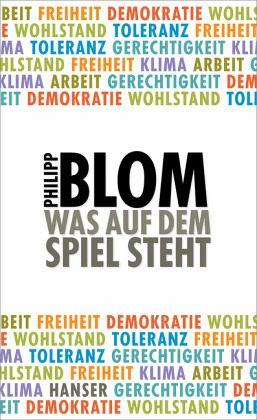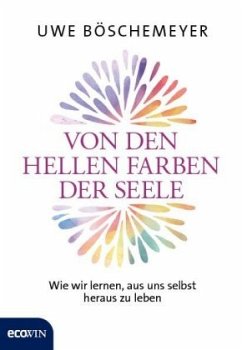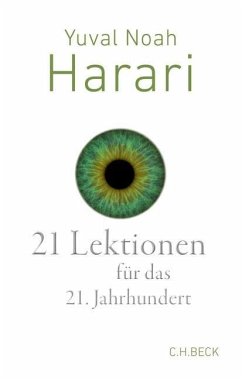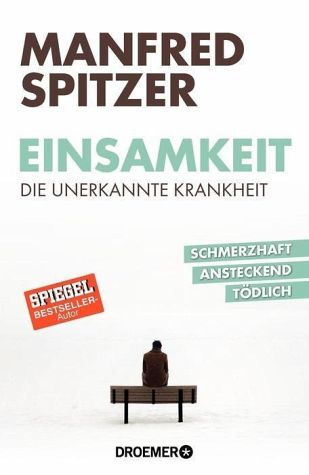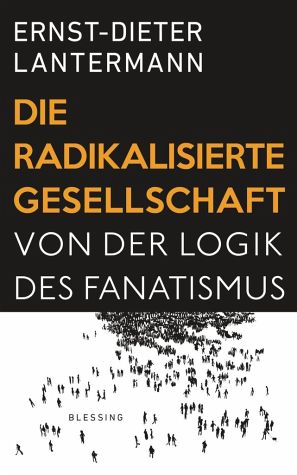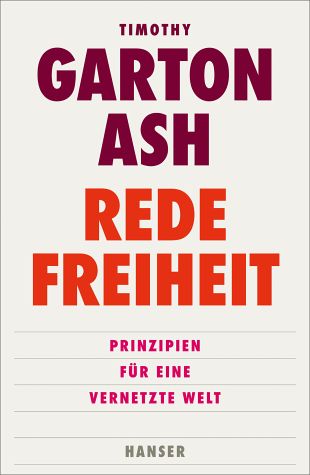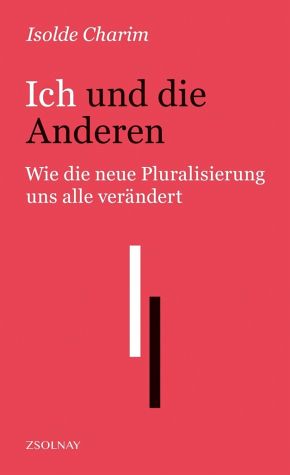Der 26. Band des Philosophicums Lech mit dem Titel „Alles wird gut“ handelt von der Hoffnung. Konrad Paul Liessmann beginnt seinen Beitrag mit einer alten Weisheit: „Solange ich atme, hoffe ich.“ Diese Sentenz gehört wahrscheinlich zu den meistzitierten Sätzen der Antike. Sie wird gemeinhin Marcus Tullius Cicero zugeschrieben. Wer hofft, ist in unruhiger Erwartung im Hinblick auf ein kommendes Ereignis. Die innere Bewegtheit der Hoffnung zeigt an, dass diese prinzipiell zukunftsgerichtet ist. Konrad Paul Liessmann fügt hinzu: „Hoffnung ist eine Form, sich emotional auf ein positiv gedachtes Zukünftiges einzustellen. Das Gegenteil ist die Furcht.“ Hoffen hat zudem eine soziale Komponente. Man kann für sich selbst etwas erhoffen; und man kann hoffen, dass einem anderen Menschen eine gute Zeit bevorsteht, sein Unternehmen gelingt, seine Wünsche sich erfüllen.
Hoffnung
Das Über-Ich kann von Schuld und Schande befreien
Sigmund Freud Erklärung des Ursprungs des Gewissens, des Über-Ichs, ist nach Richard Rortys Eindruck eine weitere Lesart des John Dewey motivierenden Antiautoritarismus. Zwischen zwei Menschentypen besteht ein Verhältnis wechselseitigen Unverständnisses. Richard Rorty erklärt: „Die erste Gruppe umfasst diejenigen, die ihre größten Hoffnungen in die Vereinigung mit etwas Übermenschlichem setzen. Dabei handelt es sich um eine Quelle des Über-Ichs, die genügend Autorität besitzt, um die Menschen von Schuld und Schande zu befreien. Zur zweiten Gruppe gehören jene, die ihre größten Hoffnungen in eine bessere Zukunft des Menschen setzen, die man durch ein höheres Maß an brüderlicher Zusammenarbeit zwischen den Menschen erreichen will. Richard Rorty (1931 – 2007) war einer der bedeutendsten Philosophen seiner Generation. Zuletzt lehrte er Vergleichende Literaturwissenschaft an der Stanford University.
Die Redefreiheit hat sich als robust erwiesen
Jonathan Rauch ist kein Alarmist. Ganz im Gegenteil, er schreibt sein Buch „Die Verteidigung der Wahrheit“ in einem Geist der Hoffnung und des vorsichtigen Optimismus. Denn in der digitalen Medienwelt geht man mit beeindruckendem Engagement und neuen Ansätzen gegen Desinformationsangriffe vor. Und der Feind hat nicht mehr den Vorteil der Überraschung auf seiner Seite. Jonathan Rauch ergänzt: „In der akademischen Welt gibt es immer noch große Bestände von wissenschaftlicher Integrität, die man anzapfen kann. Die heutigen Herausforderungen für die Verfassung der Erkenntnis sind unter historischen Gesichtspunkten betrachtet vergleichsweise harmlos. Das eigentliche Wunder ist, als wie robust sich die Redefreiheit und die liberale Wissenschaft erwiesen haben. Jonathan Rauch studierte an der Yale University. Als Journalist schrieb der Politologe unter anderem für das National Journal, für The Economist und für The Atlantic.
Aus Ablehnung kann Vertrauen entstehen
Oliver Dierssen vertritt in seinem Buch „Wenn dir dein eigenes Kind fremd ist und es deinem Kind mit dir genauso geht“ unter anderem die These, dass der sanftmütige, geduldige und ehrliche Umgang mit Kindern nicht nur deren Leben verbessert, sondern auch die Gesellschaft an sich. Kinder, deren Grenzen man respektiert, entwickeln sich später zu Erwachsenen, welche die Grenzen anderer spüren und ernst nehmen. Kinder, denen man feinfühlig und geduldig begegnet, leben später die Werte von Mitgefühl und Rücksichtnahme und geben sie weiter. Aus einer solchen Kindheit speist sich die Kraft, sich zu dem erwachsenen Menschen zu entwickeln, der man aufgrund der eigenen Veranlagungen, Sehnsüchte und Träume werden möchte. Dr. med. Oliver Dierssen ist als niedergelassener Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Region Hannover tätig.
Menschen sehnen sich nach Gewissheit
In Begrenzungen und Zweifeln sehen sich die meisten Menschen nach Eindeutigkeit. Sie wollen mehr Gewissheit, als ihnen möglich ist. Menschen hoffen auf eine bessere Zukunft und vertrauen ihren Mitmenschen. Sie staunen und erleben Geheimnisse. Sie suchen zu vergessen und zu vergeben. Paul Kirchhof fügt hinzu: „Ein Mensch, der nicht hoffen kann, der nicht nach dem Besseren, auch nach dem Unerreichbaren strebt, fiele in eine Leere, die den Sinn seines Lebens in Frage stellte.“ Hoffnungslosigkeit nähme seiner Freiheit einen wesentlichen Impuls und würde den Aufbruch zu Fortschritt und Erneuerung ersticken. Dr. jur. Paul Kirchhof ist Seniorprofessor distinctus für Staats- und Steuerrecht an der Universität Heidelberg. Als Richter des Bundesverfassungsgerichts hat er an zahlreichen, für die Entwicklung der Rechtskultur der Bundesrepublik Deutschland wesentlichen Entscheidungen mitgewirkt.
Barbara Schmitz erforscht das lebenswerte Leben
In ihrem Essay „Was ist ein lebenswertes Leben?“ stellt Barbara Schmitz fest, dass die Frage sich nicht systematisch und linear behandeln lässt. Denn es gibt darauf keine eindeutige Antwort. Es handelt sich hier vielmehr um eine Frage, die eine subjektive Antwort eines Individuums verlangt: „Eine Antwort, die immer auch die Erfahrungen des jeweiligen Menschen spiegelt.“ Deshalb nimmt Barbara Schmitz in ihrem Essay immer wieder Bezug auf biographische Erfahrungen. Die mündlichen und biographischen Berichte bilden die Anstöße zur philosophischen Reflexion, die das Anliegen dieses Essays ist. Individuelle Erfahrungen sind ihr Ausgangspunkt, die mit philosophischen Begriffen, Theorien, Positionen und Debatten verbunden werden. Barbara Schmitz ist habilitierte Philosophin. Sie lehrte und forschte an den Universitäten in Basel, Oxford, Freiburg i. Br., Tromsø und Princeton. Sie lebt als Privatdozentin, Lehrbeauftragte und Gymnasiallehrerin in Basel.
Die Hoffnung ist eine Kraftspenderin in der Not
Das Titelthema des neuen Philosophie Magazins 05/2021 handelt von der Hoffnung. Chefredakteurin Svenja Flaßpöhler schreibt im Editorial: „Keine Revolution, keine Fridays for Future, keine Zukunft gäbe es ohne den festen Glauben an das Gelingen. Die Hoffnung muss sich von der Angst lösen, um Kraft zu entwickeln.“ Positive Erwartungen sind allerdings auch risikobehaftet. Was, wenn das Erhoffte nicht eintritt? Gar alles noch schlimmer kommt? Andererseits gilt: Wenn die Furcht jede Hoffnung im Keim erstickt, gäbe es kein lebenswertes Morgen mehr. Es besteht für viele Menschen kein Zweifel daran, dass die Hoffnung eine Energiequelle ist, eine Kraftspenderin in der Not. Die antiken Stoiker sahen weder in der Hoffnung noch in der Furcht den Weg zu einem gelingenden Leben. Vielmehr rieten sie ab von jeder affektiven Zukunftserwartung und forderten eine vernunftgeleitete Konzentration auf das Hier und Jetzt.
Die Ästhetik konkurriert mit der Philosophie
Was heißt es, ein Mensch zu sein? Und insbesondere was heißt es in der heutigen Zeit ein Mensch zu sein? Das sind Fragestellungen, die typisch für Philosophen sind. Aber die Philosophie hat in ihrem Versuch, die großen Fragen nach dem Menschen und seinem in der Welt sein zu beantworten, durchaus auch Konkurrenz. Lambert Wiesing stellt fest: „Der zweifellos bekannteste Mitbewerber ist die Religion.“ Man sollte seiner Meinung allerdings folgendes nicht übersehen. Nämlich dass es noch einen weiteren wichtigen Mitbewerber für die Zuständigkeit für die großen Fragen gibt. Denn es ist keineswegs so, dass sich nur die Philosophie und die Religion mit der Frage nach der „conditio humana“ befassen. Prof. Dr. Lambert Wiesing lehrt an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena Bildtheorie und Phänomenologie. Außerdem ist er geschäftsführender Direktor des Instituts für Philosophie.
Den Menschen zeichnet ein Selbstinteresse aus
Der Mensch hat gleich mehrere Formeln zu seiner Selbstbeschreibung in Umlauf gebracht. Das kann man als Folge der Vielfalt seiner Fähigkeiten und Merkmale ansehen. Volker Gerhardt stellt fest: „Es ist gewiss aber auch Ausdruck seines vermutlich schon vor der klassischen Antike auf sich selbst gerichteten Interesses.“ Die Begriffe sind wie Spiegel, in denen der Mensch sich seiner Wirkung auf sich selbst zu versichern sucht. In den aus älteren Zeiten überlieferten Texten macht das Selbstinteresse den Umweg über die Widergabe von Geschichten. In denen haben sich Menschen zu bewähren. Es geht um Kämpfe mit Ungeheuern und todbringenden Feinden sowie um Berichte über Triumphe und Niederlagen. Volker Gerhardt war bis zu seiner Emeritierung 2014 Professor für Philosophie an der Humboldt-Universität in Berlin.
Zorn entsteht oft durch eine Statusverletzung
In der von der Psychologin Carol Travis vorgelegten umfangreichen empirischen Untersuchung des Zorns finden sich überall Belege für „Kränkungen“, „Geringschätzigkeit“, „herablassendes Verhalten“ und eine „Behandlung, als hätte man keine Bedeutung“. Die Menschen sind heutzutage wie auch in früheren Zeiten ungemein besorgt um ihr Ansehen. Und sie haben eine endlose Bereitschaft, sich von Handlungen, die sie dem Anschein nach darin bedrohen, in Zorn versetzen zu lassen. Diese Art der empfundenen Herabsetzung bezeichnet Martha Nussbaum als „Statusverletzung“. Allein die Idee der Statusverletzung schließt bereits die Vorstellung einer Unrechtmäßigkeit ein. Denn Statusminderung ist gemeinhin beabsichtigt, wie schon der griechische Philosoph Aristoteles wusste. Martha Nussbaum ist Philosophin und Professorin für Rechtswissenschaften und Ethik an der University of Chicago. Sie ist eine der einflussreichsten Philosophinnen der Gegenwart.
Optimisten machen das Beste aus ihrem Leben
Jens Weidner unterscheidet fünf Typen bei den Optimisten: den Zweckoptimisten, den naiven Optimisten, den heimlichen Optimisten, den altruistischen Optimisten und den Best-of-Optimisten. Einen Zweckoptimisten definiert er wie folgt: „Zweckoptimisten sind feine Menschen mit einem sehr langem Atem, wenn es darum geht, sich auf die positiven Aspekte einer schwierigen beruflichen Aufgabe zu konzentrieren.“ Zweckoptimismus ist besonders in sozialen Berufen oder auch in Veränderungsprozessen gefragt, wenn es notwendig wird, dem Unangenehmen positive Seiten abzugewinnen, selbst wenn die Umstände kaum veränderbar sind, weil sie durch Krankheiten oder Alterungsprozesse ausgelöst sind. Zweckoptimisten demonstrieren Durchhaltevermögen und wünschen sich heimlich, dafür auch etwas Bewunderung zu ernten. Sie sind kämpferisch, auch bei eher geringen Erfolgsaussichten, weil sie Unveränderbares akzeptieren können und sich trotzdem engagieren. Jens Weidner ist Professor für Erziehungswissenschaften und Kriminologie.
Der Anfang der Liebe ist das Schönste auf der Welt
Peter Trawny versucht in seinem Buch „Philosophie der Liebe, das Phänomen der Liebe philosophisch in Denkbildern zu erfassen, wobei er ihrer Vielgestaltigkeit nachspürt. Denn Liebe, so zeigt Peter Trawny kennt viele Formen: Hassliebe, romantische Liebe, Weisheitsliebe, große Liebe, Nächstenlieben, Gottesliebe und viele andere mehr. Die Liebe ist ein Geschenk, das zum Fluch werden kann, ein Mysterium, das so einzigartig ist wie jede einzelne Wolke. Peter Trawny schreibt: „Liebe ist Sprengstoff, Heil, Unglück, Trost, Ekstase, Fluch, Sicherheit, Gnade, Hass, Wärme, Schönheit, Wahnsinn, Sehnsucht.“ Der Anfang der Liebe ist für Peter Trawny das Schönste, was ein Philosoph denken, was er beschreiben und untersuchen kann. Deshalb erzählt er in seinem Buch an vielen Stellen von diesem großen Anfang, dieser allerersten und allerletzten Hoffnung. Peter Trawny gründete 2012 das Martin-Heidegger-Institut an der Bergischen Universität in Wuppertal, das er seitdem leitet.
Ohne Wohlstand funktioniert keine Demokratie
Der deutsch-amerikanische Politikwissenschaftler Yascha Mounk sieht einen klaren Zusammenhang zwischen der Existenz von liberalen Demokratien und Wohlstand oder, genauer gesagt, steigendem Wohlstand. Philipp Blom ergänzt: „Tatsächlich gründen funktionierende Demokratien auf weit aufgefächerten Strukturen, auf Parlamenten, Gerichten, Schulen, Universitäten, Infrastruktur, Landesverteidigung.“ Ohne Wohlstand kann nichts von alledem gewährleistet werden. Gerade der strukturelle Zusammenbruch der westeuropäischen und US-amerikanischen Parteienlandschaft und die dort weit verbreitete Verbitterung zeigen, dass Wohlstand augenscheinlich nicht ausreicht. Denn trotz der immer weiter aufklaffenden Einkommensschere und der manifesten wirtschaftlichen Ungerechtigkeiten sind die Gesellschaften der reichen Welt heute wohlhabender als je zuvor in ihrer Geschichte. Ein typischer amerikanischer oder europäischer Haushalt ist heute fünfmal so reich wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Philipp Blom studierte Philosophie, Geschichte und Judaistik in Wien und Oxford und lebt als Schriftsteller und Historiker in Wien.
Uwe Böschemeyer erzählt von den hellen Farben der Seele
Unter den hellen Farben der Seele versteht Uwe Böschemeyer spezifisch menschliche Werte wie Freiheit, Verantwortlichkeit, Liebe, Mut, Hoffnung, Kreativität und Spiritualität. Sie gründen laut Viktor Frankl im „geistig Unbewussten“, kommen allerdings in den Wissenschaften, im gesellschaftlichen Leben, im konkreten Dasein der Menschen überhaupt viel zu kurz. Von den hellen Farben der Seele handelt das neue Buch von Uwe Böschemeyer. Er nennt sein Konzept Wertorientierte Persönlichkeitsbildung, die er als einen eigenständigen Entwurf, zugleich als ein logotherapeutisches Präventionskonzept versteht. Uwe Böschemeyer vertritt die These, dass die Menschheit in einer Zeit lebt, in der die Angst zu einem lebensbestimmenden Gefühl geworden ist: „Die Angst unter uns ist so groß, weil der Mangel an Sinn so groß ist.“ Uwe Böschemeyer ist Rektor der Europäischen Akademie für Wertorientierte Persönlichkeit und Leiter des Instituts für Logotherapie und Existenzanalyse in Salzburg.
Der Gedanke an Vergeltung ist nur ein kurzer Traum
Die Vorstellung, dass Vergeltung ein sinnvolles Unternehmen ist und eine Verletzung auszugleichen man, ist allgegenwärtig und wahrscheinlich evolutionär ererbt. Vergeltung hat häufig auch eine psychische Funktion. Martha Nussbaum erklärt: „Wenn Menschen kulturell bedingt der Vorstellung anhängen, dass Vergeltung gut ist, werden sie Befriedigung empfinden, sobald sie ihre Rache bekommen. Diese Befriedigung wird häufig als „Abschluss“ bezeichnet.“ Martha Nussbaum vertritt in dieser Frage allerdings etwas sehr Radikales. Ihrer Meinung nach ist der vom Zorn umfasste Gedanke an Vergeltung oder Heimzahlung bei einer vernünftigen und nicht übermäßig ängstlichen und statusfokussierten Person nur ein kurzer Traum, eine Wolke, die bald durch vernünftigere Vorstellungen vom Wohl des Einzelnen und der Gemeinschaft vertrieben wird. Martha Nussbaum ist Philosophin und Professorin für Rechtswissenschaften und Ethik an der University of Chicago. Sie ist eine der einflussreichsten Philosophinnen der Gegenwart.
Der ewige Friede bleibt ein unerreichbarer Menschheitstraum
Die verherrenden Wirkungen des Siebenjährigen Krieges waren nach dreißig Jahren noch spürbar. Die Ideale von „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ der Französischen Revolution erstickten am Gegensatz von „Bruder“ und „Vaterlandsverräter“, hatten zu Guillotine, Diktatur und Krieg geführt. Da erscheint Immanuel Kants Schrift „Zum ewigen Frieden“. Der Wille zum Frieden war allgemeine Hoffnung. Ewiger Friede aber blieb ein unerreichbarer Menschheitstraum. Paul Kirchhof schreibt: „Doch Immanuel Kant dachte radikal und kategorisch. Seine Schrift machten diesen Frieden zur Utopie – unmöglich mit einem Hauch von Hoffnung. Die Idee des Weltfriedens ist letztlich darauf angelegt, lang ersehnt und doch unverhofft verwirklicht zu werden.“ Dr. jur. Paul Kirchhof ist Seniorprofessor distinctus für Staats- und Steuerrecht an der Universität Heidelberg. Als Richter des Bundesverfassungsgerichts hat er an zahlreichen, für die Entwicklung der Rechtskultur der Bundesrepublik Deutschland wesentlichen Entscheidungen mitgewirkt.
Yuval Noah Harari erteilt 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert
In seinem neuen Buch „21 Lektionen über das 21. Jahrhundert lädt Yuval Noah Harari seine Leser ein, in einer Zeit voller Aufruhr und Ungewissheit über Werte und persönliches Engagement nachzudenken. In einer Welt, die überschwemmt wird von bedeutungslosen Informationen, ist Klarheit im Denken eine machtvolle Fähigkeit. Doch leider können sich die meisten Menschen nicht den Luxus leisten, sich mit den drängenden Fragen der Gegenwart zu beschäftigen, weil der Alltag ihnen kaum eine Verschnaufpause bietet und sie meist Dringenderes zu erledigen haben. Aber die Geschichte gewährt keinen Rabatt. Kein Mensch wird von den Folgen verschont bleiben, wenn über die Zukunft der Menschheit von anonymen Eliten entschieden wird. Yuval Noah Harari lehrt Geschichte an der Hebrew University in Jerusalem mit einem Schwerpunkt auf Weltgeschichte. Seine Bücher „Eine kurze Geschichte der Menschheit“ und „Homo Deus“ wurden zu Weltbestsellern.
Eltern wollen Erfolg und Glück für ihre Kinder
Wenn Eltern tiefe Liebe für ihre Kinder empfinden, wenn sie es gut mit ihnen meinen und keine verdrehten Vorstellungen von einer Eltern-Kind-Beziehung haben, gibt es zwei Möglichkeiten, wie sie in Zorn geraten können. Martha Nussbaum erläutert: „Die eine Möglichkeit ergibt sich aus einer stellvertretenden Investition ins eigene Ego: Das betreffende Elternteil sieht in dem Kind eine Erweiterung seiner selbst bzw. jemanden, die oder der die eigene Existenz fortsetzt. Ihm geht es darum, die eigenen Träume zu erfüllen.“ Die andere Möglichkeit ergibt sich aus der Sorge um das jetzige beziehungsweise künftige Wohl des Kindes. Beide Möglichkeiten überschneiden sich, weil Eltern häufig ein zentrales Interesse daran haben, dass ihr Kind erfolgreich und glücklich ist. Martha Nussbaum ist Philosophin und Professorin für Rechtswissenschaften und Ethik an der University of Chicago. Sie ist eine der einflussreichsten Philosophinnen der Gegenwart.
Einsamkeit hängt eng mit Stress zusammen
Wer mitten im Berufsleben steht und viel mit Leuten zu tun hat, möchte am Wochenende wahrscheinlich abschalten, sich „ausklinken“ und die Seele baumeln lassen. Auch den Chef möchte er am Wochenende nicht sehen. Manfred Spitzer erläutert: „Ein solcher Mensch, der die Einsamkeit sucht, um dem Stress zu entgehen, käme wahrscheinlich nicht auf den Gedanken, dass Einsamkeit mit Stress eng zusammenhängt.“ Akute Einsamkeit muss Stress auslösen, denn sie stellte im Laufe der menschlichen Entwicklung immer schon den größten denkbaren Notfall dar. Auf sich allein gestellt, ist das Gemeinschaftswesen Mensch nicht überlebensfähig, insofern leuchte tes ein, dass das Leben in einer Gemeinschaft das Stressniveau senkt. Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer leitet die Psychiatrische Universitätsklinik in Ulm und das Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen.
Ein gesunder Optimismus ist für viele Erfolge verantwortlich
Ohne die richtige Einstellung entstehen kein Optimismus und kein Erfolg. Optimisten sind in puncto Einstellung die Meister der positiven Attribution, indem sie den Grund für Erfolge bei sich suchen und meistens auch finden, Misserfolge aber eher anderen zuschreiben. Jens Weidner fügt hinzu: „Pessimisten haben diese Fähigkeit nicht und manchen von ihnen mangelt es sogar an der Fähigkeit zur strategischen Antizipation. Sie denken einfach nicht weit genug.“ Denkfaulheit hat immer ihren Preis und die falsche Einstellung kann die eigene Karriere ausbremsen. Die richtige Einstellung treibt dagegen an wie ein Turbo. Optimisten wissen das und viele von ihnen trennen deswegen zwischen Beruflichem und Privatem. Sie können im Job hart sein, bevorzugen im Privaten aber Nachgiebigkeit, wenn es den Kindern, den Partnern und der Familie dient. Jens Weidner ist Professor für Erziehungswissenschaften und Kriminologie.
Vertrauen vermindert das Gefühl der Machtlosigkeit
Soziale Kompetenzen stellen eine wichtige innere Ressource für die Bewältigung von Unsicherheit dar. Menschen mit hohen sozialen Kompetenzen können leicht Beziehungen zu anderen Menschen anknüpfen, aufrechterhalten und befriedigend gestalten und haben kein Problem damit, andere Menschen um Hilfe oder Unterstützung zu bitten, wenn es die Lage erfordert. Auch andere Eigenschaften einer Persönlichkeit helfen dabei, sich angesichts unsicherer Ereignisse und Anforderungen zu behaupten. Ernst-Dieter Lantermann nennt als Beispiele das Bedürfnis nach kognitiver Geschlossenheit und die Vorliebe für erregende Ungewissheit. Eine weitere bedeutsame Ressource für einen gelingenden Umgang mit unsicheren Anforderungen stellen unterschiedliche Dimensionen von Vertrauen dar. Vertrauen mindert das Gefühl von Machtlosigkeit und Unkontrollierbarkeit in unübersichtlichen, ungewissen und unsicheren Situationen. Ernst-Dieter Lantermann war von 1979 bis 2013 Professor für Persönlichkeits- und Sozialpsychologie an der Universität Kassel.
Manchmal kann das Verlangen nach Rache gerechtfertigt sein
Zwar ermorden nur wenige betrogene Ehepartner wie Medea ihre Kinder, um den Betrüger zu verletzen, doch Schmerz zufügen wollen mit Sicherheit viele. Ihre entsprechenden Anstrengungen haben laut Martha Nussbaum nicht selten schwere Kollateralschäden zur Folge. Auch wenn die Selbstbeherrschung den betrogenen Teil davon abhält zu tun, was er in seiner Wut am liebsten tun würde, so gärt es doch weiter in ihm, und er setzt all seine Hoffnungen darauf, dass es dem betrügenden Teil und seiner neuen Familie irgendwie schlecht ergeht. Und wie oft geschieht es nicht, dass der böse Wille aufs Neue durchbricht – sei es in Gerichtsverfahren, in der subtilen Beeinflussung der Kinder oder einfach nur in der mangelnden Bereitschaft, Männer wieder Vertrauen entgegenzubringen. Martha Nussbaum ist Philosophin und Professorin für Rechtswissenschaften und Ethik an der University of Chicago. Sie ist eine der einflussreichsten Philosophinnen der Gegenwart.
Der Islam zeichnet sich durch vier besondere Merkmale aus
Zweifellos hat es in den letzten Jahrzehnten ein besonderes Problem mit dem Islam und der Redefreiheit gegeben. Timothy Garton Ash verweist auf zahlreiche Beispiele, in denen andere Glaubenssysteme und durch ihre religiöse Identität definierte Gruppen an gewaltsamer Unterdrückung der Meinungsfreiheit beteiligt waren: „Buddhisten in Birma, Hindus in Indien, christliche Milizen in der Zentralafrikanischen Republik, kommunistische Atheisten in Nordkorea.“ In mehreren dieser Fälle gehörten Muslime zu den Opfern. Das Problem mit dem Islam zeichnet sich jedoch durch vier besondere Merkmale aus: die Größe; die Wirkung auf liberaldemokratische Gesellschaften, die besonderen Wert auf freie Meinungsäußerung legen; die Verbindung mit dem Terrorismus. Timothy Garton Ash ist Professor für Europäische Studien an der Universität Oxford und Senior Fellow an der Hoover Institution der Stanford University.
Die Pluralisierung verändert alle Menschen einer Gesellschaft
Kein Mensch kann heute seine ganz persönliche Kultur noch so leben, als ob es keine andere neben ihm gäbe. In gemischten Gesellschaften steht jede Kultur neben anderen. Das heißt: Es gibt keine selbstverständliche Kultur, keine natürliche Zugehörigkeit mehr. Die Außenperspektive – dass es nämlich immer anders sein könnte, dass man jemand anders sein, etwas anderes glauben, anders leben könnte – ist heute Teil einer jeden Kultur. Und diese Veränderung betrifft jeden Einzelnen. Sie verändert den Bezug zur Gemeinschaft, zur eigenen Identität. Die Philosophin Isolde Charim wendet ihre Thesen in ihrem neuen Buch „Ich und die Anderen“ auf verschiedene gesellschaftliche Themen an, von der Integrationspolitik über die Definition des Heimatbegriffs bis hin zu den Debatten um religiösen Zeichen. Die Philosophin Isolde Charim arbeitet als freie Publizistin und ständige Kolumnistin der „taz“ und der „Wiener Zeitung“.
Die Sieger werden unermesslich reich und unantastbar
Die Zukunft spaltete sich vor einem Jahrzehnt, plötzlich und ohne Vorwarnung. Menschen auf der ganzen Welt wurde im Jahr 2008 mitgeteilt, dass die großen Banken, denen alle etwas schulden und denen gegenüber alle Zahlungsverpflichtungen haben, sich verzockt haben – hoffnungslos, verantwortungslos, amoralisch und dumm. Philipp Blom fügt hinzu: „Und dann wurde ihnen mitgeteilt, man müsse ihnen gemeinsam erwirtschaftetes Geld geben, um ihnen über ihre Schwierigkeiten hinwegzuhelfen und so das ganze System vor dem Kollaps zu retten.“ Millionen von Menschen verloren ihr Haus, ihren Job, ihre Zukunft. Kaum ein Banker ging ins Gefängnis, und innerhalb weniger Jahre waren die Profite und Boni höher als je zuvor. Philipp Blom studierte Philosophie, Geschichte und Judaistik in Wien und Oxford und lebt als Schriftsteller und Historiker in Wien.