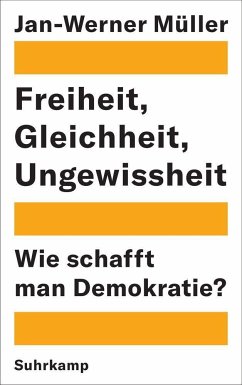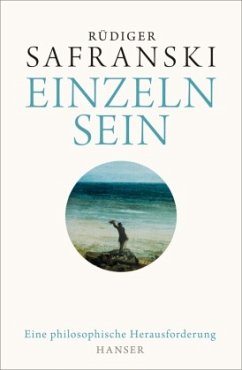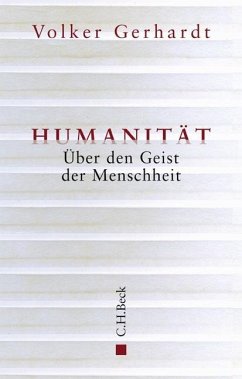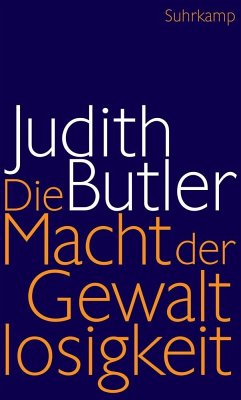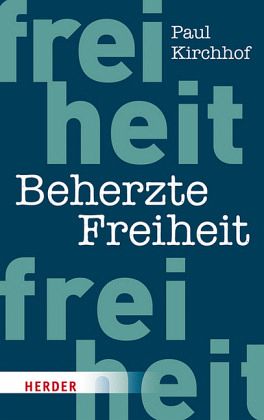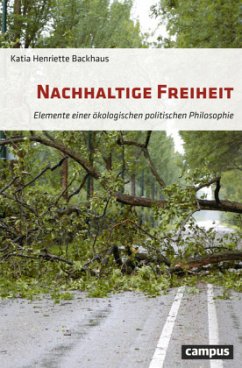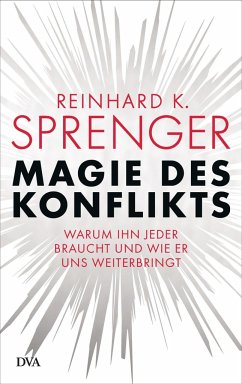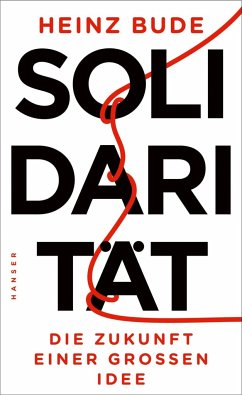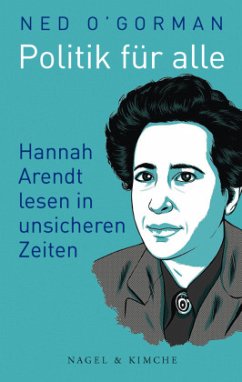Jan-Werner Müller weiß: „Gleichheit, ob nun im sozialen Sinne oder im Sinne gleicher politischer Grundrechte, bedeutet nicht Unterschiedslosigkeit oder Homogenität.“ Das Gegenteil von Gleichheit ist nicht Vielfalt – die mit politischer Gleichheit vollkommen verträglich sein kann –, sondern Ungleichheit. Zudem verlangen weder politische noch soziale Gleichheit, dass Menschen immer einer Meinung wären. Eines der am weitesten verbreiteten Missverständnisse bezüglich demokratischer Politik der Gegenwart besagt, Spaltung und Konflikt wären an sich problematisch oder sogar gefährlich. Denn die Bürger haben ganz unterschiedliche Vorstellungen über ein gutes Leben für sich selbst und auch über das Gemeinwohl. Diese Unterschiede lassen sich nicht allein auf Irrationalität, mangelnde Information oder ein Fehlen der rechten politischen Bildung zurückführen. Jan-Werner Müller ist Roger Williams Straus Professor für Sozialwissenschaften an der Princeton University.
Gleichheit
Die Demokratie ist der einzige Weg zur Gerechtigkeit
Politische Gleichheit darf man nicht opfern. Danielle Allen betont: „Meiner Meinung nach ist die Demokratie der Weg zur Gerechtigkeit, und zwar der einzige.“ Es mag zwar sein, dass mildtätige Autokraten für materiellen Wohlstand in der Bevölkerung sorgen, aber sie werden qua Definition niemals die Grundlage für volles menschliches Wohlergehen schaffen. Und deshalb niemals vollumfängliche Gerechtigkeit erreichen. Dennoch gibt es zum Trotz immer Menschen, die einen anderen Weg wählen und auf Demokratie verzichten. Das nimmt Danielle Allen als unvermeidliche Gegebenheit des Lebens hin. Richtig verstandene Gerechtigkeit beruht auf politischer Gleichheit und den ihr zugrunde liegenden Institutionen. Danielle Allen ist James Bryant Conant University Professor an der Harvard University. Zudem ist sie Direktorin des Edmond J. Safra Center for Ethics in Harvard.
Die klassische Antike „erfindet“ das Individuum
Selbstverständlich gab es auch schon vor der Renaissance die Entdeckung und Wertschätzung des Einzelnen. Larry Siedentop etwa verlegt die „Erfindung des Individuums“ in die klassische Antike Griechenlands. Rüdiger Safranski ergänzt: „Bereits dort beobachtete er, dass Individuen ganz besonders geschätzt werden: Es gibt sie nicht einfach, es soll sie geben. Es finden sich nicht nur einfach Unterschiede zwischen ihnen, sondern es ist gut, dass es Unterschiede gibt.“ Und es ist noch besser, wenn es möglichst viele davon gibt. Es handelt sich dabei um die entfaltete Vielfalt als Ziel, viele Einzelne, die in ihrer jeweiligen Einzelheit sichtbar bleiben. Über lange historische Wegstrecken und in vielen Kulturräumen war und ist das gesellschaftliche Zusammenleben so organisiert, dass die Individualität in der Regel in den kollektiven Verbänden verschwindet. Rüdiger Safranski arbeitet seit 1986 als freier Autor. Sein Werk wurde in 26 Sprachen übersetzt und mit vielen Preisen ausgezeichnet.
Viele Menschen sind von der Demokratie enttäuscht
Millionen von Menschen in aller Welt sind offenkundig unzufrieden mit ihren Demokratien. Sie wenden sich jedoch keineswegs von der Grundidee der Demokratie ab. Jan-Werner Müller weiß: „Zu den Menschen, die von der Demokratie enttäuscht sind, sie aber nicht aufgeben wollen, gehören auch viele Millennials, die man immer gern im Verdacht hat, das mit der Demokratie nicht ganz so wichtig zu nehmen.“ Das ist erst mal ein Grund zur Hoffnung. Und es ist ein deutlicher Unterschied zum 20. Jahrhundert. In der Weimarer Republik hatten beispielsweise viele Bürger das Gefühl, Institutionen wie Parlamente seien an sich diskreditiert und undemokratische Systeme böten eine Alternative für Deutschland. Leider gibt es aber auch heute eine unangenehme Wahrheit. Jan-Werner Müller ist Roger Williams Straus Professor für Sozialwissenschaften an der Princeton University.
Freiheit und Gleichheit gehören zu den Grundrechten
Immanuel Kants kleine Schrift „Zum ewigen Frieden“ hat spätestens mit der durch sie angeregten Gründung des Völkerbunds 1919 einen weltpolitischen Rang erhalten. In ihr werden im ersten Definitionsartikel, der die Staaten auf eine republikanische Verfassung verpflichtet, drei Prinzipien genannt. Diese seien unbedingt zu beachten. Volker Gerhardt stellt fest: „Zwei der Prinzipien, nämlich die Freiheit und die Gleichheit der Bürger, sind uns aus den Grundrechtskatalogen bekannt.“ Aber das zwischen ihnen stehende dritte Prinzip der Abhängigkeit aller Bürger „von einer einzigen gemeinsamen Gesetzgebung“ ist erklärungsbedürftig. Denn in einer offenen Welt, in der man seinen Wohnort selbst bestimmen kann, wirkt die Bindung an die Gesetzgebung eines einzigen Staates befremdlich. Volker Gerhardt war bis zu seiner Emeritierung 2014 Professor für Philosophie an der Humboldt-Universität in Berlin.
Soziale Verbundenheit könnte ein Idealzustand sein
Das Assimilationsideal strebt nach sozialem Zusammenhalt, opfert aber dafür das Bedürfnis des Einzelnen, mit seiner Herkunftsgemeinschaft in Verbindung zu bleiben. Das Multikulturalismusideal wertet diese Verbindung zu diesen Herkunftsgemeinschaften auf Kosten sowohl eines vernünftigen Identitätsverständnisses als auch der wertvollen Fluidität sozialer Bindungen auf. Danielle Allen stellt fest: „Das Ideal sozialer Verbundenheit und einer vernetzten Gesellschaft wart dagegen die Autonomie.“ Eine Assoziationsökologie, die das Bauen von Brücken maximiert, sollte egalitäre Effekte mit sich bringen. Zudem sollte sie die Wahrscheinlichkeit minimieren, dass soziale Differenz sich mit Herrschaft verknüpft. Damit hat Danielle Allen ein soziales Prinzip der Organisation formuliert. Danielle Allen ist James Bryant Conant University Professor an der Harvard University. Zudem ist sie Direktorin des Edmond J. Safra Center for Ethics in Harvard.
Jeder Mensch ist von anderen abhängig
Die Sozialphilosophie beschäftigt sich mit lebendigen und haltbaren Bindungen. Diese müssen mit Blick darauf gedacht werden, dass die der Verteidigung würdigen „Selbste“ im politischen Raum gesellschaftlich ungleiche Artikulationsbedingungen haben. Judith Butler erklärt: „Die Beschreibung der sozialen Bindungen, ohne die das Leben gefährdet ist, ist auf der Ebene einer Sozialontologie angesiedelt. Diese ist eher als ein gesellschaftliches Imaginäres denn als eine Metaphysik des Sozialen zu begreifen.“ Anders gesagt lässt sich ganz allgemein davon ausgehen, dass Leben durch soziale Interdependenz gekennzeichnet ist. Gewalt stellt einen Angriff auf diese Interdependenz dar, einen Angriff auf Personen, ja, aber noch grundlegender einen Angriff auf „Bindungen“. Obgleich Interdependenz Differenzierungen von Unabhängigkeit und Abhängigkeit begründet, impliziert sie auch soziale Gleichheit. Judith Butler ist Maxine Elliot Professor für Komparatistik und kritische Theorie an der University of California, Berkeley.
In der Demokratie gilt politische Gleichheit
Autoritäre Rechtspopulisten geben zu verstehen, dass nicht alle Bürger Teil des wahren Volkes seien. Vielmehr gehörten manche gar nicht wirklich dazu oder wären bestenfalls Bürger zweiter Klasse. Hier wird ein demokratisches Grundprinzip verletzt. Jan-Werner Müller erklärt: „In einer Demokratie müssen die Bürger die Erfahrung von politischer Gleichheit machen.“ Manchen Menschen gilt die Demokratie als etwas Gutes, weil sie Wohlstand und Frieden sichert. Deshalb könnte man sie ja aufgeben, falls ein anderes System Wohlstand und Stabilität noch effektiver bietet. Zum Beispiel eine Idealversion des autoritären China. Also eines Systems, dessen Versprechen von Wohlstand und gesellschaftlicher Harmonie wirklich eingelöst wären. Viele Menschen wollen jedoch nicht in einer Gesellschaft leben, in der manche als den anderen grundsätzlich überlegen gelten. Jan-Werner Müller ist Roger Williams Straus Professor für Sozialwissenschaften an der Princeton University.
Soziale Differenzen führen leicht zu Herrschaft
Eine grundlegende Äußerungsform der Vereinigungsfreiheit ist das Recht zu heiraten, wen man möchte. Danielle Allen erklärt: „Wenn in Zuneigung zueinander verbundene Menschen sich zu Ehepartnern zusammenfinden, bilden sie Bausteine zu kulturell homogenen Einheiten.“ Unabhängig davon, wie Heiratsmärkte genau beschaffen waren, haben sie normalerweise unterscheidbare ethnische Gemeinschaften hervorgebracht. Und es besteht aller Grund zu der Annahme, dass Vereinigungsfreiheit dieses Muster eher verstärkt als untergräbt. Denn einander ähnliche Menschen neigen dazu, sich zueinander zu gesellen. Diese Tatsache zählt zu den Grundbausteinen der menschlichen Sozialorganisation. Wo es soziale Differenzen gibt, kann es leicht auch zu Herrschaft kommen. Die Politikwissenschaftlerin und Altphilologin Danielle Allen lehrt als Professorin an der Harvard University. Zugleich ist sie Direktorin des Edmond J. Safra Center for Ethics in Harvard.
Abhängigkeit beinhaltet Verletzlichkeit
Gleichheit ist ein Merkmal sozialer Beziehungen und ihre Artikulation basiert auf der zunehmend anerkannten Interdependenz. Die menschlichen Grenzen kann man als relationale und soziale Einschränkungen betrachten. Für Judith Butler ist „Verletzlichkeit“ kein subjektiver Zustand, sondern ein Merkmal des geteilten oder interdependenten Lebens. Menschen sind niemals einfach nur verletzbar. Sondern sie sind immer verletzbar durch eine bestimmte Situation, eine Person oder eine soziale Struktur. Menschen sind angreifbar durch jene Umwelt- und Gesellschaftsstrukturen, die ihr Leben erst ermöglichen. Und wo diese versagen, scheitern auch die Menschen. Judith Butler weiß: „Abhängigkeit impliziert Verletzbarkeit. Wenn die sozialen Strukturen, von denen man abhängt, versagen, gerät man in eine prekäre Lage.“ Judith Butler ist Maxine Elliot Professor für Komparatistik und kritische Theorie an der University of California, Berkeley.
Die Revolution hat ihre Gegner
Anfangs war der Gedanke der „Brüderlichkeit“ in der Französischen Revolution frei von jeder Aggressivität. Der Revolutionär will den neuen, den besseren Menschen schaffen, der sich die Ziele der Revolution zu eigen macht. Deshalb arbeitet er in einer gemeinsamen Brüderlichkeit auf den Umsturz mit den Methoden der Revolution hin. Paul Kirchhof weiß: „Doch diese Revolution hat ihre Gegner: den König und sein Gefolge, die Aristokraten, das Feudalsystem, den hohen Klerus, schließlich alle Andersdenkenden.“ Dadurch wird die „Brüderlichkeit“ zu einem ausgrenzenden Begriff: „Jeder Franzose ist heute euer Bruder, bis er sich offen als Verräter am Vaterland erweist. Da die Aristokraten kein „Vaterland“ hätten, seien sie von vornherein vom Kreis der Brüder ausgenommen. Dr. jur. Paul Kirchhof ist Seniorprofessor distinctus für Staats- und Steuerrecht an der Universität Heidelberg.
Autonomie beruht auf Grundfreiheiten
Der Schutz politischer Freiheit verlangt nicht bloß die Gewährung des Rechts zu wählen, ein Amt zu bekleiden oder als Geschworener zu fungieren. Dazu gehören auch Vereinigungsfreiheit und freie Meinungsäußerung, die politische Partizipation erst möglich machen. Danielle Allen erklärt: „Letztere Rechte bilden natürlich auch eine wertvolle Grundlage für die Äußerungen von privater und nicht bloß von öffentlicher Autonomie.“ Die Dynamik des Sozialen und Ökonomischen darf dabei die gleichen Grundfreiheiten, einschließlich der politischen Freiheiten, nicht untergraben. In Bezug auf diesen Punkt setzt sich Danielle Allen ganz entschieden von John Rawls ab. Dieser behauptet immerhin, dass die Grundfreiheiten, auf denen private Autonomie beruht, niemals dem materiellen Wohlstand geopfert werden dürfe. Die Politikwissenschaftlerin und Altphilologin Danielle Allen lehrt als Professorin an der Harvard University. Zugleich ist sie Direktorin des Edmond J. Safra Center for Ethics in Harvard.
Freiheit bewahrt den Staat vor Überforderung
Der freiheitliche Staat überlässt den Menschen die Gestaltung ihres Lebens. Insoweit darf der Staat nicht handeln, ist aber auch von Aufgaben entlastet. Paul Kirchhof ergänzt: „Freiheit bewahrt den Staat vor Überforderung, enthält ein Konzept sachgerechter Aufgabenteilung zwischen Gesellschaft und Staat. Der Staat nimmt sich um der Freiheit willen in seinen Machtbefugnissen zurück.“ Er ist ohne Macht, ohnmächtig, wo Freiheit wirkt. Immer mehr Menschen suchen jedoch statt der selbstbestimmten und selbstverantwortlichen Freiheit eine sicherheitsbedachte, den Staat beanspruchende Freiheit. Daher organisiert, regelt und finanziert der Staat die Voraussetzungen individueller Freiheitswahrnehmung. Er formt die Freiheitsfähigkeit durch Ausbildung, Bildung und Kulturangebote und setzt damit den Rahmen der Freiheit. Dr. jur. Paul Kirchhof ist Seniorprofessor distinctus für Staats- und Steuerrecht an der Universität Heidelberg.
Die Nationalstaaten beuten die Natur aus
Die Werbung vieler Unternehmen feiert eine globalisierte Welt. Aber die Idee von der größeren Reichweite ihrer Geschäftsbeziehungen umfasst nur einen Aspekt der Globalisierung. Judith Butler weiß: „Nationalstaatliche Souveränität mag im Schwinden begriffen sein, aber neue Nationalismen halten an diesem Rahmen fest.“ Die Regierungen der Vereinigten Staaten sind nur schwer von der realen Bedrohung der lebensfähigen Welt durch den Klimawandel zu überzeugen. Das liegt daran, dass ihre Rechte zur Erweiterung von Produktion und Märkten weiterhin im Rahmen des Nationalstaates konzentriert bleiben. Dies trägt zur Ausbeutung der Natur und der Vormachtstellung des Profits bei. Sie rechnen vielleicht gar nicht mit der Möglichkeit, dass ihr Handeln Auswirkungen auf alle Regionen der Welt hat. Judith Butler ist Maxine Elliot Professor für Komparatistik und kritische Theorie an der University of California, Berkeley.
Der demographische Wandel prägt die USA
Die USA erleben derzeit einen umfassenden demographischen Wandel. Dieser wird mit Sicherheit frühere Denkansätze in Bezug auf Fragen der Identität, der Gemeinschaft und der sozialen Beziehungen auf den Kopf stellen. Wenn die US-amerikanischen Bürger heute die falschen Entscheidungen treffen, könnte es sein, dass der binäre Gegensatz schwarz / nichtschwarz sich von Neuem behauptet und Rassenprivilegien genauso massiv sind wie eh und je. Danielle Allen ergänzt: „Etwas Ähnliches ließe sich über Europa sagen. So wie es sich gerade mit einer Mischung aus niedrigen Geburtsraten in der einheimischen Bevölkerung, Flüchtlingskrise, binneneuropäischer Migration und der Frage von Europas Zukunft herumschlägt.“ Die Politikwissenschaftlerin und Altphilologin Danielle Allen lehrt als Professorin an der Harvard University. Zugleich ist sie Direktorin des Edmond J. Safra Center for Ethics in Harvard.
Martha Nussbaum fordert Gerechtigkeit
Um die Frage, was für ein gutes Leben wichtig ist, geht es Martha Nussbaum und Amartya Sen, die den „capabilities“-Ansatz maßgeblich entwickelt haben. Katia Henriette Backhaus erklärt: „Nussbaum versteht ihre Variante als Teil des politischen Liberalismus. Es gibt jedoch grundlegende Unterschiede zur Debatte um „greening liberalism“. Soziale Gerechtigkeit, Gleichheit und die Lebensqualität stehen im Kern von Martha Nussbaums Überlegungen, die sich darum drehen, was eine Person fähig ist, zu tun und zu sein. Davon ausgehend bildet sie ihre Gerechtigkeitstheorie. Eine Kombination interner Fähigkeiten und externer Möglichkeiten macht den umfassenden Charakter dieses Ansatzes aus. Dieser fordert von Gesellschaft und Staat, diese beiden Aspekte menschlicher „capabilities“ zu gewährleisten. Katia Henriette Backhaus hat an der Universität Frankfurt am Main im Bereich der politischen Theorie promoviert. Sie lebt in Bremen und arbeitet als Journalistin.
Politische Gleichheit erfordert Gegenseitigkeit
Eine Komponente von politischer Gleichheit betrifft egalitäre Praktiken der Gegenseitigkeit. Danielle Allen erläutert: „Für gerechte menschliche Beziehungen ist die Art von Gleichheit erforderlich, die sich in Gegenseitigkeitsprinzipien äußert.“ Solche Prinzipien bilden die Grundlage für Interaktionen. Durch diese erlangen sowohl Freude als auch Mitbürger in ihren Beziehungen zueinander gleiche Handlungsmacht. Folgendes gilt sowohl für die Freundschaft als auch für die Politik. Alle Beteiligten möchten über einen Handlungsspielraum verfügen, der keine Einschränkungen durch andere erfährt. Das Erlangen von Freiheit beruht auf einer egalitären Verpflichtung zur ständigen Neujustierung, mit deren Hilfe Beeinträchtigungen behoben werden können. Die Verfahren zur Problemlösung eines freien Volkes stützen sich auf diese Art von egalitärer Grundlage, auf Gewohnheiten der Gegenseitigkeit. Die Politikwissenschaftlerin und Altphilologin Danielle Allen lehrt als Professorin an der Harvard University. Zugleich ist sie Direktorin des Edmond J. Safra Center for Ethics in Harvard.
Demokratien leben von kollektivem Lernen
Ein weiteres Merkmal politischer Gleichheit ist, was Danielle Allen als epistemischen Egalitarismus bezeichnet. Wie alle politischen Systeme sind Demokratien auf erfolgreiche, kollektive Praktiken des Lernens und des Wissensmanagement angewiesen. Nur so können die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Im Unterschied zu anderen Regierungsformen sind ihnen Verfahren zugänglich, welche die kollektive Entscheidungsfindung stärken. Denn sie können auf die Wissensressourcen der gesamten Bürgerschaft zurückgreifen. Daniele Allen stellt fest: „Menschen sind Schwämme, die Informationen über ihre Umwelt aufnehmen. Manche Schwämme sind besser als andere, aber saugfähig sind wir alle.“ Alle Menschen sind insofern gleich geschaffen, dass sie alle zum Aufsaugen bestimmt sind. Die Politikwissenschaftlerin und Altphilologin Danielle Allen lehrt als Professorin an der Harvard University. Zugleich ist sie Direktorin des Edmond J. Safra Center for Ethics in Harvard.
Werte gibt es nur im Doppelpack
Wer mit beiden Beinen in der realen Welt steht, der weiß: Werte gibt es nur im Doppelpack. Man kann sie nur im Mehr-oder-weniger, Sowohl-als-auch oder Mal-so-mal entscheiden. Diese „Fließgleichgewichte“ sind immer wieder neu zu justieren. Und worauf kommt es dabei an? Reinhard K. Sprenger antwortet: „Auf die Umstände. Und die sind nie stabil, erfordern eine flexible Prioritätenordnung, die man den wechselnden Sachlagen anpassen kann.“ Das Fließgleichgewicht lässt sich am Beispiel „Vertrauen“ illustrieren. Vertrauen ohne Misstrauen wäre gegenstandslos, beide wären sogar ununterscheidbar. Ein neugeborenes Kind weiß nicht, dass es vertraut. Das weiß es erst ab dem Moment, in dem sein Vertrauen unerfüllt bleibt. Von einem vorreflexiven Vertrauen träumt dann der Erwachsene. Reinhard K. Sprenger zählt zu den profiliertesten Managementberatern und wichtigsten Vordenkern der Wirtschaft in Deutschland.
Ohne Mitgefühl gibt es keine Solidarität
Solidarität kann man nicht mit Barmherzigkeit gleichsetzen. Obwohl schwer vorstellbar ist, dass Solidarität ohne Mitgefühl möglich ist. Zudem kann man Solidarität nicht einfach nur als Sammelbezeichnung für menschliche Freundlichkeit, allgemeines Wohlwollen und sozialstaatliche Folgebereitschaft verwenden. Heinz Bude erläutert: „Solidarität berührt mein Verständnis von Zugehörigkeit und Verbundenheit. Zudem meine Bereitschaft, mich den Nöten und dem Leiden meiner Mitmenschen zu stellen. Und mein Gefühl der Verantwortung und Bekümmerung für das Ganze.“ Auf Solidarität pfeift, wer nur an sich glaubt, Solidarität entbehrt, wer die anderem ihrem Schicksal überlässt, und Solidarität ist ein Fremdwort für Menschen, denen der Zustand des Gemeinwesens gleichgültig ist. Heinz Bude studierte Soziologie, Philosophie und Psychologie. Seit dem Jahr 2000 ist er Inhaber des Lehrstuhls für Makrosoziologie an der Universität Kassel.
Der Mensch beansprucht Autonomie
Die Rechtsgarantien von Freiheit, Gleichheit und Sicherheit wirken miteinander und gegeneinander. Man muss sie deshalb aufeinander abstimmen und gemeinsam zur Geltung bringen. Paul Kirchhof erklärt: „Der Mensch ist nicht frei, sondern freiheitsberechtigt. Er beansprucht in Bindungen an Staat und Recht, in Familie und Gesellschaft, in Natur und Technik ein Stück selbstbestimmter Autonomie.“ Der Mensch ist nicht gleich, sondern gleichberechtigt. Alle Menschen sind in ihrer Individualität verschieden, dürfen in Freiheit ihre Verschiedenheit mehren. Sie sollen also nicht gleich sein, sondern maßvoll angeglichene Lebensverhältnisse vorfinden. Deshalb behauptet die Verfassung nicht, alle Menschen seien gleich, sondern stellt sie „vor dem Gesetz“, dem Instrument rechtlicher Entscheidungen, gleich. Dr. jur. Paul Kirchhof ist Seniorprofessor distinctus für Staats- und Steuerrecht an der Universität Heidelberg.
John Rawls entwickelt eine Gerechtigkeitstheorie
Im Allgemeinen hat John Rawls versucht, dass sein Liberalismus vermeidet, den Bürgern eines liberalen Regierungssystems eine bestimmte Konzeption des Guten aufzudrängen. Seine Gerechtigkeitstheorie beruht durchaus auf dem Gedanken, dass Autonomie für sich genommen gut für die Menschen ist. Und dass diesen genug Raum für deren Ausübung gelassen werden sollte. Danielle Allen ergänzt: „Sie enthält auch einen knappen Ausblick auf das demokratischer Gleichheit innewohnende menschliche Gut.“ Jürgen Habermas vertritt die These, dass Demokratie an sich wertvoll ist. Weil politische Teilhabe nicht nur für die Selbstachtung, sondern für volles menschliches Wohlergehen unverzichtbar ist. John Rawls lehnte die Wahrheit des klassischen Humanismus ab. Die Politikwissenschaftlerin und Altphilologin Danielle Allen lehrt als Professorin an der Harvard University. Zugleich ist sie Direktorin des Edmond J. Safra Center for Ethics in Harvard.
Populisten befolgen nicht den Willen des Volkes
Populisten erheben nicht den Anspruch, den Willen des Volkes zugleich zu formen und zu befolgen, wie demokratische Politiker dies im Großen und Ganzen tun. Sie geben vor, sie fänden ihn lediglich vor. Denn der kollektive Wille lässt sich unmittelbar aus dem einen und einzig authentischen Verständnis des Volkes ableiten. Was dagegen zeichnet ein nichtpopulistisches Verständnis von Volk aus? Jan-Werner Müller erklärt: „Die Debatten politischer Philosophen über diese Frage bewegen sich meist zwischen zwei Extremen.“ Auf der einen Seite findet sich die Position, eine moralisch korrekte Theorie sei in der Lage, die politischen Grenzen ein für alle Mal zu klären. Verteidiger des Nationalismus als einer moralischen Theorie vertreten zum Beispiel die Auffassung, alle größeren Gruppierungen mit gemeinsamer Kultur müssten politische Selbstbestimmung genießen. Jan-Werner Müller ist Roger Williams Straus Professor für Sozialwissenschaften an der Princeton University.
In einer idealen Demokratie sind alle gleich
In der öffentlichen Debatte machen sich Bedenken in Bezug auf Ungleichheit oder Gleichheit zumeist an einer Reihe sozialer und ökonomischer Fragen fest. In einer idealen Demokratie besteht die Bevölkerung aus freien und gleichen Bürgern. Deren Gleichheit muss zuallererst als eine Frage sowohl von politischer Gleichheit in Bezug auf die private Autonomie konstituierenden Rechte verstanden werden. Denn diese beiden Rechtsinstitute sind noch in weiteren Hinsichten gleichursprünglich. Danielle Allen stellt fest: „Das Vereinigungsrecht ist nämlich nicht bloß ein auf private Autonomie bezogenes Recht, das zu den heiligen Rechten der Moderne gehört. Im Gegenteil: Seine ersten historischen Auftritte zeigen, dass es untrennbar mit Bemühungen verknüpft ist, die Rechte öffentlicher Autonomie zu gewährleisten.“ Die Politikwissenschaftlerin und Altphilologin Danielle Allen lehrt als Professorin an der Harvard University. Zugleich ist sie Direktorin des Edmond J. Safra Center for Ethics in Harvard.
Politik beginnt mit dem Akt des Loslassens
Eine These von Ned O’Gorman lautet, dass Politik – genau wie elterliche Liebe – mit dem Akt des Loslassens beginnt. Nämlich mit dem Verzicht auf Kontrolle, sodass einer dem anderen nicht als Herr oder Diener, sondern als Gleicher gegenübertritt. Viele Menschen sind daran gewöhnt, Gleichheit und Freiheit für die Ziele politischen Aktivismus zu halten. Ned O’Gorman argumentiert, dass sie der Anfang von Politik sind und Politik ohne sie nicht möglich ist. Zudem fordert er, dass die Menschen zueinander als Gleichgestellte in Beziehung treten müssen. Nicht alle Beziehungen erfüllen jedoch diese Voraussetzung. Man könnte sogar sagen, dass es die meisten nicht tun. Dennoch stellt sich Gleichheit ein. Wenn Menschen einander gleichberechtigt behandeln, treten sie in eine freiheitliche Beziehung. Ned O’Gorman ist Professor für Kommunikationswissenschaften an der University of Illinois.