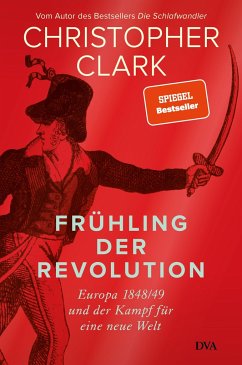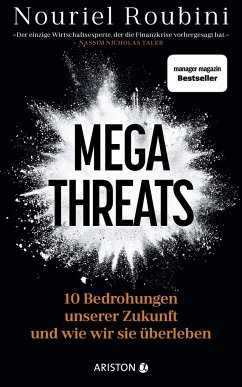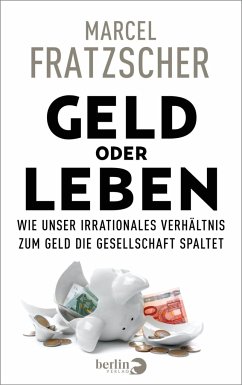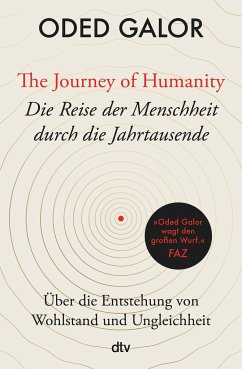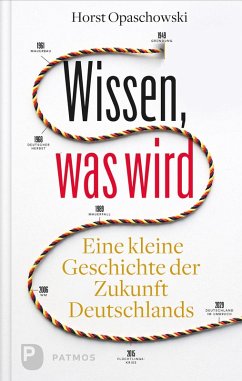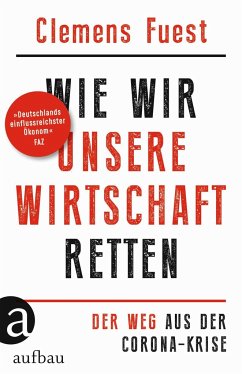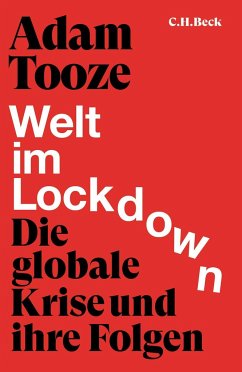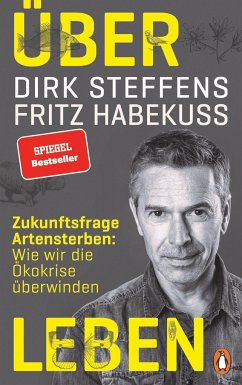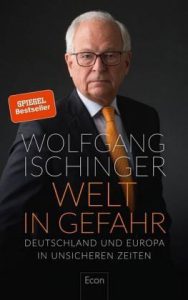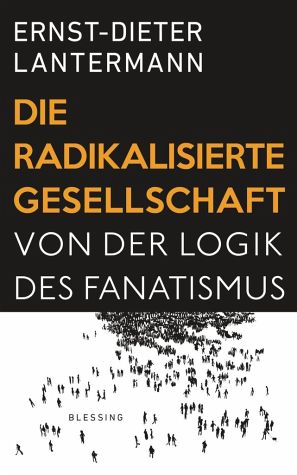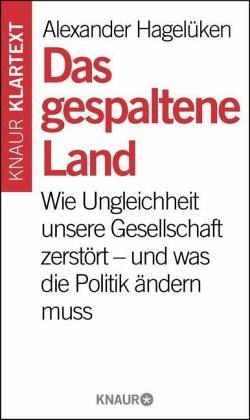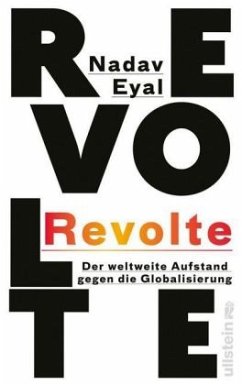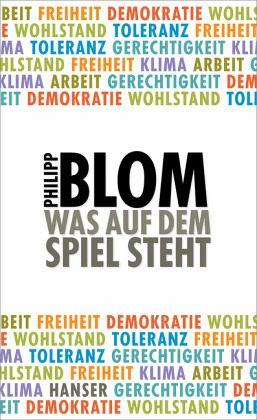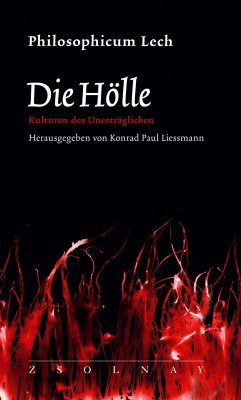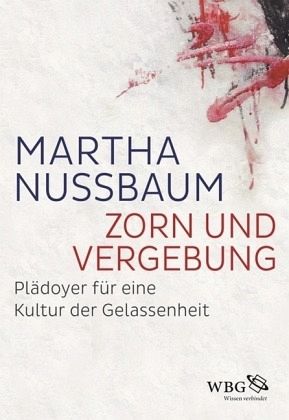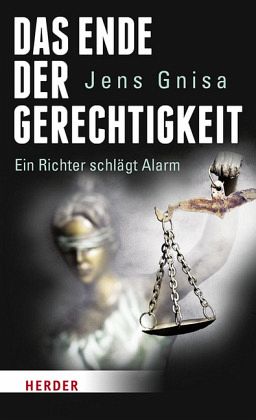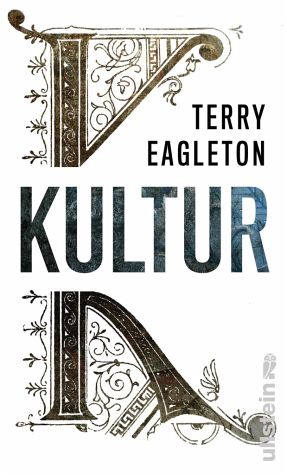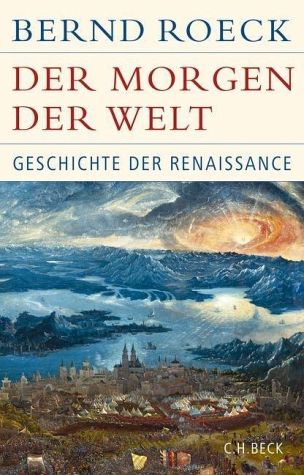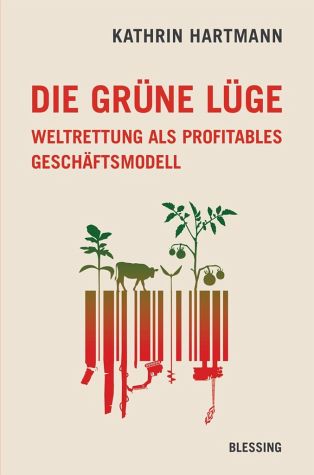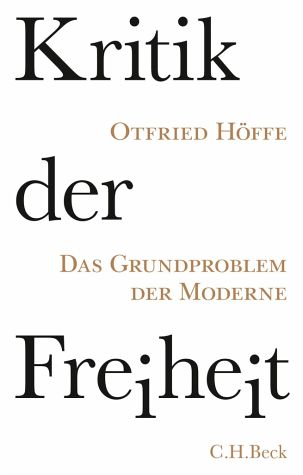Die im Umfeld der sozialen Frage erzeugten Energien fanden ihren Weg zurück in die Politik. Die von Friedrich Engels in „Die Lage der arbeitenden Klasse in England“ aufgestellten Thesen prägten maßgeblich das „Kommunistische Manifest“, das er gemeinsam mit Karl Marx verfasste. Christopher Clark erklärt: „Armut war keineswegs ein neues Phänomen. Aber der „Pauperismus“ zu Beginn des 19. Jahrhunderts unterschied sich von den hergebrachten Formen der Armut. Die Abstraktheit der neuen Wortschöpfung gibt trefflich wieder, was als die systematische Eigenart des Phänomens angesehen wurde.“ Es war kollektiv und strukturell bedingt, hing nicht von individuellen Eventualitäten wir Krankheit, Todesfällen, Verwundung oder Missernten ab. Christopher Clark lehrt als Professor für Neuere Europäische Geschichte am St. Catharine’s College in Cambridge. Sein Forschungsschwerpunkt ist die Geschichte Preußens.
Armut
Besonnene Verschuldung kann das Leben besser machen
Nouriel Roubini betont: „Besonnene Verschuldung im Zusammenspiel mit Wirtschaftswachstum kann das Leben besser machen, ohne künftige Generationen zu belasten.“ Es ist in Ordnung, auch in schlechten Zeiten Kredite aufzunehmen, etwa um eine Rezession abzuschwächen, wenn in guten Zeiten ein Haushaltsüberschuss erwirtschaftet wird, um die Schuldenquote zu stabilisieren und abzubauen. In den sieben Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg herrschte ein überwiegend positives Umfeld vor, das die Zusammenarbeit der Industrienationen begünstigte. Robustes Wirtschaftswachstum half diesen Staaten, die im Krieg angehäuften Schulden abzubauen. Doch seit den 1970er-Jahren begannen sich unter dieser friedlichen Oberfläche die Anreize zu verschieben. Die Veränderungen setzten langsam ein, doch sie beschleunigten sich unter dem Banner der Globalisierung. Nouriel Roubini ist einer der gefragtesten Wirtschaftsexperten der Gegenwart. Er leitet Roubini Global Economics, ein Unternehmen für Kapitalmarkt- und Wirtschaftsanalysen.
Der deutsche Sozialstaat ist „deaktivierend“
Der Sozialstaat in Deutschland ist bei Weitem nicht so leistungsfähig wie in den nordischen Ländern. Marcel Fratzscher weiß: „Hierzulande sind mehr als doppelt so viele Menschen von Einkommensarmut bedroht wie in Skandinavien. Dies gilt vor allem für Kinder und andere Gruppen wie alleinerziehende Eltern – meist Mütter.“ Der Sozialstaat legt in den nordischen Ländern einen hohen Wert auf Chancengleichheit. So ist die Ungleichheit der Markteinkommen dort sehr viel geringer. In Deutschland sind vor allem die Aufstiegschancen für Menschen aus einkommensschwachen und bildungsfernen Familien ungleich geringer. Der deutsche Sozialstaat ist eher „deaktivierend“. Er versucht, die großen Ungleichheiten am Arbeitsmarkt und im Bildungssystem im Nachhinein durch Umverteilung zu ebnen. Marcel Fratzscher ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) und Professor für Makroökonomie an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Die Lebensqualität hat sich dramatisch verbessert
Vor dem Erscheinen des Homo sapiens als eigene Spezies vor fast 300.000 Jahren, war das Leben der Menschen bestimmt von Überlebensinstinkt und Vermehrungstrieb. Der Lebensstandard entsprach mehr oder weniger dem Existenzminimum und veränderte sich weltweit im Lauf der Jahrtausende kaum. Oded Galor stellt fest: „Erstaunlicherweise haben sich jedoch unsere Daseinsbedingungen in den letzten paar Jahrhunderten radikal gewandelt. Im Verhältnis zur langen Geschichte unserer Spezies hat die Menschheit praktisch über Nacht eine dramatische und beispielslose Verbesserung der Lebensqualität erfahren.“ Lange herrschte die Ansicht vor, die Lebensstandards seinen schrittweise über die gesamte Menschheitsgeschichte hinweg gestiegen. Doch das ist ein verzerrtes Bild. Oded Galor ist israelischer Wirtschaftswissenschaftler und mehrfach ausgezeichneter Professor an der Brown University, USA. Er forscht vor allem zum Thema Wirtschaftswachstum.
Den Beruf fürs Leben gibt es nicht mehr
Arbeitnehmer in Deutschland müssen heute und in Zukunft zu Lasten des Familienlebens permanente berufliche Mobilität beweisen. Zudem gibt es immer mehr zeitlich befristete Jobs. Und berufliche Laufbahnen von der Ausbildung bis zum Ruhestand sind für künftige Generationen kaum mehr möglich. Neue Beschäftigungsformen machen den „Beruf fürs Leben“ zur Ausnahme und den Zweitjob neben dem Teilzeitarbeitsplatz bald zur Regel. Horst Opaschowski weiß: „Die meisten Berufstätigen befürchten für die Zukunft neben wachsender Arbeitsplatzunsicherheit mehr Druck und Stress im Arbeitsleben.“ Eine problematische Perspektive für die neue Generation, die mit Gefordert-, Überfordert- und Ausgebranntsein leben muss.“ Horst Opaschowski gründete 2014 mit der Bildungsforscherin Irina Pilawa das Opaschowski Institut für Zukunftsforschung. Bis 2006 lehrte er als Professor für Erziehungswissenschaften an der Universität Hamburg. Ab 2007 leitete er die Stiftung für Zukunftsfragen.
Auf Stagnation folgte Wachstum
Thomas Malthus glaubte seine „Armutsfalle“ als ewiges Weltgesetz etabliert zu haben. Doch plötzlich kam der von ihm beschriebene Mechanismus zum ersten Mal zum Stillstand. Und die Metamorphose von der Stagnation zum Wachstum nahm ihren Lauf. Oded Galor fragt: „Wie schaffte es die menschliche Spezies, der Armutsfalle zu entkommen?“ Um unter anderem diese Frage beantworten, hat Oded Galor eine einheitliche Theorie entwickelt, die versucht, die Reise der Menschheit in ihrer Gesamtheit zu erfassen. Diese Theorie veranschaulicht, welche Kräfte den Übergang von einer Epoche der Stagnation zu einer Ära anhaltender Steigerung des Lebensstandards bestimmten. Zudem verdeutlicht sie den Einfluss der Vergangenheit auf das Schicksal der Nationen. Oded Galor ist israelischer Wirtschaftswissenschaftler und mehrfach ausgezeichneter Professor an der Brown University, USA. Er forscht vor allem zum Thema Wirtschaftswachstum.
Die Globalisierung muss verbessert werden
Clemens Fuest vertritt die These, dass die Globalisierung nicht abgeschafft, sondern verbessert wird. Er erläutert: „Globalisierung ist ein Prozess, in dem die Länder der Welt durch politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Austausch zunehmend verbunden sind. Damit beeinflussen sie sich immer mehr gegenseitig.“ Die Corona-Pandemie selbst ist das beste Beispiel dafür, wie sehr die Welt durch Globalisierung verbunden ist. Leider im negativen Sinne. Der Flügelschlag einer Fledermaus in China hat die Weltwirtschaft in die Knie gezwungen. Zunächst muss man jedoch unterscheiden zwischen den Problemen während der Krise und den Perspektiven für die Globalisierung danach. Dass während der Coronakrise der Welthandel unterbrochen wurde, heißt nicht, dass er auch künftig gestört sein wird. Oder dass es sinnvoll ist, ihn einzuschränken. Clemens Fuest ist seit April 2017 Präsident des ifo Instituts.
Das Coronavirus war nicht besonders tödlich
Skeptiker weisen gerne darauf hin, das Bemerkenswerteste an der Covid-Krise sei, dass man aus etwas Gewöhnlichem eine globale Krise gemacht hätte. Egal, was man tut, Menschen sterben, und an Covid sterben dieselben Menschen, die normalerweise auch sterben – alte Menschen mit Vorerkrankungen. Adam Tooze nennt Beispiele: „In einem normalen Jahr sterben diese Menschen an Grippe und Lungenentzündung. Jenseits des privilegierten Kerns der reichen Welt sterben Millionen von Menschen an Infektionskrankheiten wie Malaria, Tuberkulose und HIV. Und trotzdem geht das Leben weiter.“ Das Coronavirus war, gemessen an den Maßstäben historischer Seuchen, nicht besonders tödlich. Was beispiellos war, war die Reaktion. Überall auf der Welt kam das öffentliche Leben zum Erliegen, genauso wie große Teile des Handels und des regulären Geschäftsverkehrs. Adam Tooze lehrt an der Columbia University und zählt zu den führenden Wirtschaftshistorikern der Gegenwart.
Die Fortpflanzung ist ein genetischer Zwang
Eine Spezies nutzt grundsätzlich alle für sie geeigneten Ressourcen, um zu expandieren. Vermehrung und Ausbreitung enden erst, wen die Ressourcen erschöpft sind und der Umweltwiderstand zu groß wird. Dirk Steffens und Fritz Habekuss wissen: „Dabei ist Fortpflanzung keine Option, sondern ein genetischer Zwang. Soweit gilt das für alle Arten. Auch für Homo sapiens.“ Die Menschen sind in Sachen Vermehrung aber sogar außergewöhnlich erfolgreich. In seinem Buch „Das Ende der Evolution“ stellt der Evolutionsbiologe Matthias Glaubrecht fest: „Was uns von Schimpansen und Gorillas oder gar vom Orang-Utan trennt, und zwar um mehrere Größenordnungen, ist die Anzahl unseres Nachwuchses.“ In ihrem Buch „Über Leben“ erzählen der Moderator der Dokumentationsreihe „Terra X“ Dirk Steffens und Fritz Habekuss, der als Redakteur bei der „ZEIT“ arbeitet, von der Vielfalt der Natur und der Schönheit der Erde.
Wolfgang Ischinger verbreitet Optimismus
Trotz der vielen Krisen überall auf der Welt, gibt es durchaus Grund zum Optimismus. Wolfgang Ischinger erläutert: „Denn nimmt man einmal ein wenig Abstand von den tagesaktuellen Nachrichten und versucht, das große Ganze in den Blick zu nehmen, bietet sich das Bild einer Menschheit, die immer friedlicher, aber auch gesünder und reicher geworden ist.“ Dieses Bild, so betonte der Harvard-Professor Steven Pinker immer wieder, zeigt, dass sich die Menschheit insgesamt in die richtige Richtung bewegt. Steven Pinkers Optimismus wird durch wichtige aktuelle Kennzahlen gestützt. Egal wie oft man in den Nachrichten von Kriegen und Kriegsopfern hört und liest, Fakt ist: Die globalen Opferzahlen sind in den Jahrzehnten seit dem Zweiten Weltkrieg deutlich zurückgegangen. Wolfgang Ischinger ist Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz und einer der renommiertesten deutschen Experten für Außen- und Sicherheitspolitik.
Die scheinbar bedrohten Eliten schotten sich ab
Weltweit haben Sozialwissenschaftler in Studien herausgefunden, dass eine wesentliche Ursache für die Ausbreitung geschlossener Wohnformen das gesellschaftspolitische Klima in einer Region ist. Ernst-Dieter Lantermann erläutert: „Je tiefer die Kluft zwischen Arm und Reich und je engagierter in der Öffentlichkeit diese Spaltung diskutiert wird, umso häufiger werden Gated Communities errichtet.“ Für den Religionswissenschaftler Manfred Rolfes ist es keine Überraschung, wenn ein einem öffentlichen Diskurs, der zum einen Armut als Bedrohung kommuniziert, zum anderen den wachsenden Reichtum einer kleinen Minderheit zum Thema macht, Gated Communities gedeihen, in denen die Begüterten vor den ökonomisch und sozial Benachteiligten geschützt werden müssen. Für den Soziologen Ulrich Vogel-Sokolowsky sind Gated Communities Ausdruck einer wachsenden Polarisierung zwischen Arm und Reich auch in Deutschland. Ernst-Dieter Lantermann war von 1979 bis 2013 Professor für Persönlichkeits- und Sozialpsychologie an der Universität Kassel.
Die Globalisierung löste eine Umverteilung aus
Die Globalisierung und neue Technologien wie Digitalisierung spalten laut Alexander Hagelüken den deutschen Arbeitsmarkt, schrumpfen die Mittelschicht und treiben die Einkommen auseinander. Die Globalisierung lässt Arbeitsplätze verschwinden wie beispielsweise jene in Schuhfabriken. Sie trifft Arbeitnehmer, die den gut ausgebildeten, aber trotzdem günstigen Asiaten oder Osteuropäern unterliegen. In Deutschland wirkte sich besonders der Fall des Eisernen Vorhangs aus, sagt Joachim Möller, Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Bis zur Wende nahmen die Reallöhne nämlich zu. Dann kam die Konkurrenz, etwa tschechische Arbeiter, die anfangs ein Zehntel deutscher Löhne verdienten. Joachim Möller erklärt: „Es wurden Arbeitsplätze verlagert. Vor allem wirkte die Drohung mit der Verlagerung: Das reichte schon, um in Deutschland niedrige Löhne durchzusetzen. Das veränderte die Machtverhältnisse zugunsten der Arbeitgeber.“ Alexander Hagelüken ist als Leitender Redakteur der Süddeutschen Zeitung für Wirtschaftspolitik zuständig.
Der Klimawandel erhöht die Zahl der Hungernden
Hoffnung und Wachstum in der Welt beruhen darauf, dass die heutige Globalisierung kein Nullsummenspiel mehr ist. Menschen und Gemeinschaften können sich mithilfe weltumspannender Handelsbeziehungen aus einem Leben in totaler Armut befreien. Nadav Eyal warnt: „Aber eine neue, dunkle Variante ist in die Gleichung eingedrungen.“ Die Länder im Norden ziehen beim Bruttoinlandsprodukt pro Kopf echten Nutzen aus der Erderwärmung. Obwohl sie diese selbst verursacht haben und weiter verursachen. Den Preis dafür zahlt fast ausschließlich der Süden. Der Klimawandel wird die Zahl der Hungernden in den nächsten Jahrzehnten um 10 bis 20 Prozent anschwellen lassen. Diese Warnung geht vom Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen aus. Bis 2050 könnten zusätzliche 1,7 Milliarden Menschen unter mangelnder Ernährungssicherheit leiden. Nadav Eyal ist einer der bekanntesten Journalisten Israels.
Philipp Blom beschreibt die Revolte gegen die Moderne
Die Revolte gegen die Moderne kanalisiert soziale Ängste. Sie gießt sie in ein manichäisches Schema von Gut und Böse, Licht und Dunkel. Philipp Blom stellt fest: „Es ist die Veränderung selbst, die sie ablehnt, die sozialen und politischen Nebenwirkungen des technologischen Fortschritts.“ Sie will die Warenströme der Globalisierung ohne die Menschenströme. Sie will die technologischen Innovationen der Wissenschaft ohne ihre unbequemen Fakten. Die Moderne soll gezähmt werden. Sie soll Wohlstand ohne gesellschaftliche Veränderung schaffen. Man will zurück in Zeiten, in denen noch eine natürliche Ordnung herrschte. Damals konnten die Einheimischen noch selbst bestimmen. Das Land und seine Straßen gehörten noch ihnen. Philipp Blom studierte Philosophie, Geschichte und Judaistik in Wien und Oxford und lebt als Schriftsteller und Historiker in Wien.
Georg Simmel befasst sich als einer der Ersten mit der Armut
Armut ist die Hölle. Wenn Philipp Lepenies das behauptet, widerspricht kaum jemand. Wenn es um Armut, deren Beschreibung und Qualifizierung geht, sind es fast immer die von Armut nicht betroffenen, die sich ein Urteil darüber erlauben. Das ist für Philipp Lepenies ein ganz wichtiger Punkt, denn Armut ist kein alleinstehendes Phänomen von Individuen. Armut ist eingebunden in den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang. Armut in ihrer ganzen Tragweite kann man daher nur dann richtig erfassen, wenn man die Reaktion der Nichtbetroffenen auf Armut beleuchtet. Man kann schließlich nie arm und reich zugleich sein. Der deutsche Soziologe Georg Simmel hat sich am Anfang des 20. Jahrhunderts als einer der Ersten in seinem Aufsatz „Soziologie der Armut“ damit befasst, was eigentlich das Entscheidende an der Armut ist. Prof. Dr. Philipp Lepenies ist Gastprofessor für vergleichende Politikwissenschaft und Direktor des Forschungszentrums für Umweltpolitik an der Freien Universität Berlin.
Der Hass ist umfassend und allgemein
Der Hass stellte eine negative Emotion dar, der sich auf das Ganze der Person konzentriert statt auf die einzelne Tat. Obgleich auch der Zorn auf eine Person gerichtet ist, liegt sein Focus auf der Tat, und wenn die Tat irgendwie aus der Welt geschafft wird, kann man erwarten, dass sich auch der Zorn verflüchtigt. Martha Nussbaum fügt hinzu: „Der Hass hingegen ist umfassend und allgemein, und wenn dabei Handlungen eine Rolle spielen, dann einfach deshalb, weil alles an der Person in einem negativen Licht gesehen wird.“ Aristoteles zufolge gibt es nur eine einzige Sache, die gegen den Hass hilft und ihn wirklich zur Ruhe kommen lässt: nämlich dass die Person zu existieren aufhört. Martha Nussbaum ist Philosophin und Professorin für Rechtswissenschaften und Ethik an der University of Chicago. Sie ist eine der einflussreichsten Philosophinnen der Gegenwart.
Das Grundgesetz sichert die Menschenwürde
Das gesamte Recht in Deutschland berücksichtigt die wichtigsten Grundwerte der Gesellschaft – Menschenwürde, Menschlichkeit und die Gleichheit aller. Jens Gnisa ergänzt: „Das Grundgesetz als oberstes Gesetz sichert das allen Bürgern zu. Jedes andere Gesetz hat diese Werte zu beachten, darüber wacht das Bundesverfassungsgericht.“ Auch die Behörden haben sie bei ihren Entscheidungen zu berücksichtigen, ebenfalls die Gerichte, wenn sie deshalb angerufen werden. Auf jeder dieser Stufen wird als die Menschenwürde streng beachtet. Den Vorstellungen des Rechts folgend, ist nach einer rechtskräftigen und abschließenden Entscheidung gar kein Platz mehr dafür, dass gesellschaftliche Gruppen diese Ergebnisse infrage stellen. Es ist gesetzt und soweit unantastbar. Dies gilt selbstverständlich auch im Ausländerrecht. Jens Gnisa ist Direktor des Amtsgerichts Bielefeld und seit 2016 Vorsitzender des Deutschen Richterbundes.
Oscar Wilde besaß einen ungewöhnlichen Widerspruchsgeist
Der irische Schriftsteller Oscar Wilde studierte am Trinity College in Dublin und machte dann Furore in London. Er beschäftigte sich als extravaganter Ästhet intensiv mit Kunst. Er begeisterte sich dabei für die Kunst um ihrer selbst willen und betrachte sie zudem als eine verstecke Form des politischen Radikalismus. Terry Eagleton weiß: „Oscar Wilde war Salonlöwe und Homosexueller, Angehöriger der Oberklasse und Underdog, angesehener Bürger und Freier von Strichjungen, schamloser Bon Viveur und, nach eigenen Bekunden, Sozialist. Genauso vertraut, wie er mit den Lady Bracknells umging, verkehrte er auch in aufständischen Kreisen und zählte Revolutionäre wie William Morris und Peter Kropotkin zu seinen Freunden. Der Literaturwissenschaftler und Kulturtheoretiker Terry Eagleton ist Professor für Englische Literatur an der University of Manchester und Fellow der British Academy.
Demokratien brauchen Märkte
In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg wurden das liberale Denken und die Marktwirtschaft zum Traumpaar der politischen und ökonomischen Theorie. Philipp Blom erläutert: „Der Gedanke, dass alle Menschen gleiche Rechte haben, dass Wissen besser ist als Ignoranz, dass Menschen einander tolerieren müssen, auch wenn sie unterschiedlicher Meinung sind, wurde auf einem Markt geboren.“ Händler müssen pragmatisch und nicht ideologisch urteilen, sie brauchen sachliche Informationen, die ihnen bei der Urteilsfindung helfen, Informationen, auf die sie Geld wetten können, ohne ruiniert zu werden. Die ersten Zeitungen entstanden im 16. Jahrhundert in Handelszentren, um Kaufleute darüber zu informieren, was bei ihren Handelspartnern geschah, welche Investitionen sicher waren. Philipp Blom studierte Philosophie, Geschichte und Judaistik in Wien und Oxford und lebt als Schriftsteller und Historiker in Wien.
Die Lehre der Stoiker geht auf das Jahr 300 v. Chr. zurück
Eine mit farbenfrohen Fresken geschmückte Säulenhalle – „stoa poikile“ – nicht weit von der Athener Akropolis gab einer antiken Philosophenschule den Namen: der Stoa. Bernd Roeck weiß: „Ihre antike Geschichte umspannt ein halbes Jahrtausend, von der Begründung durch Zenon um 300 v. Chr. bis in die Tage des römischen Kaisers Mark Aurel (161 – 180 n. Chr.).“ Dessen „Selbstbetrachtungen“ sind das letzte bedeutende Zeugnis ihrer vorchristlichen Periode. Die Lehre der Stoiker dürfte dazu beigetragen haben, die Akzeptanz des Christentums im griechisch-römischen Kulturraum herbeizuführen. Umgekehrt werden christliche Theologen in der Philosophie der Stoa mannigfache Punkte der Anknüpfung finden. Zenon hielt den sterblichen Leib gegenüber dem Geist, der dem ewigen Feuer gleiche und damit am göttlichen teilhabe, für unwichtig. Bernd Roeck ist seit 1999 Professor für Neuere Geschichte an der Universität Zürich und einer der besten Kenner der europäischen Renaissance.
Nach 1918 brachen die europäischen Demokratien aus vier Gründen zusammen
In seinem Buch „Höllensturz“, das sich mit der Zwischenkriegszeit auseinandersetzt, beschreibt der britische Historiker Ian Kershaw vier Faktoren, die nach 1918 zum Zusammenbruch der europäischen Demokratien führten: Erstens die explosionsartige Ausbreitung eines ethnisch-rassistischen Nationalismus. Zweitens erbitterte und unversöhnliche territoriale Revisionsforderungen. Drittens ein akuter Klassenkonflikt. Viertens eine langanhaltende Krise des Kapitalismus. Philipp Blom schreibt: „Man muss nicht lange suchen, um in dieser Vergangenheit unsere Gegenwart zu erkennen. Keine Facette, die sich in dieser Aufzählung nicht spiegeln würde – von den nationalistisch-rassistischen Rechtspopulisten im Weißen Haus bis zur Krim und dem Krieg in der Ostukraine, von der täglich steigenden sozialen Ungleichheit bis zum Crash von 2008 und zur nächsten großen Finanzkrise eines immer weiter deregulierten Marktes.“ Philipp Blom studierte Philosophie, Geschichte und Judaistik in Wien und Oxford und lebt als Schriftsteller und Historiker in Wien.
Das Unbehagen am Kapitalismus ist weit verbreitet
Das unbestreitbar Neue am modernen Kapitalismus, wie er seit knapp zwei Jahrhunderten die westliche Wirtschaft formt, ist seine Dynamik. Sie entsteht, weil Unternehmen ihre Gewinne nicht anhäufen, sondern gleich wieder investieren, vorzugsweise in neue Technik, die dazu führt, dass noch mehr und noch billiger produziert und noch mehr Geld verdient wird. Und so weiter. Auf diese Weise wuchs das Vermögen, vermehrte sich die Masse der Konsumgüter, wuchs die Wirtschaft in einem bisher nie gekannten Maße. Allerdings kam es dadurch auch zu einer völlig neuen Ballung ökonomischer Macht. Heute benutzen den Begriff „Kapitalismus“ fast nur noch seine Kritiker. Vor allem bündelt der Begriff das Unbehagen am aktuellen Wirtschaftssystem. An der Tendenz, allem einen Preis zu geben. An dem Trend, für den wirtschaftlichen Vorteil jede Moral beiseite zu stellen.
Der Optimismus der Menschen vor 1914 war schier grenzenlos
Karl Marx und andere progressive Denker haben ein Geschichtsbild geformt, in dem der Fortschritt zentral ist und alle historischen Hindernisse überwunden werden können. Philipp Blom erläutert: „Im 19. Jahrhundert war dieser Gedanke mehr als verständlich. Wissenschaft und Industrie schienen täglich neue Wunder zu vollbringen, und im Laufe der Jahrzehnte wurden Armut und Krankheiten immer weiter zurückgedrängt.“ Es schien, als sei die Zivilisation tatsächlich imstande, ein Neues Jerusalem zu bauen und Hunger, Armut, Unwissenheit und Krieg völlig auszurotten. Es ist heute schwer nachzuvollziehen, von welchem Optimismus viele Menschen in den westlichen Ländern vor 1914 getragen waren. Alles schien lösbar, alles schien möglich, die Kraft der Zivilisation schien unbegrenzt. Philipp Blom studierte Philosophie, Geschichte und Judaistik in Wien und Oxford und lebt als Schriftsteller und Historiker in Wien.
Ungleichheit wird immer weiter vererbt
Viele Funktionäre, die in der Wirtschaft tätig sind und zahlreiche Ökonomen betonen gern, wie sehr eine Marktwirtschaft der Gegensätze bedarf. Wer wenig verdient, wird durch erfolgreiche Vorbilder angespornt und steigert dadurch das Wirtschaftsprodukt. Wer in einer Villa wohnt, darf daher nicht durch hohe Steuern belastet werden, denn das mindert die Leistungsbereitschaft aller. Aus dieser Sicht ist finanzielle Ungleichheit kein Problem, sondern ein Anreiz. Alexander Hagelüken kritisiert: „Viele Wirtschaftsfunktionäre und Ökonomen gehen aber zu weit, weil sie Ungleichheit gleich zum Mantra erfolgreicher Marktwirtschaften erheben.“ Sie sehen nur die glänzenden Oberflächen, nicht die Ambivalenz der Ungleichheit. Sie konzentrieren sich auf Ungleichheit als Anreiz und vernachlässigen, wie sehr zu große Ungleichheit zum Problem wird. Alexander Hagelüken ist als Leitender Redakteur der Süddeutschen Zeitung für Wirtschaftspolitik zuständig.
Der Markt zählt zu den ältesten gesellschaftlichen Erfindungen
Die Menschheit kennt mehr als nur eine Ordnungsform visionärer Kraft, die sich dem Prinzip Freiheit verpflichtet. Zusätzlich zur dreidimensionalen Kultivierung, also den visionären Kräften von Technik, Medizin und Erziehung, gibt es die konstitutionelle Demokratie. In ihr wird die politisch notwendige Herrschaft von den Betroffenen selbst ausgeübt und dabei an Freiheitsrechte, an negative und positive Freiheiten, gebunden. Otfried Höffe fügt hinzu: „Eine dritte Vision, eine der ältesten gesellschaftlichen Erfindungen, der Markt, erlaubt den Menschen, das für sie notwendige Arbeiten und Wirtschaften sowie jede Form von Wettstreit und Konkurrenz frei und selbstbestimmt, ohne Einschränkung seitens Dritter, vorzunehmen.“ In Bezug auf die Arbeit ergänzt der Markt das Freiheitspotential der Technik. Otfried Höffe ist Professor für Philosophie und lehrte in Fribourg, Zürich und Tübingen, wo er die Forschungsstelle Politische Philosophie leitet.