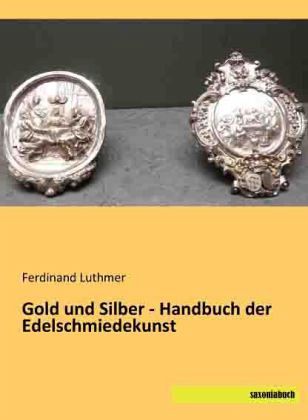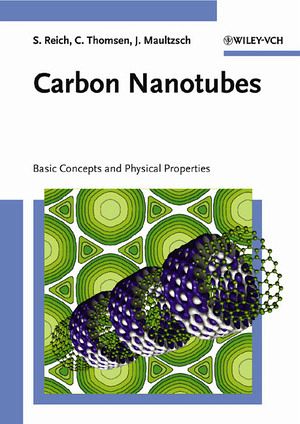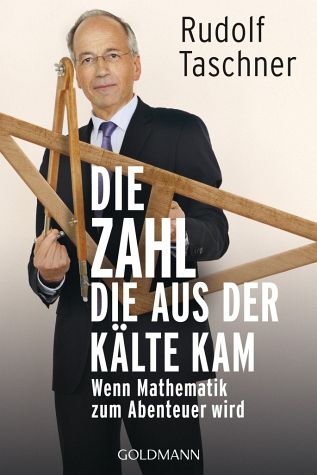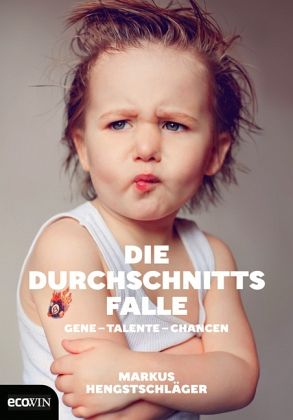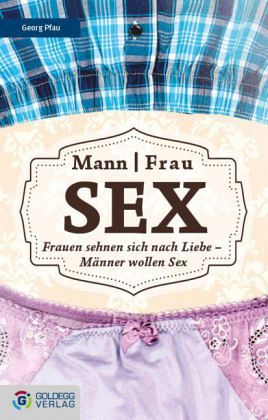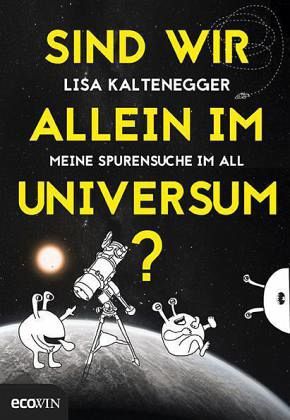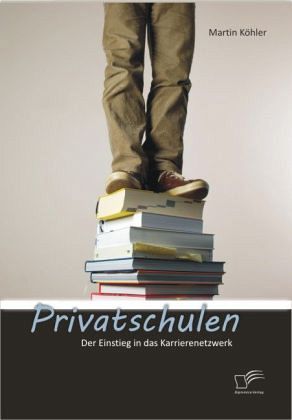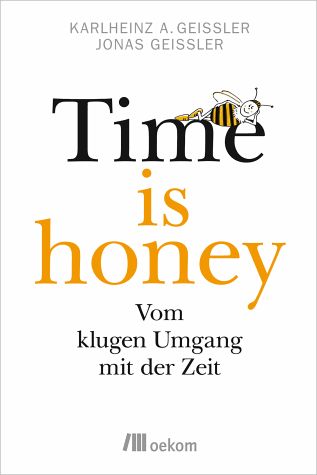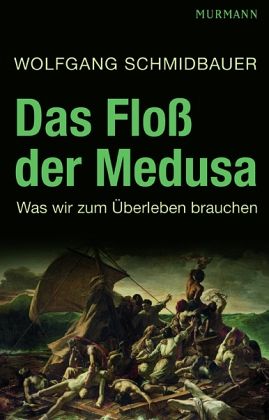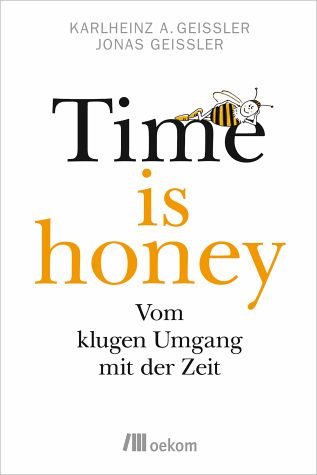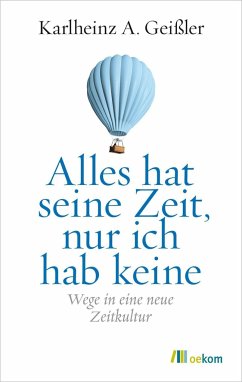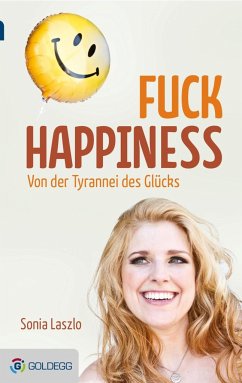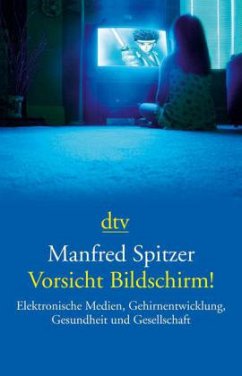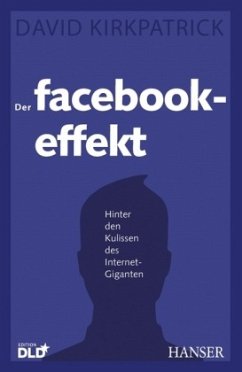Edelmetalle wie Gold, Silber oder Platin haben besondere Eigenschaften, die sie für die Wissenschaft und Technik unentbehrlich machen. Außerdem symbolisieren Gold und Silber schon seit frühesten Zeiten Reichtum und Wohlstand. Schließlich kommen die beiden Edelmetalle auf der Erde nur sehr selten vor. Durchschnittlich enthält die Erdkruste nur vier Gramm Gold pro tausend Tonnen Gestein. Weil sie aber dennoch von vielen Menschen so begehrt sind, werden zu hohen Preisen gehandelt. Woher die Edelmetalle aber stammen, konnte die Wissenschaft lange nicht mit Bestimmtheit sagen. Jetzt scheint sie eine Antwort auf die Frage gefunden zu haben. Es scheint geklärt zu sein, dass Gold und Silber nichts anderes als Sternenstaub sind. Der Geologe Simon Goldmann von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe erklärt: „Elemente, wie Gold und Silber, die relativ viele Protonen und Neutronen haben, entstehen durch Sternenexplosionen.“
Wissenschaft
Der neue Wunderwerkstoff Karbon ist federleicht und bärenstark
Karbon, das aus Kohlenstofffasern besteht, vereinigt in sich viele Vorzüge: es ist äußerst leicht und dennoch extrem stabil und belastbar. Vergleicht man Karbon zum Beispiel mit Stahl, ist es nicht einmal halb so schwer. Und auch gegenüber Aluminium ist es noch um ein Drittel leichter. Deshalb gilt Karbon in der Autobranche als der Werkstoff, der dem Elektroauto in Deutschland zum Durchbruch verhelfen soll. Denn je weniger ein Elektrofahrzeug wiegt, desto mehr Kilometer kann es zurücklegen, bevor es wieder an die Steckdose zum Aufladen muss. Zum geringen Gewicht des Produkts Karbon gesellen sich noch weitere entscheidende Vorteile: Verbundstoffe aus Karbonfaser korrodieren nicht. Rost ist deshalb für Autos aus Karbon kein Thema mehr. Professor Klaus Drechsler von der Technischen Universität München erläutert einen weiteren Vorzug: „Dazu zeichnen sie sich durch einige interessante funktionale Eigenschaften aus, etwa durch die Möglichkeit zur einfachen Integration von Sensoren, die den Betriebszustand überwachen.“
Die Bedeutung und der Umgang mit Zahlen in alten Kulturen
Mit Zahlen umgehen zu können, war in alten Zeiten die Schlüsselkompetenz für ein reiches und sorgenfreies Leben. Vermessungsbeamte in Ägypten hatten bereits einen wichtigen Schritt in diese Richtung vollzogen: Sie konnten mit Zahlen rechnen, die über ein Dutzend hinausgingen und bei einigen Hundert endeten. Rudolf Taschner ergänzt: „So weit musste man rechnen können, um den Bauern die Felder nach den Anzahlen der Klafter, die diese Äcker lang und breit waren, zuteilen zu können. Auch um die Getreidesäcke zählen zu können, welche die Bauern ablieferten.“ Ganz hoch auf der Karriereleiter konnten jene Beamten und Schreiber im alten Ägypten klettern, die sogar über mehrere Hundert, ja über tausend hinaus zu zählen und zu rechnen verstanden. Rudolf Taschner ist Professor an der Technischen Universität Wien. Im Jahr 2004 wurde er zum Wissenschaftler des Jahres gewählt. Seine Bücher wurden vielfach ausgezeichnet.
Rudolf Taschner erklärt die Anfänge der Vermessung der Erde
Sobald sich die Menschen langfristig an einem Ort ansiedelten, lernten sie sehr schnell die elementarsten Begriffe der Geometrie. Vor allem wollten sie wissen, wie groß der Grund ist, den sie bewirtschafteten. Um die Strecke messen zu können, die ein Bauer vor sich sieht, vergleicht er sie mit einer Längeneinheit, beispielsweise einem Klafter, der bei ausgestreckten Armen von der einen Spitze der Hand zur anderen reicht. Rudolf Taschner fügt hinzu: „Wenn sein rechteckiges Beet einen Klafter breit und sieben Klafter lang ist, glaubt er sich gleich reich wie sein Nachbar, der ein quadratisches Beet bepflanzt, das vier Klafter breit und lang ist. Denn im Umfang stimmen die beiden Beete überein: bei beiden beträgt dieser 16 Klafter.“ Rudolf Taschner ist Professor an der Technischen Universität Wien. Im Jahr 2004 wurde er zum Wissenschaftler des Jahres ernannt. Seine Bücher wurden vielfach ausgezeichnet.
Markus Hengstschläger teilt sein Wissen über die Gene
Für Markus Hengstschläger steht ohne Zweifel fest, dass der Mensch mit all seinen Eigenschaften niemals nur auf seine Gene reduzierbar, sondern ein Produkt der Wechselwirkung zwischen Genetik und Umwelt ist. Der Mensch besitzt etwa 22.500 Gene. Jeder dieser Gene hat man zweimal, einmal von der Mutter und einmal vom Vater. Markus Hengstschläger erklärt: „Im Zuge der sexuellen Fortpflanzung entsteht Individualität der Nachkommen dadurch, dass ja Ihre Mutter und Ihr Vater die beiden Sets an Genen auch von deren Vater und Mutter (je zur Hälfte geerbt haben). Für jedes Gen ist die Frage, welches der beiden (das großväterliche oder großmütterliche) Sie an ihre Nachkommen weitergeben, schon einmal Zufall.“ Mit 16 Jahren war Markus Hengstschläger als Punk unterwegs. Mit 24 Jahren promovierte er zum Doktor der Genetik und 35-jährig zum jüngsten Universitätsprofessor für Medizinische Genetik berufen.
Georg Pfau kritisiert die antiquierte Sexualerziehung der Mädchen
Die fehlende Lust der Frau ist laut Georg Pfau ein häufiges Thema in der Sexualmedizin. Hier gibt es seiner Meinung nach viele Faktoren zu bedenken, allen voran die Methoden zur hormonellen Verhütung. Jede Gabe eines Sexualhormons, in welcher Form auch immer, beeinflusst die weibliche Sexualität. Georg Pfau erklärt: „Sie verändern nicht nur die Libido, das sexuelle Verlangen, sondern auch die sexuelle Präferenz, die sexuelle Vorliebe. Inzwischen gibt es genügend Studien, die beweisen, dass selbst die Partnerwahl durch hormonelle Kontrazeption beeinflusst wird.“ Das heißt: Frauen finden unter Hormongabe manchmal andere Männer begehrenswert als unter den eigenen Hormonen. Dr. Georg Pfau ist Arzt und Sexualmediziner. Er ist Mitglied der „Deutschen Akademie für Sexualmedizin“ in Berlin sowie Vorstands- und Gründungsmitglied der „Österreichischen Akademie für Sexualmedizin“ in Salzburg.
Lisa Kaltenegger glaubt an die Entdeckung einer zweiten Erde
Die österreichische Astrophysikerin Lisa Kaltenegger fahndet nach zweiten Erden und sucht nach Spuren möglichen Lebens auf Exoplaneten. Einen Exoplaneten definiert Lisa Kaltenegger wie folgt: „Ein Planet, der um einen anderen Stern kreist, also um eine andere Sonne als die unsere. Exo bedeutet extrasolar, also außerhalb unseres Sonnensystems.“ Allerdings sind die am nächsten gelegenen zwischen vier und fünfzig Lichtjahre von der Erde entfernt. Die Entfernung beträgt also mehrere Billionen Kilometer. Lisa Kaltenegger kann anhand des Lichts von diesen Planeten feststellen, wie es dort wahrscheinlich aussieht und ob dort Leben möglich ist. Lisa Kaltenegger ist Leiterin einer Forschungsgruppe am Max-Planck-Institut in Heidelberg. Außerdem unterrichtet sie an der Harvard University in Cambridge. Die Wissenschaftlerin gehörte zum Forschungsteam, das Mitte April erdähnliche Planeten entdeckte.
Die Sexualhormone steuern die Sexualität des Menschen
Die sexuellen Bedürfnisse von Männern und Frauen unterscheiden sich laut Georg Pfau gravierend, sowohl in Qualität als auch in Quantität. Die Verantwortung dafür tragen die Sexualhormone, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Georg Pfau erklärt: „Jawohl, die Sexualhormone steuern die Sexualität des Menschen, allenfalls ergänzt durch Erziehung und Erfahrungen.“ Ulrich Pfau kritisiert, dass die Gegenwart geprägt ist durch die Verleugnung des Naturalistischen am Menschen, so als schiene der Mensch sich seiner Herkunft zu schämen. Die Menschen haben scheinbar vergessen, woher sie kommen, und führen sich auf, als wären sie Gott, wobei der Wahlspruch lautet: Alles ist machbar. Doch dies ist ein fataler Irrtum. Dr. Georg Pfau ist Arzt und Sexualmediziner. Er ist Mitglied der „Deutschen Akademie für Sexualmedizin“ in Berlin sowie Vorstands- und Gründungsmitglied der „Österreichischen Akademie für Sexualmedizin“ in Salzburg.
Georg Pfau gewährt Einblicke in die Sexualität von Mann und Frau
Die Lust mag der Anreiz für die Sexualität sein, die Kommunikation das eigentliche Motiv, die Fortpflanzung ist der Auftrag der Evolution. Der evolutionsbiologische Auftrag liegt laut Georg Pfau in den Genen des Menschen und hat damit eine ganz besondere Bedeutung. Ursprünglich diente die Sexualität nur der Fortpflanzung. Das ganze menschliche Sein ist darauf abgestimmt, die Art zu erhalten. Georg Pfau schreibt: „Auch wenn der Mensch seiner Sexualität andere Inhalte verliehen hat, die Gene haben wie immer das letzte Wort. Man kann sich ihnen nicht entziehen, sie beherrschen das Tun und Lassen, vor allem in der Auswahl der Partner.“ Weil der Auftrag zur Fortpflanzung im Unterbewusstsein dominierend ist, empfinden Frauen und Männer am anderen Geschlecht genau jene Eigenschaften sexy, die Fruchtbarkeit und Willen zur Fortpflanzung signalisieren. Dr. Georg Pfau ist Arzt und Sexualmediziner. Er ist Mitglied der „Deutschen Akademie für Sexualmedizin“ in Berlin sowie Vorstands- und Gründungsmitglied der „Österreichischen Akademie für Sexualmedizin“ in Salzburg.
Die Angebote für das Erfolgsprojekt Kind sind grenzenlos
Neben Englisch lernen in der Schweiz in Privatschulen immer mehr Kinder schon im frühsten Alter Chinesisch. Denn es ist wissenschaftlich erwiesen, dass junge Kids eine Zweitsprache erstaunlich leicht aufnehmen. Doch die Forscher haben auch die klare Erkenntnis gewonnen, dass der Effekt solcher Anfangserfolge nicht anhält, wenn die Kinder die Sprache nicht in mindestens vierzig Prozent ihrer Zeit sprechen. Im Klartext heißt das: Es schadet nichts, bringt aber auch nichts. Dennoch glauben viele Eltern an die Theorie vom frühen Erlernen einer Fremdsprache. Während Chinesisch noch als exotisch gilt, steigt die Nachfrage nach Englisch für die Kleinsten seit Jahren. Edith Tribelhorn, Geschäftsführerin des Verbands Kindertagesstätten der Schweiz, erklärt: „Wir beobachten ganz klar einen Trend zu zweisprachigen Krippen.“ In der Stadt Zürich pflegen beispielsweise 22 der 268 Krippen ein Konzept mit Englisch und Deutsch.
In der Sexualität und der Erotik ziehen sich die Gegensätze an
Das wichtigste Sexualorgan ist und bleibt für Georg Pfau das Gehirn, weil sich dort die wichtigsten Sexualzentren befinden. Alle sexuellen Verhaltensmuster sind in ihnen abgespeichert, viele davon haben nicht die geringste Chance, sich zu verändern. Georg Pfau erklärt: „Die sexuellen Vorlieben, die Geschlechtsrolle, die Geschlechtsidentität und die sexuelle Orientierung gelten als unveränderbar.“ Das bedeutet allerdings nicht, dass die Menschen ihnen willenlos ausgeliefert wären. Denn für die Umsetzung sexueller Vorlieben gibt es Haupt- und Nebenströmungen. Georg Pfau vertritt die These, dass fehlendes Wissen um die kleinen oder doch großen Unterschiede zwischen Frauen und Männern nicht nur in der Gesellschaft zu verzichtbaren Dissonanzen wie dem Geschlechterkampf führen. Auch innerhalb einer Beziehung ist es häufig die Grundlage für Missverständnisse und Streit. Dr. Georg Pfau ist Arzt und Sexualmediziner. Er ist Mitglied der „Deutschen Akademie für Sexualmedizin“ in Berlin sowie Vorstands- und Gründungsmitglied der „Österreichischen Akademie für Sexualmedizin“ in Salzburg.
Georg Pfau erklärt den Unterschied zwischen Mann und Frau
Georg Pfau stellt zunächst einmal fest, dass es zwei verschiedene Geschlechter mit unterschiedlichen Talenten gibt. Dabei gibt er zu, dass die Wahrheit über den Unterschied zwischen beiden nicht immer leicht herauszufinden ist. Diese Feststellung hat einen Hintergrund. Denn Georg Pfau beobachtet Bestrebungen in der Gesellschaftspolitik, die verbreiten wollen, dass Männer und Frauen primär gleich sind, sozusagen idente Wesen, allenfalls mit unterschiedlichen Geschlechtsorganen. Männliche und weibliche Eigenschaften wären dann reine soziale Konstrukte, die den Menschen anerzogen worden sind. Die Evolution hat aber Frauen und Männer so geschaffen, die sich in ganz bestimmten Eigenschaften unterscheiden mussten, um die Fortpflanzung und Erhaltung der Art auf die bestmögliche Weise zu garantieren. Dr. Georg Pfau ist Arzt und Sexualmediziner. Er ist Mitglied der „Deutschen Akademie für Sexualmedizin“ in Berlin sowie Vorstands- und Gründungsmitglied der „Österreichischen Akademie für Sexualmedizin“ in Salzburg.
Karlheinz A. Geißler kritisiert die Fortschrittsgläubigkeit
Seit seinem Auftauchen vor rund 250 Jahren treibt der Fortschritt die Menschen mit dem Slogan „Vorwärts immer – rückwärts nimmer“ an. Karlheinz A. Geißler glaubt, dass er dies auch in Zukunft tun wird, da er keine Spur von Ermüdungserscheinungen an ihm erkennen kann, selbst wenn der Glaube an die Einlösung seiner Versprechungen in letzter Zeit abgenommen hat. Damit es mit dem Fortschritt weiter und immer weiter geht, dafür sorgen vor allem der Kapitalismus und jene Personen, Gruppen und Institutionen, die von ihm profitieren. Karlheinz A. Geißler nennt sie beim Namen: „Dazu zählen an erster Stelle Techniker, Ingenieure, Architekten, Mediziner, Politiker, aber auch Lehrer und Lehrerinnen, Berater und Beraterinnen sind dabei.“ Professor Dr. Karlheinz A. Geißler lehrt, lebt und schreibt in München. Eine der amüsantesten Erfindungen der Menschheit, die Zeit, hat er zu seinem Lebensthema gemacht.
Die Hersteller von Konsumgütern erzeugen Abhängigkeiten
Eines der großen Anliegen von Wolfgang Schmidbauer ist es, Gefühle von Selbstverantwortung und Eigenmacht der Menschen gegen den erodierenden Einfluss des Konsumismus zu stärken. Er weist darauf hin, dass die Propheten des Konsums ihre Ware neutral nennen, wobei es lediglich darauf ankomme, was der verantwortliche Mensch mit ihr mache. Aber das ausgewogene Verhältnis zur Umwelt ermöglicht laut Wolfgang Schmidbauer nur Werkzeuge, die die menschlichen Fähigkeiten vergrößern und nicht vorgaukeln, es gäbe einen Gewinn an Macht ohne Kosten. Wolfgang Schmidbauer schreibt: „In der Konsumgesellschaft wird Technik systematisch benutzt, um die menschliche Neigung zur Regression auszubeuten. Kommerziell sehr erfolgreiche Waren beruhen darauf, dass nicht ein Kunde ein Produkt in Besitz nimmt, sondern dieses ihn.“ Wolfgang Schmidbauer arbeitet neben seiner schriftstellerischen Tätigkeit auch als Lehranalytiker und Paartherapeut in München.
Karlheinz A. Geißler singt ein schönes Loblied auf den Sonntag
Karlheinz A. Geißler behauptet: „Eile macht unsozial, unbarmherzig und hart.“ Mit dem Zeitdruck sinkt die Bereitschaft zu fürsorglichem, prosozialem Verhalten. Eilende, gestresste und gehetzte Menschen zeigen weniger Hilfsbereitschaft als diejenigen, die sich nicht unter Zeitdruck fühlen. Dass Barmherzigkeit eine Sache des menschlichen Charakters ist, war bekannt, dass sie daneben aber auch eine Sache des Zeitdrucks ist, macht Karlheinz A. Geißler nachdenklich. Mit Recht sind die Europäer stolz darauf, was sie im Hinblick auf die Zivilisierung und Kultivierung bisher erreicht haben. Karlheinz A. Geißler stellt sich allerdings die Frage, was aus der Humanität, dem Sinn für Mitmenschlichkeit, Hilfsbereitschaft und Nächstenliebe werden soll, wenn die Menschen immer mehr unter Zeitdruck geraten, kontinuierlich schneller werden und dazu noch alles tun, um mit noch mehr Geschwindigkeit durchs Leben zu rasen. Professor Dr. Karlheinz A. Geißler lehrt, lebt und schreibt in München. Eine der amüsantesten Erfindungen der Menschheit, die Zeit, hat er zu seinem Lebensthema gemacht.
Überall fallen die Grenzen und entwickeln sich neue Welten
Die Grenzen von Raum und Zeit sind in modernen Gesellschaften in Bewegung geraten. Ihr einstmals starres Regime steht laut Karlheinz A. Geißler zur Disposition. Beratung kann zum Beispiel heutzutage überall stattfinden, nicht nur allein in den dafür vorgesehenen Konferenzräumen. In der Europäischen Union lassen sich die Grenzen ohne Zwischenstopp überwinden. Karlheinz A. Geißler schreibt: „Weitestgehend entortet und entzeitlicht ist das, was man kauft, was man isst und trinkt, und vieles von dem, was es zu erfahren und zu erleben gibt.“ Dinge, die an Ort und Zeit gebunden sind, entwickeln sich als Reaktion auf diesen Trend immer öfter zur Folklore. Professor Dr. Karlheinz A. Geißler lehrt, lebt und schreibt in München. Eine der amüsantesten Erfindungen der Menschheit, die Zeit, hat er zu seinem Lebensthema gemacht.
Für Kinder hat die Zeit etwas Magisches und Spielerisches an sich
Den Begriff der Zeit definiert der deutsche Philosoph Hans Blumenberg wie folgt: „Zeit ist das am meisten Unsrige und doch am wenigsten Verfügbare.“ Der Mensch erfährt die Zeit stets qualitativ, aber er vermag dem Zeitlichen auch selbst Qualitäten zu verleihen. Für Karlheinz A. Geißler ist er deshalb nicht nur Opfer, sondern auch Täter des Zeitlichen. Der Mensch erfährt sich im Netzwerk der Zeit, er ist dabei zugleich Schauspieler und Zuschauer in einem Stück, dass er selbst geschrieben hat und immer weiter fortschreibt. Karlheinz A. Geißler zitiert in diesem Zusammenhang den argentinischen Schriftsteller Luis Borges: „Die Zeit ist ein Strom, der dich mitreißt, aber du bist der Strom; sie ist ein Tiger, der dich zerfleischt, aber du bist der Tiger; sie ist ein Feuer, das dich verzehrt, aber du bis das Feuer.“ Professor Dr. Karlheinz A. Geißler lehrt, lebt und schreibt in München. Eine der amüsantesten Erfindungen der Menschheit, die Zeit, hat er zu seinem Lebensthema gemacht.
Im Traumschlaf denkt das Gehirn besonders heftig nach
Durch Schlafentzug wird ein Mensch nicht unbedingt psychotisch, wie das manchmal behauptet wird, aber irgendwann so müde, dass er buchstäblich im Stehen einschläft beziehungsweise einfach nicht mehr wach bleiben kann. Die Schlafforschung hat laut Manfred Spitzer herausgefunden, dass Schlaf ein vom Gehirn aktiv herbeigeführter Zustand ist, der zwar das menschliche Erleben aber keineswegs das Gehirn passiv überfällt und noch dazu nicht mit einer Verminderung der Gehirnaktivität einhergeht. Manfred Spitzer ergänzt: „Unser Gehirn ruht sich nicht aus, schon gar nicht im Schlaf.“ Der menschliche Körper käme vielleicht ohne Schlaf aus, das Gehirn nicht. Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer leitet die Psychiatrische Universitätsklinik in Ulm und das Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen. Zu seinen bekanntesten Büchern zählen „Lernen“ und „Vorsicht Bildschirm!“.
Glücksforscherin Sonia Laszlo: „Glück ist kein Dauerzustand“
Das Glück hat sich in der Gegenwart zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor entwickelt. Mit Coaching, Therapien und Büchern werden große Gewinne erzielt. Für diesen Boom sind laut Glücksforscherin Sonia Laszlo mehrere Faktoren verantwortlich. Zum einen ist die Welt ihrer Meinung nach kleiner geworden. Sie erklärt: „Früher haben wir uns nicht mit der gesamten Welt verglichen, heute vergleichen wir uns mit Weltbestwerten.“ Den Menschen wird von vielen Seiten her eingeredet, dass sie für alles selbst verantwortlich sind und alles veränderbar ist. Ratgeber versprechen eine schnelle Lösung aller Probleme. Die Leute glauben, dass diese Bücher ihnen helfen, weil sie möchten, dass es ihnen so geht, wie sie denken, dass es ihnen zusteht. Sonia Laszlo ist Kommunikationswissenschaftlerin und referiert an der Universität Wien zur Anthropologie des Glücks.
Elektronische Medien wirken sich negativ auf das Denken aus
Wenn ein Mensch sein Gehirn nicht gebraucht, dann entstehen dort auch keine Spuren, das heißt, es wird nichts gelernt. Manfred Spitzer weist auf eine Studie von Wissenschaftlern der Harvard University im Fachblatt Science hin, die den Nachweis erbrachten, wie ungünstig sich elektronische Medien auf das menschliche Denken und Gedächtnis auswirken. Die amerikanischen Autoren kommen zu dem Schluss, dass die Menschen dahingehend programmiert sind, sich dem Computer zuzuwenden, wenn sie mit Wissenslücken konfrontiert werden. Zudem fanden die Forscher heraus, dass Versuchspersonen, die davon ausgingen, dass der Computer bestimmte Aussagen gleich wieder löschen wurde, sich am meisten von diesen merken konnten, während andere, die glaubten, der Computer würde die Aussagen speichern, sich vergleichsweise viel weniger merkten. Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer leitet die Psychiatrische Universitätsklinik in Ulm und das Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen. Zu seinen bekanntesten Büchern zählen „Lernen“ und „Vorsicht Bildschirm!“.
Manfred Spitzer stellt das umstrittene Phänomen Multitasking vor
Eine amerikanische Studie hat herausgefunden, dass der moderne Mensch seine Arbeit im Durchschnitt alle elf Minuten unterbricht. Das Leben im sogenannten digitalen Zeitalter zeichnet sich laut Manfred Spitzer dadurch aus, dass man ständig alles Mögliche gleichzeitig tut. Er schreibt: „Wir recherchieren am Computer, hören Musik, schreiben Kurznachrichten auf dem Mobiltelefon und lesen eigentlich gerade einen Artikel in der Zeitung. Der Fernseher läuft im Hintergrund, und dann klingelt das Festnetztelefon.“ Für das gleichzeitige Erledigen vieler Aufgaben hat sich der neudeutsche Begriff Multitasking durchgesetzt. Viele Jugendliche langweilen sich, wenn nicht alles gleichzeitig geschieht. Denn alles enthält Pausen. Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer leitet die Psychiatrische Universitätsklinik in Ulm und das Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen. Zu seinen bekanntesten Büchern zählen „Lernen“ und „Vorsicht Bildschirm!“.
Facebook und andere soziale Netzwerke erhalten Freundschaften
Noch vor rund einem Jahrzehnt gaben in der Wissenschaft warnende Stimmen den Ton an, die ganz im Sinne des Harvard-Politologen Robert Putnam vermuteten, neue Medien und Technologien würden zur Vereinzelung und nachlassendem Engagement für gesellschaftliche Belange führen. Der britische Philosoph Roger Scruton glaubte damals, dass sich etwas im Menschen verändere, wenn er Beziehungen nur noch über den Bildschirm aufrecht erhalte. Er schrieb im Magazin „The New Atlantik“: „Wenn man Freunde wie ein YouTube-Video anklickt, erfasst man all die feinen verbalen und körperlichen Signale eines Menschen nicht mehr. Das Gesicht des anderen ist ein Spiegel, in dem man sich selber sieht.“ Roger Scruton ging von der Annahme aus, dass in sozialen Netzwerken virtuelle Freunde die realen Freunde einfach ersetzen würden. Das ist aber laut heutigem Stand der Wissenschaft so nicht der Fall.
Beim Lernen kommt es auf die Tiefe der Verarbeitung an
Seit mehr als vier Jahrzehnten erforschen Lern- und Gedächtnispsychologen die Tiefe der Verarbeitung eines Sachverhalts. Je tiefer dieser im Gehirn verarbeitet wird, desto besser wird er im Gedächtnis gespeichert. Manfred Spitzer erklärt, dass die Forscher lange Zeit annahmen, dass es beim Lernen darauf ankomme, Inhalte in sogenannte Speicher zu füllen. Die Wissenschaftler unterschieden Ultrakurzzeitspeicher, Kurzzeitspeicher und Langzeitspeicher. Zum Untersuchungsgegenstand gehörte auf die Frage, wie man Sachverhalte vom Kurzeitspeicher in den Langzeitspeicher übertragen kann. Daneben gibt es laut Manfred Spitzer aber noch eine ganz andere Art, sich über das Gedächtnis Gedanken zu machen. Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer leitet die Psychiatrische Universitätsklinik in Ulm und das Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen. Zu seinen bekanntesten Büchern zählen „Lernen“ und „Vorsicht Bildschirm!“.
Im menschlichen Gehirn wachsen neue Nervenzellen nach
Über lange Zeit waren die Neurowissenschaftler der festen Überzeugung, dass die Nervenzellen eines Menschen bereits bei der Geburt voll ausgebildet sind. Sie vertraten die These, dass danach keine Nervenzellen mehr gebildet, aber jeden Tag welche absterben würden. Manfred Spitzer schreibt allerdings in seinem Buch „Digitale Demenz“, dass es keinen wissenschaftlichen Beweis dafür gibt, die die im Volksmund weit verbreitete Auffassung stützt, täglich stürben etwa 10.000 Nervenzellen ab. Auch wenn diese Vermutung zutrifft, hat ein Mensch im Alter von 70 Jahren nur 1,3 Prozent seiner Nervenzellen verloren. Eine beruhigende Berechnung. Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer leitet die Psychiatrische Universitätsklinik in Ulm und das Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen. Zu seinen bekanntesten Büchern zählen „Lernen“ und „Vorsicht Bildschirm!“.
Markus Hengstschläger stellt verschiedene Talentkategorien vor
Eine vor allem in Amerika weit verbreitete Kategorisierung von Talent und Begabung ist laut Markus Hengstschläger die sogenannte „Marland-Definition“. Sie wurde von einer Regierungskommission im Jahr 1971 unter der Leitung von P. Marland entwickelt. Das amerikanische Erziehungsministerium hatte damals das Ziel, bundesstaatliche Erziehungsprogramme für Hochbegabte zu Entwicklung zur Verfügung zu stellen. Talentiert, so die Marland-Definition kann jemand sein in seinen allgemeinen intellektuellen Fähigkeiten, in seiner spezifischen akademischen, schulischen Eignung, in seiner Kreativität und produktivem Denken, in den bildnerischen und darstellenden Künsten sowie in seinen psychomotorischen Befähigungen. Wobei es für Markus Hengstschläger wichtig ist, zu sagen, dass die Wissenschaft zusätzlich noch zwei grundlegend verschiedene Ansätze bei der personalen Zuordnung von Talenten kennt. Mit 16 Jahren war Markus Hengstschläger als Punk unterwegs. Mit 24 Jahren promovierte er zum Doktor der Genetik und 35-jährig zum jüngsten Universitätsprofessor für Medizinische Genetik berufen.