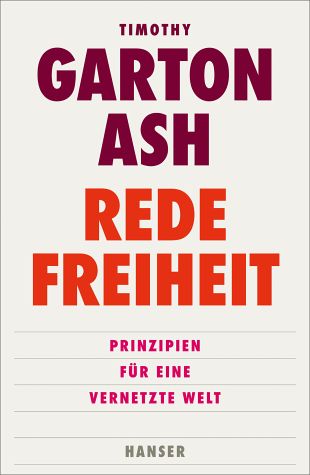Die Geschichte der Postmoderne gibt es nicht. Eine Geschichte der Postmoderne, sicherlich die bekannteste, ist verbunden mit Michel Foucault und Jacques Derrida, den beiden großen Philosophen der französischen Philosophie der 1960 und 1979er Jahre. Sie ist auch verknüpft mit Jean-François Lyotard, der 1979 „Das postmoderne Wissen“ geschrieben hat und mit Richard Rorty, der den Begriff „Postmoderne“ oder „postmodern“ zu verschiedenen Gelegenheiten diskutiert hat. Daniel-Pascal Zorn fügt hinzu: „Aber die Fragen, die diese Philosophen stellen, finden nicht im luftleeren Raum statt. Sie sind ihrerseits eingebettet in einen historischen und theoretischen Kontext, der weiter zurückreicht, bis zu den Anfängen der bürgerlichen Gesellschaft im 19. Jahrhundert. Daniel-Pascal Zorn studierte Philosophie, Geschichte und Komparatistik. Seit 2021 ist er Geschäftsführer des Zentrums für Prinzipienforschung an der Bergischen Universität Wuppertal.
Michel Foucault
Terror und Gewalt führen zu keiner stabilen Macht
Gewalt und Macht lassen sich mit Hannah Arendt dadurch unterscheiden, dass Erstere prozessual, dynamisch und zeitlich begrenzt ist. Letztere stellt dagegen eine strukturelle Größe dar, die dauerhaft, und, was fast dasselbe ist, institutionalisiert ist. Gewalt ist ein Komplement von Macht, insofern sie, wie Michel Foucault dargelegt hat, auf einem System von möglichen psychischen und/oder physischen Bestrafungen basiert, die gleichsam den symbolischen Horizont aller Macht bildet. Wolfgang Müller Funk ergänzt: „Das, was als politischer Körper bezeichnet wird, wäre gewissermaßen der Foucaultsche Aspekt des Zusammenhangs von Macht und Gewalt. Jenseits der Befunde des französischen Denkers besteht der Verdacht, dass keine Macht, die allein auf Terror und Gewalt beruht, dauerhaft stabil ist. Wolfgang Müller-Funk war Professor für Kulturwissenschaften in Wien und Birmingham und u.a. Fellow an der New School for Social Research in New York und am IWM in Wien.
Macht kann aktiv oder passiv wirken
Es gibt die sehr eingängige Vorstellung, dass soziale Macht eine Fähigkeit ist, die Menschen als soziale Akteure haben, um den Verlauf der Dinge in der Gesellschaft zu beeinflussen. Miranda Fricker hält zunächst einmal fest, dass Macht aktiv oder passiv wirken kann: „Zwischen aktiver und passiver Macht besteht ein Abhängigkeitsverhältnis. Denn die passive Macht schwindet im gleichen Maße, in dem die aktive Macht schwindet.“ Ein zweiter Punkt ist folgender: Macht ist eine Fähigkeit, die auch in jenen Zeiten Bestand hat, in denen sie nicht ausgeübt wird. Michel Foucault behauptet bekanntlich: „Macht existiert nur in actu.“ Miranda Fricker ist Professorin für Philosophie an der New York University, Co-Direktorin des New York Institute für Philosophy und Honorarprofessorin an der University of Sheffield.
Das Erbe der Postmoderne ist so reich wie unverstanden
Daniel-Pascal Zorn vertritt in seinem neuen Buch „Die Krise des Absoluten“, dass das Erbe der Postmoderne so reich wie unverstanden ist. Ihre eindringliche Botschaft lautet: Wenn die Welt einseitig zu werden droht, muss man die Vielfalt verteidigen. Der Autor erzählt auf seiner Expedition durch die Geschichte der Postmoderne vom Ringen mit dem Absoluten und von der Entstehung der aktuellen Moderne. Er entfaltet dabei ein Panorama des verlorenen Denkens, das die Menschheit gerade jetzt am nötigsten hätte. Die Postmoderne, so wie sie Daniel-Pascal Zorn versteht, ist kein Sammelbegriff für irgendwelche durchgeknallten französischen Philosophen. Und sie ist auch kein Werturteil über den allgemeinen Sittenverfall. Daniel-Pascal Zorn studierte Philosophie, Geschichte und Komparatistik. Seit 2021 ist er Geschäftsführer des Zentrums für Prinzipienforschung an der Bergischen Universität Wuppertal.
Der Kampf um die Wortmacht hat begonnen
Ohne dass viele Menschen es überhaupt bemerken, stecken sie mitten in einem großen Kampf. Dabei geht es um die Form, die Bedingungen und die Grenzen der globalen Redefreiheit. Sowohl in den Smartphones in ihren Taschen und vielleicht auch in ihren Köpfen. Timothy Garton Ash nennt dieses Ringen den Kampf um die Wortmacht. Wie das Wort „Rede“ in „Redefreiheit“ schließt der Begriff „Wort“ in „Wortmacht“ offensichtlich viel mehr mit ein als nur Worte. Timothy Garton Ash erklärt: „Er umfasst auch Bilder, Töne, Symbole, Informationen und Wissen sowie Kommunikationsstrukturen und Kommunikationsnetze.“ Der spanische Soziologe Manuel Castells spricht von der „Kommunikationsmacht“. Aber Timothy Garton Ash ist das kurze Wort lieber als das lange, besonders weil ohnehin jede Bezeichnung nur einen Teil des Ganzen erfasst. Timothy Garton Ash ist Professor für Europäische Studien an der Universität Oxford und Senior Fellow an der Hoover Institution der Stanford University.
Die Schönheit schafft sich begehbare Träume
Mitte der 1960er-Jahre prägte der französische Philosoph Michel Foucault in einem Radiovortrag einen Begriff, der für die Schönheit eine entscheidende Bedeutung hat: die „Heterotopie“. Die Gesellschaft schaffe sich, zu allen Zeiten und in allen Kulturen, abgegrenzte Orte, in denen Utopien real werden. Frank Berzbach ergänzt: „Utopien sind von der Gegenwart losgelöste, ausgedachte Provinzen. Diese liegen oft in der Zukunft und sie sind Ausdruck von Wünschen. Aber Heterotopien sind die daraus hervorgehenden realen Räume.“ Die Menschen sind nicht geduldig und warten auf die Rückkehr ins Paradies oder eine bessere Zukunft. Daher schafft sich die Schönheit reale Orte; begehbare Träume von Räumen. Dr. Frank Berzbach unterrichtet Psychologie an der ecosign Akademie für Gestaltung und Kulturpädagogik an der Technischen Hochschule Köln.
Die Hoffnung ist eine Kraftspenderin in der Not
Das Titelthema des neuen Philosophie Magazins 05/2021 handelt von der Hoffnung. Chefredakteurin Svenja Flaßpöhler schreibt im Editorial: „Keine Revolution, keine Fridays for Future, keine Zukunft gäbe es ohne den festen Glauben an das Gelingen. Die Hoffnung muss sich von der Angst lösen, um Kraft zu entwickeln.“ Positive Erwartungen sind allerdings auch risikobehaftet. Was, wenn das Erhoffte nicht eintritt? Gar alles noch schlimmer kommt? Andererseits gilt: Wenn die Furcht jede Hoffnung im Keim erstickt, gäbe es kein lebenswertes Morgen mehr. Es besteht für viele Menschen kein Zweifel daran, dass die Hoffnung eine Energiequelle ist, eine Kraftspenderin in der Not. Die antiken Stoiker sahen weder in der Hoffnung noch in der Furcht den Weg zu einem gelingenden Leben. Vielmehr rieten sie ab von jeder affektiven Zukunftserwartung und forderten eine vernunftgeleitete Konzentration auf das Hier und Jetzt.
Der Begriff Macht ist sehr schwer zu fassen
Macht ist das Thema der Geschichtsschreibung, dem man fast überall begegnet, das aber zugleich am schwersten zu fassen ist. Christopher Clark erläutert: „Machtfragen stehen im Zentrum der meisten historischen Narrative. Doch der Begriff selbst wird selten hinterfragt oder analysiert.“ Das Wesen der Macht ist begrifflich so weitreichend und unergründlich aufgebläht, dass man instinktiv dazu neigt, das Wort im Plural zu gebrauchen. „Macht“ ist keine Eigenart, die man Gruppen oder Einzelpersonen zuschreiben kann. Vielmehr drückt sich darin eine Beziehung untereinander aus. Folglich ist Macht weder eine substantielle Entität, noch eine Institution. Michel Foucault lehnte es ab, den Begriff unter einer separaten Rubrik zu behandeln. Sondern er bettete seine Überlegungen in eine Analyse der spezifischen institutionellen und disziplinarischen Kontexte und Praktiken ein. Christopher Clark lehrt als Professor für Neuere Europäische Geschichte am St. Catharine`s College in Cambridge.
Judith Butler fordert radikale soziale Gleichheit
Wer sind wir und in welcher Welt wollen wir leben? Judith Butler gibt in ihrem neuen Buch „Die Macht der Gewaltlosigkeit“ folgende Antwort: „In einer Welt radikaler sozialer Gleichheit, die getragen ist von der Einsicht in die Abhängigkeiten und Verletzlichkeiten menschlicher Existenz.“ Diese Welt gilt es gemeinsam im politischen Feld zu erkämpfen – gewaltlos und mit aller Macht. In ihrer Einleitung weist Judith Butler darauf hin, dass Plädoyers für Gewaltlosigkeit im gesamten politischen Spektrum auf Kritik treffen. Ein zentrales Problem für die Verteidiger der Gewaltlosigkeit liegt ihrer Meinung darin, dass die Begriffe „Gewalt“ und „Gewaltlosigkeit“ umstritten sind. So sind zum Beispiel verletzende Äußerungen für die einen Akte der Gewalt. Während andere der Auffassung sind, dass Sprache nur im Fall expliziter Drohungen als „Gewalt“ im eigentlichen Sinne gelten kann. Judith Butler ist Maxine Elliot Professor für Komparatistik und kritische Theorie an der University of California, Berkeley.
Die Logik des Allgemeinen dominiert die Moderne
Was ist die Moderne? Was sind die zentralen Merkmale der modernen Gesellschaft in ihrer klassischen Gestalt? Aus der Sicht von Andreas Reckwitz ist die Antwort eindeutig: „Der strukturelle Kern der klassischen Moderne, wie sie sich seit dem 18. Jahrhundert zunächst in Westeuropa ausgebildet hat, ist zunächst eine soziale Logik des Allgemeinen. Diese drängt auf eine Standardisierung, Formalisierung und Generalisierung sämtlicher Einheiten des Sozialen.“ Die Moderne formatiert die Welt der bis dahin traditionellen Gesellschaften grundlegend um. Sie prägt ihr in ihren Praktiken, Diskursen und institutionellen Komplexen durchgängig und immer wieder aufs Neue Formen des Allgemeinen auf. Als großflächige Praxis betreibt sie ein, wie Andreas Reckwitz es nennen möchte, umfassendes „doing generality“ der Welt. Andreas Reckwitz ist Professor für Kultursoziologie an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt / Oder.
Die Sexualität wird als Praxis der Freiheit gelebt
In ihrem Buch „Sexualität. Eine sehr kurze Einführung“ fragt die Soziologin Véronique Mottier: „Wie kommt es, dass die Sexualität für unser Selbstverständnis derart zentral geworden ist?“ Eva Illouz glaubt, die Antwort auf diese Frage lautet im Kern: „Unsere Sexualität wird als der Wert und die Praxis der Freiheit gelebt. Einer Freiheit, die umso mächtiger und allgegenwärtiger ist, als sie an den unterschiedlichsten Schauplätzen institutionalisiert wurde.“ Wenn Eva Illouz von Freiheit im Allgemeinen und emotionaler beziehungsweise sexueller Freiheit im Besonderen spricht, bezieht sie sich nicht auf das glanzvolle moralische Ideal, das den Leitstern der demokratischen Revolutionen bildete. Eva Illouz ist Professorin für Soziologie an der Hebräischen Universität von Jerusalem sowie Studiendirektorin am Centre européen de sociologie et de science politique de la Sorbonne.
Die Philosophie dient der seelischen Gesundheit
Der französische Philosoph Michel Foucault hat sich in seinem Spätwerk ausführlich mit dem Begriff der Selbstsorge und der Frage beschäftigt, welche Bedeutung sie für das heutige moderne Leben haben kann. Seine erste Frage war, welche „Praktiken dazu taugen, „zwischen sich und sich selber ein gewisses Verhältnis“ herzuleiten. Anders gefragt: „Wie stellt man zu sich selbst eine adäquate und erschöpfende Beziehung her, indem man sich selbst zum Ziel macht. Ina Schmidt erläutert: „Sich zum Ziel machen, aber dieses Ziel nicht als letzte Antwort zu verstehen, darin liegt die große Aufgabe.“ Um diese Bewegung in Gang zu setzen beziehungsweise in Fluss zu halten, führt Michel Foucault verschiedene Praktiken und Prinzipien an, die er als zentral erachtet. Ina Schmidt gründete 2005 die „denkraeume“, eine Initiative, in der sie in Vorträgen, Workshops und Seminaren philosophische Themen und Begriffe für die heutige Lebenswelt verständlich macht.
Michel Foucault befreit das Denken
Die neue Sonderausgabe des Philosophie Magazins ist dem Philosophen Michel Foucault gewidmet. In ihrem Editorial beschreibt Chefredakteurin Catherine Newmark den französischen Denker und Intellektuellen als einen Menschen, der die Philosophie gerade nicht als ein Gespräch mit den komplizierten Gedanken weiser alter Männer betrieb, sondern als ein einziges großes Warum-Fragen: „Warum ist unsere Idee von Wahrheit so, wie sie ist, und nicht anders? Wie sind überhaupt unsere Kategorien des Wissens und der Weltwahrnehmung entstanden?“ Michel Foucault interessierte es überhaupt nicht, sich in ein bestehendes philosophisches Systemdenken mit einem weiteren Argument einzumischen. Ihm ging es ums große Ganze: „Wie kommt es, dass wir so denken, wie wir denken?“ Und ebenso: „Wie hat sich unser kompliziertes Verhältnis zu uns selbst und zu unserem Körper historisch entwickelt?“
Das Selbst ist einem ständigen Wandel unterworfen
Es ist das Akzeptieren von Vielfalt, von Zweideutigkeit, von verschiedenen möglichen Wegen, die einem Menschen die Augen für das Eigene öffnen. Dabei geht es auch um das Einräumen von Uneindeutigkeit und inneren und äußeren Grenzen, die man mitdenken muss – und zwar gerade dann, wenn man auf der Suche nach dem Wahren, dem Wahrhaftigen ist. Ina Schmidt weiß: „Es ist der Mut, den wir brauchen, einer solch zweideutigen Wahrheit gegenüberzutreten, eröffnet die Möglichkeit, sich wirklich selbst zu begegnen.“ Es geht also nicht darum, das eigene Wesen aufzudecken, sondern sich in einem werdenden Sein zurechtzufinden, einem Selbst, das aufmerksamer Betrachtung und Begleitung bedarf, um in allem Wandel immer wieder ein Selbst bleiben zu können. Ina Schmidt gründete 2005 die „denkraeume“, eine Initiative, in der sie in Vorträgen, Workshops und Seminaren philosophische Themen und Begriffe für die heutige Lebenswelt verständlich macht.
Ein Gemeinwesen braucht eine politische Herrschaft
Der Kernbestandteil eines jeden Gemeinwesens besteht in einem Recht, das sich wesentlich mit Zwangsbefugnis verbindet. Seinetwegen hat jedes Gemeinwesen einen Herrschaftscharakter, weshalb nicht die „geordnete Anarchie als philosophisches Leitbild des freiheitlichen Rechtsstaates“ behauptet werden kann. Otfried Höffe erklärt: „Weil angeblich jede Regierung Rechte von Individuen verletzt, taucht selbst gegen eine von den Betroffenen ausgeübte Herrschaft Skepsis auf.“ Es ist überraschend, dass ursprünglich, im Griechischen, die Herrschaftslosigkeit durchweg negativ bewertet wird. Auch in der politischen Neuzeit, etwa von Niccolò Machiavelli über Montesquieu bis Voltaire, herrscht die negative Einschätzung vor. Erst in Karl Marx` und Friedrich Engels` These vom Absterben des Staats, bei dem davon beeinflussten Herbert Marcuse, auch in der subversiven Institutionenkritik eines Michel Foucault und nicht zuletzt in antiautoritären Bewegungen lebt der Gedanke der Herrschaftsfreiheit auf. Otfried Höffe ist Professor für Philosophie und lehrte in Fribourg, Zürich und Tübingen, wo er die Forschungsstelle Politische Philosophie leitet.
Friedrich Nietzsche brachte den Sprengstoff in die Philosophie
Die neue Sonderausgabe des Philosophie Magazins ist dem großen deutschen Philosophen Friedrich Nietzsche gewidmet, der von sich selbst in „Ecce homo“ schrieb: „Ich bin kein Mensch, ich bin Dynamit.“ In dem Heft sind Auszüge seiner wichtigsten Texte versammelt, die von unter anderem von Sigmund Freud, Theodor W. Adorno, Michel Foucault und Rüdiger Safranski kommentiert werden. Rüdiger Safranski bezeichnet Friedrich Nietzsche als einen Künstler des Denkens. Das Denken, das soll nach seiner Vorstellung ein reiches, lebendiges Denken sein: „Nietzsche will gewissermaßen mit dem Denken selbst musizieren. Was dabei herauskommt, ist neben vielen blitzenden Gedanken ein unnachahmlicher Stil.“ Der Nietzsche-Sound ist bisweilen von einer überwältigenden Wucht und Schönheit. Friedrich Nietzsche übte furiose Kritik an der religiösen Sklavenmoral: „Der christliche Glaube ist von Anbeginn Opferung: Opferung aller Freiheit, alles Stolzes, aller Selbstgewissheit des Geistes; zugleich Verknechtung und Selbst-Verhöhnung, Selbst-Verstümmelung.“
Wissenschaftliche Sätze sollen verneint werden können
Aus der Einsicht heraus, dass alles Erkennen immer nur hypothetisch und vorläufig bleiben muss, hat insbesondere der Kritische Rationalismus zwei Regeln formuliert, die fast zu wissenschaftlichen Gemeinplätzen geworden sind. Wilhelm Berger erläutert: „Ihre Anwendung verspricht eine klare Grenzziehung zwischen der wissenschaftlichen Tätigkeit und ihren Konkurrenten bei der Deutung der Welt. Bis zu einem gewissen Grad können diese Regeln auch dazu dienen, alltägliche Diskussionen zu ordnen.“ Die erste Regel lautet, dass wissenschaftliche Sätze falsifizierbar sein sollen. Diese Regel reflektiert nicht nur das Faktum, dass vieles, was einmal als wahr gegolten hat, heute als falsch gelten muss. Die Regel ist darüber hinaus eine formale: Wissenschaftliche Sätze sollen eine Form haben, die es erlaubt, dass sie verneint werden können. Professor Wilhelm Berger lehrt am Institut für Technik- und Wissenschaftsforschung an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt.
Die Philosophie muss gesellschaftliche Probleme aufgreifen
Wie der französische Philosoph Michel Foucault, der von 1926 bis 1984 lebte, in seinem Text „Die Ordnung des Diskurses“ erklärt, folgt jeder wissenschaftliche und damit auch philosophische Diskurs bestimmten Ordnungen, die festlegen was jeweils gesagt werden kann. Das betrifft sowohl das Innere der Diskurse als auch ihr Verhältnis nach außen, also die Art und Weise, in der sie auf ihren historischen, politischen und gesellschaftlichen Kontext Bezug nehmen und in ihm wirken. Ebenso ist die Position für das Philosophieren nicht gleichgültig, wie sie beispielsweise von der feministischen Standortphilosophie vertreten wird. Wilhelm Berger nennt als Beispiel die Philosophin Sandra Harding, die aus einer Theorie der sozialen Saturiertheit eine Kritik des Objektivitätsanspruchs patriarchaler Wissenschaft entwickelt. Professor Wilhelm Berger lehrt am Institut für Technik- und Wissenschaftsforschung an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt.