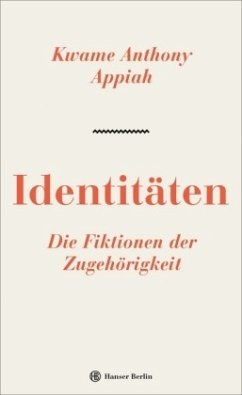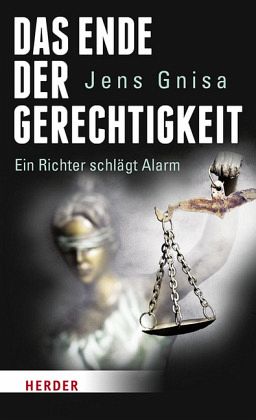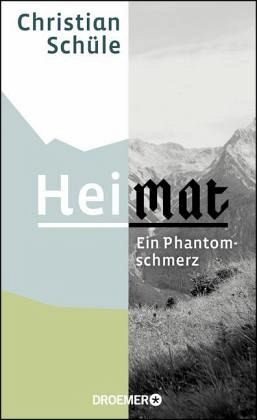Kwame Anthony Appiah zeigt in seinem neuen Buch „Identitäten“, dass hinter den Kategorien von Zugehörigkeit und Abgrenzung häufig paradoxe Zuschreibungen stehen. Das Selbstgefühl jedes Menschen wird von seiner Herkunft geprägt, angefangen bei der Familie, aber darüber hinaus auch von vielen anderen Dingen – von der Nationalität, die eine Person an einen Ort bindet; vom Geschlecht, dass einen jeweils mit der Hälfte der Menschheit verbindet; und von Kategorien wie Klasse, Sexualität, race und Religion, die über die lokalen persönlichen Bindungen hinausreichen. Kwame Anthony Appiah erörtert in seinem Buch einige der Ideen, die den modernen Aufstieg der Identität geprägt haben, und betrachtet einige Irrtümer genauer, die Menschen regelmäßig im Hinblick auf Identität begehen. Professor Kwame Anthony Appiah lehrt Philosophie und Jura an der New York University.
Nationalität
Das Grundgesetz sichert die Menschenwürde
Das gesamte Recht in Deutschland berücksichtigt die wichtigsten Grundwerte der Gesellschaft – Menschenwürde, Menschlichkeit und die Gleichheit aller. Jens Gnisa ergänzt: „Das Grundgesetz als oberstes Gesetz sichert das allen Bürgern zu. Jedes andere Gesetz hat diese Werte zu beachten, darüber wacht das Bundesverfassungsgericht.“ Auch die Behörden haben sie bei ihren Entscheidungen zu berücksichtigen, ebenfalls die Gerichte, wenn sie deshalb angerufen werden. Auf jeder dieser Stufen wird als die Menschenwürde streng beachtet. Den Vorstellungen des Rechts folgend, ist nach einer rechtskräftigen und abschließenden Entscheidung gar kein Platz mehr dafür, dass gesellschaftliche Gruppen diese Ergebnisse infrage stellen. Es ist gesetzt und soweit unantastbar. Dies gilt selbstverständlich auch im Ausländerrecht. Jens Gnisa ist Direktor des Amtsgerichts Bielefeld und seit 2016 Vorsitzender des Deutschen Richterbundes.
Deutschsein hat etwas mit Herkunft und Tradition zu tun
Deutschsein ist mehr als nur formelle Staatsbürgerschaft. Sogar Anhänger der Grünen sind offensichtlich mehrheitlich der Meinung, es gebe so etwas wie einen Nationalcharakter. Christian Schüle fügt hinzu: „Der Begriff Nationalcharakter hat als vermeintlich veraltetes Konzept keinesfalls ausgedient und wird mitnichten von der nachwachsenden Generation als überwunden erachtet.“ Drei Viertel der Deutschen finden, dass deutsche Kultur „Leitkultur“ für die in Deutschland lebenden Ausländer sein sollte; und gut die Hälfte der Deutschen meint, dass Deutschsein mit Herkunft und Tradition zu tun habe. Das heißt: Politik muss sich an der Wirklichkeit orientieren, und dazu gehört, dass mindestens eine relative Mehrheit der Bevölkerung ihre eigene Nationalität auch über eine in Jahrhunderten gewachsene Kulturtradition und eine gemeinsame Herkunft definiert. Seit dem Sommersemester 2015 lehrt Christian Schüle Kulturwissenschaft an der Universität der Künste in Berlin.