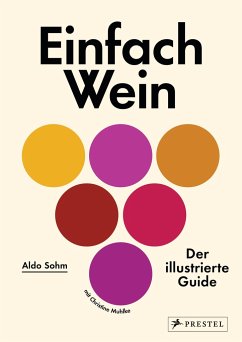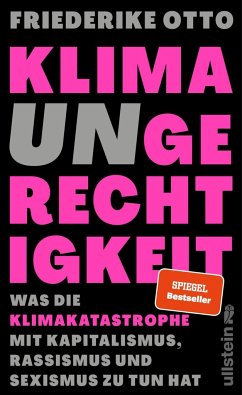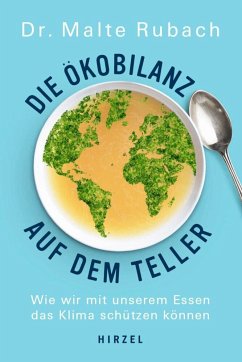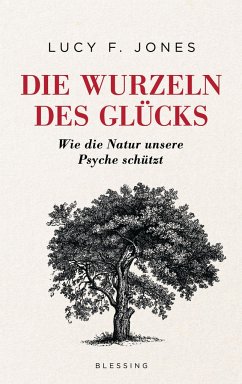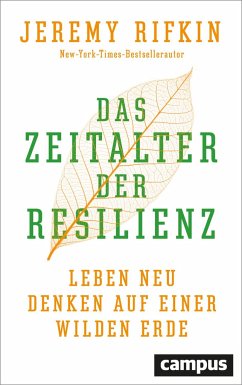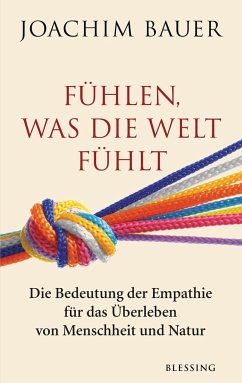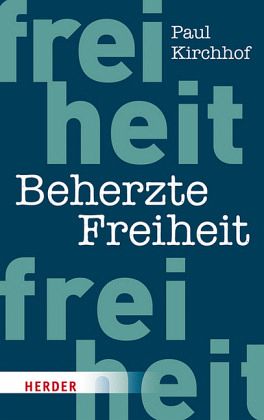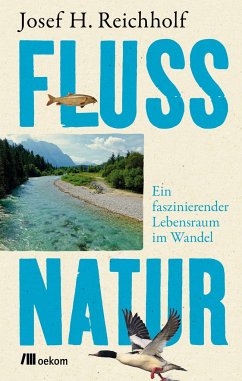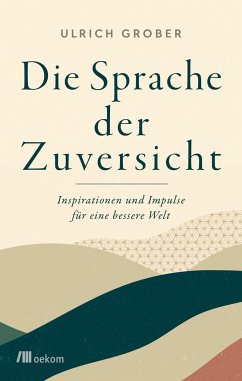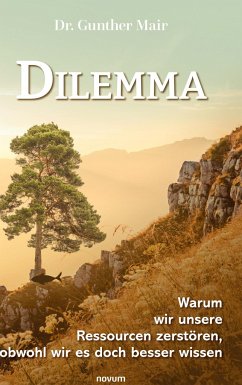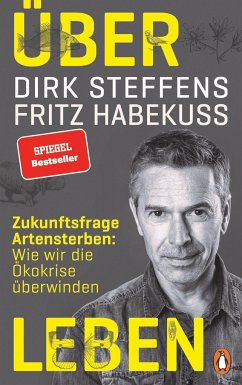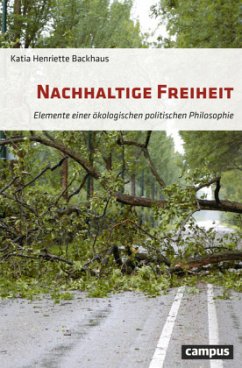Aldo Sohm vertritt folgende These: „In Argentinien und Chile findet eine Weinrevolution statt.“ Die traditionellen, vollmundigen Weine waren von den üppigen, von den Anden herausgewaschenen Böden in Kombination mit dem warmen Klima und kühlenden Höhenlagen geprägt. Französische Winzer, die auf der Suche nach bezahlbarem Land und ebensolchen Arbeitskräften waren, haben hier stark investiert. Südamerika hat auch den Vorteil wurzelechter, nicht gepfropfter Reben, denn die Reblaus Phylloxera, die im späten 19. Jahrhundert Rebflächen in ganz Europa vernichtet hat, kam nie bis nach Chile. Wie viele junge Weinnationen, die ihre Tradition zugunsten international beliebter Weine vernachlässigt haben, wurde die Balance neu ausgerichtet. Der Österreicher Aldo Sohm ist einer der renommiertesten Sommeliers der Welt, eine Legende seiner Branche. Christine Muhlke ist Redakteurin des Feinschmecker-Magazins „Bon Appétit“.
Umwelt
Mit 1,2 Grad Erwärmung ist die Erde heißer als jemals zuvor
Die globale Mitteltemperatur ist seit dem Beginn der industriellen Revolution um mehr als ein Grad gestiegen. Friederike Otto weiß: „Die Anfang 2023 herrschenden 1,2 Grad Celsius globaler Erwärmung mögen nicht nach viel klingen, aber das täuscht. Für einen Planeten – und vor allem seine Bewohner – ist es ein riesiger Unterschied, ob die durchschnittliche, über alle Land- und Wassermassen gemessene Temperatur bei 14 oder 15,2 Grad liegt.“ Ähnlich wie es auch für einen menschlichen Körper einen enormen Unterschied macht, ob die Körpertemperatur bei 37 oder 38,2 Grad liegt. Mit 1,2 Grad Erwärmung ist die Erde heute wärmer als jemals zuvor in der Geschichte der menschlichen Zivilisation – wärmer als jene Welt, die ein Mensch bisher gekannt hat. Friederike Otto forscht am Grantham Institute for Climate Chance zu Extremwetter und dessen Auswirkungen auf die Gesellschaft. Sie hat das neue Feld der Zuordnungswissenschaft – Attribution Science – mitentwickelt.
Zwei Drittel der Fische kommen aus Aquakulturen
Meeresfische muss man zwar auf Eis gekühlt transportieren und in den Handel bringen. Doch diese Mengen gefrorenes Wasser sind vernachlässigbar. Einen Unterschied macht dagegen die Aquakultur. Malte Rubach weiß: „Zwei Drittel des weltweiten Fischaufkommens werden laut Welternährungsorganisation inzwischen aus der Aquakultur gewonnen. 2011 war es noch nur etwas mehr als ein Drittel, der Anstieg ist also enorm.“ Doch man nutzt nur rund 60 Prozent des Fisches aus Aquakulturen und Ozeanen für den menschlichen Verzehr. Man produziert ihn wiederum gezielt als Futtermittel für andere Aquakultur-Fische. Dennoch ist die Aquakultur auch mit ihren derzeitigen Schwächen wie dem Einsatz von Antibiotika, Pestiziden und tierischen Futtermitteln wohl die einzige Antwort auf die Überfischung der Meere. Der Referent und Buchautor Dr. Malte Rubach hat Ernährungswissenschaften in Deutschland, der Türkei und den USA studiert.
Die Gegenwart ist von massenhaften Artensterben überschattet
Eine stärkere Verbindung zur Natur würde die Menschen glücklicher und gesünder machen – so weit, so gut. Doch da gibt es ein Problem. Was nützt es, Waldspaziergänge zu verschreiben, wenn weltweit Waldgebiete von Rodungen bedroht sind? Wie sollen die Menschen Zeit im Grünen verbringen, wenn es immer weniger Parks gibt? Wie baut man eine Beziehung zu jemandem auf, der todkrank ist? Lucy F. Jones kritisiert: „In der gesamten westlichen, industrialisierten Welt leben wir zunehmend abgekapselt von der Natur und ignorieren, wie sehr wie sie brauchen. Und damit geht die Katastrophe einher, dass die Natur vor unseren Augen verschwindet; unsere Zeit auf diesem Planeten wird von der gewaltsamen Zerstörung natürlicher Lebensräume und dem massenhaften Artensterben überschattet.“ Lucy F. Jones ist Journalistin und schreibt regelmäßig zu wissenschaftlichen Themen, Gesundheit, Umwelt und Natur für die BBC, The Guardian und The Sunday Times.
Die Nettoprimärproduktion erzeugt den gesamten Wohlstand
Bis heute findet der „wahre Wohlstand“, von dem sämtliche Lebensprozesse abhängig sind und ohne den das Wirtschaftssystem nicht existieren könnte, erstaunlich wenig Beachtung bei Wirtschaftswissenschaftlern und Unternehmern. Und genau hier beginnen die negativen externen Effekte. Jeremy Rifkin erklärt: „In der Nettoprimärproduktion – der Gesamtmenge des organischen Materials, das Lebewesen mittels Sonnenkraft herstellen – findet sich die Gesamtmenge des von der Vegetation aufgenommenen Kohlenstoffs minus des durch die Atmung wieder verlorenen Kohlenstoffs.“ Die Nettoprimärproduktion erzeugt den gesamten Wohlstand und ist die eigentliche Nahrungsquelle aller Lebensformen. Auch derjenigen, die in der Nahrungskette weiter oben stehen. Natürlich lebt auch der Homo sapiens seit seinen Anfängen vor rund 200.000 Jahren von dieser Nettoprimärproduktion. Jeremy Rifkin ist einer der bekanntesten gesellschaftlichen Vordenker. Er ist Gründer und Vorsitzender der Foundation on Economic Trends in Washington.
Pflanzenkost gilt als Heilsbringer schlechthin
Pflanzen sind im Narrativ der öffentlichen Diskussionen so etwas wie die Heilsbringer schlechthin. Egal ob für die Umwelt, die Gesundheit oder einfach nur für ein gutes Gewissen. Malte Rubach schränkt ein: „Das ist sicher eine schöne Botschaft, aber selbstverständlich gilt das nicht für alle pflanzlichen Lebensmittel und auch nicht überall auf der Welt.“ Paradoxerweise ist es so, dass ausgerechnet in Länder mit großer Nahrungsunsicherheit der durchschnittliche Wasserfußabdruck pro Kopf deutlich höher liegt als in Deutschland – 3900 Liter pro Kopf. Zum Beispiel liegt dieser im Niger bei 9600 Liter, in Mali bei 5600 Liter und im Chad sowie im Sudan bei über 4000 Liter. Der Referent und Buchautor Dr. Malte Rubach hat Ernährungswissenschaften in Deutschland, der Türkei und den USA studiert.
Die Natur ist eine gewaltige medizinische Ressource
Die Natur dient dem Menschen nicht nur als Lebensraum, sie ist auch eine gewaltige medizinische und soziale Ressource. Joachim Bauer erläutert: „Menschliche Gesundheit, gutes menschliches Zusammenleben und die Bewahrung der Natur stehen in einem Dreiecksverhältnis der Gegenseitigkeit.“ In der Natur zu sein und sie bewusst auf sich wirken zu lassen fördert die körperliche und psychische Gesundheit. Es fördert zudem die Bereitschaft, sich gegenüber Mitmenschen empathisch zu verhalten. Umgekehrt zeigen Menschen mit ausgeprägter Empathie ein höheres Interesse an Fragen des Umweltschutzes und eine stärker ausgeprägte Bereitschaft, sich in Umweltfragen zu engagieren. Joachim Bauer fordert, dass sich die Menschen wieder in eine echte Beziehung zur Natur setzen sollten. Damit ist gemeint, dass man die Natur nicht nur als Kulisse für diverse selbstgefällige oder ehrgeizige sportliche Auftritte benutzt. Prof. Dr. Med. Joachim Bauer ist Neurowissenschaftler, Psychotherapeut und Arzt.
Die Grüne Revolution sollte für mehr Nahrungsmittel sorgen
Vater der sogenannten Grünen Revolution war Norman Borlaug, der später mit dem Friedensnobelpreis geehrt wurde für seinen Beitrag zur Bekämpfung des Hungers in den Entwicklungsländern. Jeremy Rifkin fügt hinzu: „Am Ende jedoch führte dieser Beitrag zu ausgelaugten Böden, die so nährstoffarm sind, dass sie sich nicht ausreichend schnell regenerieren, um in vielen Regionen der Erde eine kritische Lebensmittelknappheit zu verhindern.“ Alles begann mit einem ehrgeizigen Plan, der die landwirtschaftliche Produktion in Indien, später Südostasien und schließlich Afrika und dem Rest der Entwicklungsländer dramatisch steigern und so das größer werdende Hungerproblem lösen sollte. Dieser Plan bestand aus mehreren komplementären Bausteinen, die gemeinsam einen großen Sprung in der landwirtschaftlichen Produktion bewirken sollten. Jeremy Rifkin ist einer der bekanntesten gesellschaftlichen Vordenker. Er ist Gründer und Vorsitzender der Foundation on Economic Trends in Washington.
Die USA sind die Weintrinkernation Nummer eins
Aldo Sohm und Christine Muhlke wissen: „In den letzten 20 Jahren haben die Amerikaner sehr großen Durst auf Weine aus der ganzen Welt bekommen und die USA zur Weintrinkernation Nr. 1 gemacht.“ Aber auch auf die eigenen Weine kann man hier stolz sein. Tatsächlich erzeugt man in allen 50 Bundesstaaten einschließlich Alaska Wein. In Amerika sind die Weingesetze weniger streng als in Europa und bieten Freiheiten für Experimente und Kreativität. Es gibt jedoch noch viele weitere Unterschiede zwischen Europa und den USA. Die Weingesetze sind in Europa hinsichtlich der erlaubten Sorten extrem streng und in den USA viel freizügiger, weshalb man dort heute viel mehr Rebsorten anbaut als noch vor 20 Jahren. Der Österreicher Aldo Sohm ist einer der renommiertesten Sommeliers der Welt, eine Legende seiner Branche. Christine Muhlke ist Redakteurin des Feinschmecker-Magazins „Bon Appétit“.
Die globale Landwirtschaft ist in Schieflage
Joachim Bauer reduziert die Ursachen der Fiebererkrankung der Erde auf zwei entscheidende Aspekte. Diese sind nicht nur in ihrer Bedeutung für das politische Handeln, sondern auch für das Alltagsverhalten jedes Einzelnen die wichtigsten. Beide Aspekte haben die größte ursächliche Bedeutung für die Krise des Planeten Erde und zielen auf den Kern des Problems. Joachim Bauer erläutert: „Der eine der beiden Aspekte betrifft die globale Entwicklung der Landwirtschaft, der andere die Verbrennung der fossilen Energieträger Kohle, Erdöl und Gas.“ Joachim Bauer beginnt dabei mit der Analyse des weltweiten landwirtschaftlichen Tuns. Er verdeutlicht, wie Ernährungsgewohnheiten, Verbrauch von landwirtschaftlichen Flächen und die gigantischen Waldrodungen mit dem Anstieg von Treibhausgasen zusammenhängen. Menschen können nicht nur durch politische Steuerung, sondern auch und gerade als Einzelne einen enormen Einfluss auf die Schieflage der globalen Landwirtschaft nehmen. Prof. Dr. Med. Joachim Bauer ist Neurowissenschaftler, Psychotherapeut und Arzt.
Der Mensch gewinnt die Herrschaft über die Natur
Paul Kirchhof stellt fest: „Was der Mensch aus eigener Kraft nicht kann, gelingt ihm durch die Herrschaft über die Natur.“ Er gewinnt sie, indem er die Gesetzmäßigkeiten der Natur für seine Ziele einsetzt. Er beherrscht auch andere Menschen, die Gesetzmäßigkeiten der Natur für ihre Zwecke nutzen wollen. Diese werden nun durch Gegenkräfte gehemmt. Je mehr der Mensch seine Fähigkeiten und Kenntnisse erweitert, desto mehr stimmt er sich mit anderen Menschen ab, die auf andere Weise die Natur beherrschen. Die Geschichte der Freiheit beginnt mit dem Kampf gegen die Naturgewalten. Aus diesen löst sich der Mensch nach und nach. Er gewinnt Herrschaft über Teile der Natur. Dr. jur. Paul Kirchhof ist Seniorprofessor distinctus für Staats- und Steuerrecht an der Universität Heidelberg.
Jeder Mensch kann der Natur wertvolle Dienste erweisen
Joachim Bauer betont: „Jeder einzelne Mensch kann der Natur – und damit zugleich seiner eigenen psychischen und körperlichen Gesundheit – wertvolle Dienste erweisen: die Ernährung umstellen, das Mobilitätsverhalten ändern und Müll vermeiden.“ Die Dringlichkeit der Ernährungsumstellung ergibt sich aus der rasend voranschreitenden Vernichtung der großen Wälder dieser Erde. Diese hat ihren Hauptgrund in der Erschließung landwirtschaftlicher Flächen zum Zwecke der Fleischproduktion. Was jeder einzelne Mensch hier, jetzt und sofort tun kann und tun sollte, ist der hedonische – also der nicht in Leidenspose, sondern aus Überzeugung und Liebe zur Natur vorgenommene – komplette Verzicht auf Fleisch. Ein weiterer guter Dienst an der Umwelt besteht darin, soweit als möglich Flugreisen zu reduzieren und vom Kraftfahrzeug auf öffentliche Verkehrsmittel und das Fahrrad umzusteigen. Prof. Dr. Med. Joachim Bauer ist Neurowissenschaftler, Psychotherapeut und Arzt.
Das ökologische System verändert sich ständig
Die gängige Vorstellung vom Gleichgewicht in der Natur würde bestens mit dem mesotrophen Zustand übereinstimmen. Josef H. Reichholf erklärt: „Produktion und Nutzung wären dann ausgeglichen. Und dies auf hohem Niveau, das eine optimale Nutzung von Ressourcen zulässt. Von allem wäre genug im Kreislauf, aber von nichts zu viel.“ Nirgendwo blieben unverwertete Überschüsse zurück. Fast zu schön, um wahr zu sein. Diese Befürchtung ist vollauf berechtigt. Denn tatsächlich ist der mesotrophe Zustand nicht stabil. Er ist ein Durchgangszustand, in dem das Gewässer – oder das ökologische System, ganz allgemein ausgedrückt – nicht von selbst verweilt, sondern sich rasch entweder in die eine oder in die andere Richtung weiter verändert. Josef H. Reichholf lehrte an der Technischen Universität München 30 Jahre lang Gewässerökologie und Naturschutz.
Weltweit gibt es sechs Prozent Vegetarier
Der Frage, warum und ob man überhaupt andere Tiere essen sollte, kann man sich aus ethischer und naturwissenschaftlicher Sicht nähern. Malte Rubach stellt fest: „Zum jetzigen Stand ist nahezu die gesamte Menschheit in der Lage, andere Tiere zu essen und diese Tatsache besteht schon seit Jahrmillionen.“ Der Anteil der Menschheit, der aus ethischen Gründen dazu nicht in der Lage ist, die vegan lebenden Menschen, beläuft sich weltweit im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Den Anteil der Vegetarier, die nur keine Tiere töten, aber von lebendigen Tieren stammende Lebensmittel genießen wollen, schätzt die Marktforschungsagentur Euromonitor auf weltweit sechs Prozent. In Propagandafilmen des Veganismus wie „The Game Changers“ wird es so dargestellt, als wäre der Mensch als Pflanzenfresser geboren. Der Referent und Buchautor Dr. Malte Rubach hat Ernährungswissenschaften in Deutschland, der Türkei und den USA studiert.
A hot planet is not cool
Auf den Pappschildern der Fridays-for-Future-Bewegung ist ein Bild stark vertreten: die handgemalte runde Erde. So bebildern sie ihre Parolen „no planet B“ oder „a hot planet is not cool“ und das überwölbende „save the planet“. Ulrich Grober ergänzt: „Allgegenwärtig in den Medien, besonders im Netz, ist das entsprechende Foto. Das Bild des Planeten aus einer Außenperspektive erscheint uns ganz natürlich, selbstverständlich.“ Dabei ist es noch gar nicht so alt. Ikone Erde und die Saga vom blauen Planeten, das meistpublizierte Foto der Mediengeschichte und eine große Erzählung in wenigen Worten, sind vielleicht das Beste, was das 20. Jahrhundert der Menschheit hinterlassen hat. Ein paar kalifornische Hippies kamen zuerst auf die Idee: Zeigt uns „whole earth“, die ganze Erde, so wie sie aus dem All zu sehen ist. Den Publizisten und Buchautor Ulrich Grober beschäftigt die Verknüpfung von kulturellem Erbe und Zukunftsvisionen.
Der Klimawandel ist präsenter denn je
Aus den Nachrichten: In Australien verbrennen 110.000 Quadratkilometer Wald, das entspricht einem Drittel der Fläche von Deutschland. Dabei sterben 34 Menschen und etwa eine Milliarde Säugetiere, Vögel und Reptilien. Eine Heuschreckenplage überfällt Afrika. Äthiopien, Eritrea, Kenia, Somalia und Uganda sind betroffen, die Heuschreckenschwärme erreichen Iran und Pakistan. Gunther Mair fügt hinzu: „Überschwemmungen in Indien und China fordern über 2.000 Menschenleben, zwei Millionen Menschen werden obdachlos und über 30 Millionen sind betroffen.“ Die Liste ließe sich beliebig fortführen. Diese Katastrophenereignisse sind nicht Teil eines Science-Fiction-Klimathrillers, sondern passierten alle allein im Jahr 2020. Ihre Kosten wurden konservativ auf über 100 Milliarden US-Dollar. Betrifft der Klimawandel auch die Europäer? Die Antwort ist natürlich ein klares Ja. Dr. Gunther Mair arbeitete als promovierter Chemiker in der chemischen Großindustrie und entdeckte dort sein Interesse für die Klimagasproblematik.
Das erste Leben entsteht tief im Ozean
Am Anfang war das Nichts. Kein Leben. Vor rund 4,5 Milliarden Jahren tobten ununterbrochen Feuerstürme und den Globus. Vulkane speien Asche und Lava in die Luft, alles kocht und brodelt und brennt. Würde man die Lebensgeschichte der Erde in einem Tag erzählen, von Mitternacht bis Mitternacht, ginge das bis vier Uhr morgens. Dirk Steffens und Fritz Habekuss stellen fest: „Dann entsteht das erste Leben, die tief im Ozean an Schloten leben, aus denen heißes Wasser schießt, in dem einfache Moleküle herumtreiben.“ Dann passiert nichts mehr. Sehr lange nicht. In ihrem Buch „Über Leben“ erzählen der Moderator der Dokumentationsreihe „Terra X“ Dirk Steffens und Fritz Habekuss, der als Redakteur bei der „ZEIT“ arbeitet, von der Vielfalt der Natur und der Schönheit der Erde.
In Deutschland gibt es nicht nur exzellenten Riesling
Aldo Sohm liebt trockenen Riesling mit seiner fokussierten, mineralischen, herzhaften Komplexität. Er wundert sich aber, warum nicht mehr Weintrinker den halbtrockenen Riesling-Kabinett zu schätzen wissen. Aldo Sohm und Christine Muhlke wissen: „Sie sind fantastisch als Speisenbegleiter für thailändische und koreanische Küche und Sushi, sie altern hervorragend, sind aber nie extrem teuer.“ Süßere Spätlesen und Auslesen sind etwas aus der Mode gekommen. Deswegen kauft Aldo Sohm diese vermehrt aus 70er- und 80er-Jahrgängen. Sie werden mit dem Alter trockener und gewinnen eine magische Komplexität. In Deutschland gibt es aber nicht nur Riesling. Auch der Spätburgunder, ein spät reifender Klon der Pinot Noir mit Geschmacksnoten von schwarzem Pfeffer, ist lohnenswert. Der Österreicher Aldo Sohm ist einer der renommiertesten Sommeliers der Welt, eine Legende seiner Branche. Christine Muhlke ist Redakteurin des Feinschmecker-Magazins „Bon Appétit“.
Der Mensch sollte mit der Natur nachhaltig umgehen
Katia Henriette Backhaus erklärt: „Nachhaltigkeit definiert sich über das Verhältnis von Mensch und Natur, das aus drei Perspektiven betrachtet werden kann.“ Die politische Perspektive fragt danach, wie man die Bedürfnisbefriedigung der Menschen zu ihrem Wohl und zum Wohl der Gemeinschaft organisieren kann. Dazu gehört auch der Gedanke an die nachhaltige Stabilisierung der politischen Ordnung. Die ökonomische Perspektive auf das Verhältnis von Mensch und Natur hingegen entspringt der Forderung nach dem „nachhaltigen Erhalt“ und der Sicherung eines nachhaltigen Ertrags. Natur betrachtet man dabei zunächst als Ressourcenlager, das als schützenswert gilt. Der Versuch, Ökologie und Ökonomie zusammenzudenken, prägt die Begriffshistorie der nachhaltigen Entwicklung. Katia Henriette Backhaus hat an der Universität Frankfurt am Main promoviert. Sie lebt in Bremen und arbeitet als Journalistin.
Portugal ist ein schlafender Riese des Weins
Portugal ist für den österreichischen Sommelier ein schlafender Riese des Weins. Momentan liegt es für ihn direkt hinter seinem Lieblingsland Spanien. Die Region Douro, Heimat des Portweins, verfügt über viele unterschiedliche Mikroklimas und Höhenlagen. In diesen gedeihen faszinierende Rot- und Weißweine wie der Touriga Nacional und Touriga Franca – Rot. Aldo Sohm und Christine Muhlke schreiben: „Empfehlenswerte Weißweine entstehen aus den Sorten Rabigato und Gouveio. Der Trend nach trockenen Weinen hat die Nachfrage nach Portwein gedämpft.“ Viele Erzeuger verlegen sich daher auf trockene Weiß- und Rotweine. Auch beim Vinho Verde geht der Trend vom perlenden, halbtrockenen Weißwein – Arinto, Loureiro – zu Einzelabfüllungen. Der Österreicher Aldo Sohm ist einer der renommiertesten Sommeliers der Welt, eine Legende seiner Branche. Christine Muhlke ist Redakteurin des Feinschmecker-Magazins „Bon Appétit“.
Das Internet gilt als Klimakiller
Wenn das Internet ein Land wäre, gehörte es zu den Top Ten der Energieverbraucher, in einer Liga mit Staaten wie den USA, China, Indien, Russland, Japan oder Deutschland. Dirk Steffens und Fritz Habekuss wissen: „Und während in vielen Wirtschaftsbereichen langsam – zu langsam! – der Energiebedarf zu sinken beginnt, wächst der Energiehunger der digitalen Welt um neun Prozent pro Jahr.“ Allein die Streamingdienste sind für etwa 300 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr verantwortlich. Das entspricht immerhin fast einem Drittel der Emissionen des globalen Luftverkehrs. So gesehen sind Katzenvideos fast so klimaschädlich wie Flugreisen. In ihrem Buch „Über Leben“ erzählen der Moderator der Dokumentationsreihe „Terra X“ Dirk Steffens und Fritz Habekuss, der als Redakteur bei der „ZEIT“ arbeitet, von der Vielfalt der Natur und der Schönheit der Erde.
Es gibt keine „veganen Gesellschaften“
Tierische Lebensmittel spielen in allen Ländern der Welt, bei ausreichender Verfügbarkeit, immer eine bedeutende Rolle. Malte Rubach weiß: „Entgegen vielfacher Behauptungen gibt es keine „veganen Gesellschaften“. Es gibt höchstes religiös-kulturell bedingten Verzicht oder schlicht kein Angebot an tierischen Lebensmitteln.“ Selbst wenn das Angebot vorhanden ist, dann ist natürlich der Preis auch ausschlaggebend. Sobald das Einkommen steigt, investieren Menschen jeden zusätzlichen Dollar überproportional und Milch und Fleisch. Leider geben sie ihr zusätzliches Einkommen auch für Alkohol, Tabak, gesüßte Getränke, Snacks und Elektronik aus. Das liegt schlicht an der hohen Nährstoffdichte von Milch und Fleisch, mit der sich der Bedarf an Mikronährstoffen einfacher decken lässt. Ansonsten wäre dafür eine gezielte Auswahl pflanzlicher Lebensmittel nötig. Der Referent und Buchautor Dr. Malte Rubach hat Ernährungswissenschaften in Deutschland, der Türkei und den USA studiert.
Die Erde benötigt die Empathie der Menschheit
Die Erde liegt im Fieber. Die Erwärmung der Erdoberfläche zwischen 1970 und heute beträgt 1 Grad Celsius. Chronisch erhöhtes Fieber ist nicht nur bei Menschen ein prognostisch schlechtes Zeichen. Fieber ist ein Hinweis darauf, dass im Inneren des Körpers eine Störung vorliegt. Joachim Bauer fügt hinzu: „Das Gleiche gilt für die erhöhte Temperatur des Organismus … Weiterlesen
Im Nordwesten Spaniens gibt es hervorragende Winzer
Der atlantische Nordwesten Spaniens ist zu einer der heißesten Regionen des Landes geworden. Zumindest was die neue Winzergeneration angelangt. Aldo Sohm und Christine Muhlke wissen: „Albariño ist besonders in der Region Rías Baixas verbreitet, wo sich die auf Granitböden stehenden Reben bis zum Atlantik hinabziehen. Die Weine zeichnen sich durch eine knackige Säure und einen herzhaften Abgang aus. Man kann das Meer förmlich schmecken.“ Die Albariños aus dem Landesinneren unterscheiden sich stark von den an der Küste angebauten. Man sollte auf die Bezeichnung „sobre lias“ achten, die auf einen längeren Kontakt mit den Hefen hinweist. Diese Albariños sind viel kraftvoller und ausdrucksstärker als die leichten Weine, die man früher im Supermarkt kaufte. Der Österreicher Aldo Sohm ist einer der renommiertesten Sommeliers der Welt, eine Legende seiner Branche. Christine Muhlke ist Redakteurin des Feinschmecker-Magazins „Bon Appétit“.
Die Kleintiere sind nicht für die Fische da
Eines möchte Josef H. Reichholf vorweg klarstellen: „Die Kleintiere in den Fließgewässern sind nicht für die Fische da. Die Fische nutzen, was es gibt und was sie verwerten können. Aber die Larven von Wasserinsekten, die Kleinkrebse oder Würmer im Bodenschlamm leben für sich und nicht für Fische oder für andere Nutzer wie die Wasservögel.“ Dies betont Josef H. Reichholf ausdrücklich, weil seitens der Fischerei diese Ansicht vertreten wird. Denn mit gleicher Berechtigung könnten Vogelschützer die Fische als „Vogelnährtiere“ einstufen. Der Bezug der Nutzer, der Fische, wie der Vögel, die von Fischen leben auf ihre Nahrungsgrundlage entspricht den natürlichen Begebenheiten. Nicht gerechtfertigt wäre, dies nur für die Fische gelten zu lassen, nicht aber für andere Tiere. Josef H. Reichholf lehrte an der Technischen Universität München 30 Jahre lang Gewässerökologie und Naturschutz.