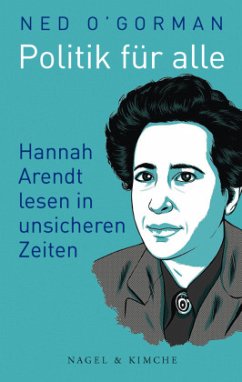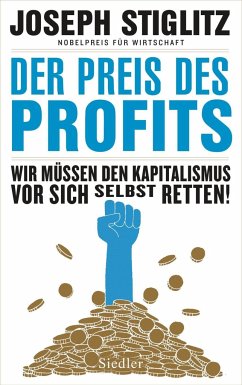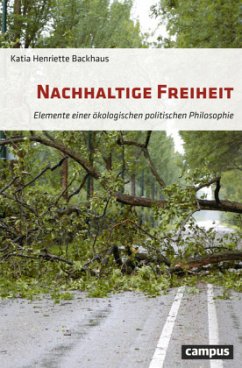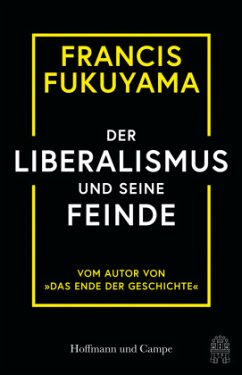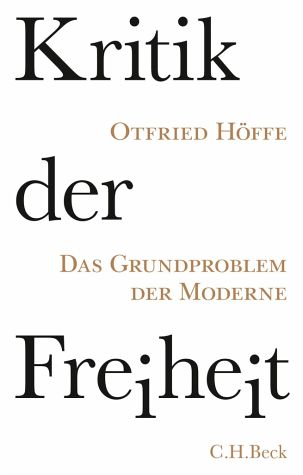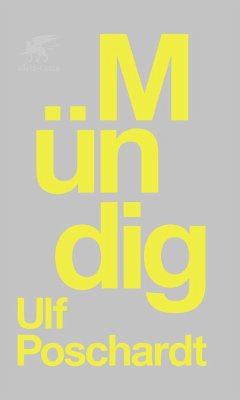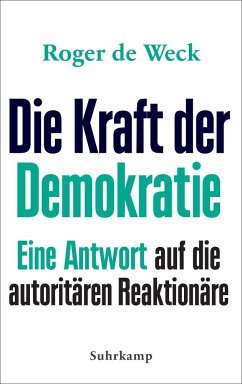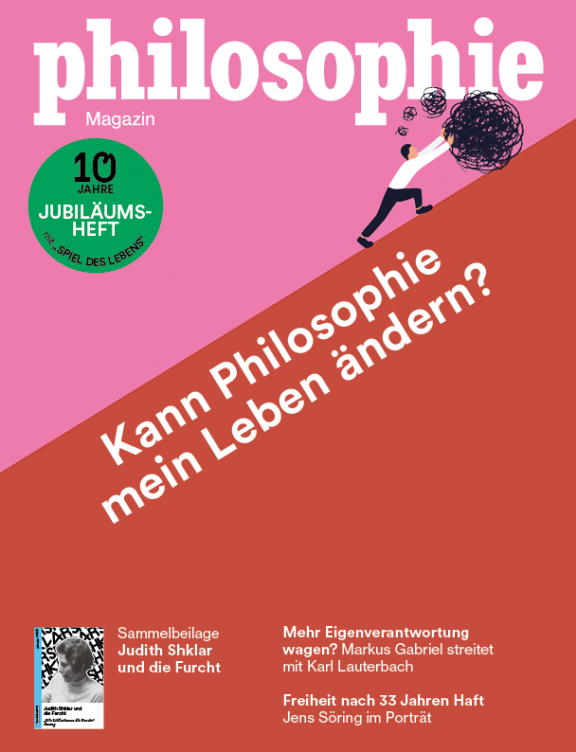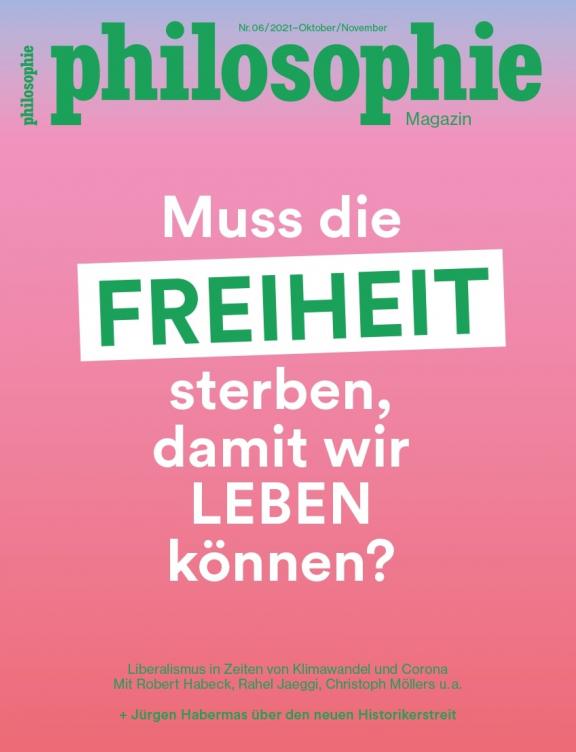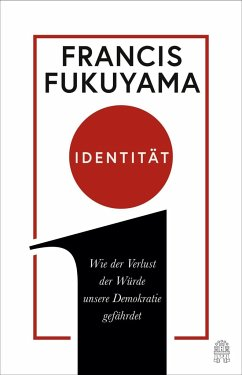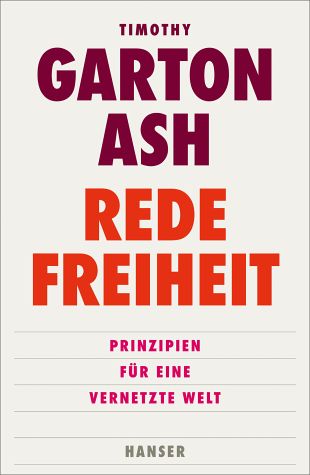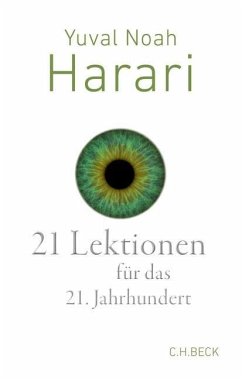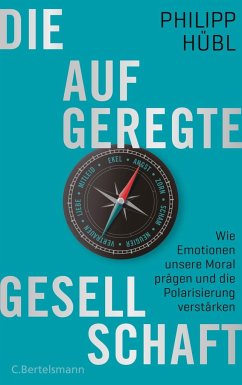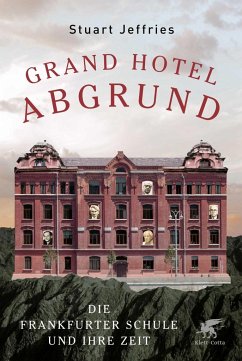Hannah Arendts Texte enthalten eine Art Grundkurs in Politik. Er basiert auf einigen Tatsachen, die man mit den fünf Sinnen und dem gesunden Menschenverstand begreifen kann. Ned O’ Gorman erläutert: „Zunächst fordert Arendt uns auf, unsere Grundsituation als Menschen in den Blick zu nehmen. Insbesondere die erste und wichtige Tatsache: dass nämlich du und ich und andere zusammen auf dieser Erde leben.“ Hannah Arendt bezeichnet dies als „menschliche Bedingtheit“. Es ist bedeutsam, dass Arendt ihr Nachdenken über Politik mit der conditio humana beginnt und nicht etwa mit der sogenannten „Natur des Menschen“. Viele andere bekannte Namen der politischen Philosophie der Moderne sahen das anders. Sie nahmen an, Politik sei in der einen oder anderen Weise eine Antwort auf und ein Umgehen mit dem Problem der „menschlichen Natur“. Ned O’ Gorman ist Professor für Kommunikationswissenschaften an der University of Illinois.
Liberalismus
Ökonomie und Polarisierung entmachten die Demokratie
In seinem Buch „Das Unbehagen in der Demokratie“ beschreibt Michael J. Sandel wie nicht rechenschaftspflichtige Macht und verfestigte Polarisierung zusammenhängen. Beide entmachten demokratische Politik. Der Autor schreibt: „Die Kulturkämpfe sind so kontrovers und unwiderstehlich, dass sie uns davon abhalten, gemeinsam das System von einseitiger Manipulation zu befreien.“ Um die amerikanische Demokratie wieder aufleben zu lassen, muss man zwei Fragen erörtern. Wie kann man die Wirtschaft so reformieren, dass sie demokratischer Kontrolle unterliegt? Und wie kann man die Polarisierung abschwächen, damit die Amerikaner die Fähigkeit erlangen, sich zu effektiven demokratischen Bürgern zu entwickeln? Es kommt also darauf an, einerseits wirtschaftliche Macht zur Verantwortung zu ziehen und andererseits die Bürgerschaft zu stärken. Michael J. Sandel ist ein politischer Philosoph. Er studierte in Oxford und lehrt seit 1980 in Harvard. Er zählt zu den weltweit populärsten Moralphilosophen.
Die Aufklärung hat seit jeher Feinde
Der mit der Aufklärung verbundene Fortschritt hatte seit jeher Feinde. Dazu gehören heue auch religiöse Konservative. Ihnen missfallen Ideen wie die Evolution und einigen sind die Toleranz und der Liberalismus ein Dorn im Auge. Hinzu kommen Menschen, deren wirtschaftliche Interessen im Widerspruch zu naturwissenschaftlichen Erkenntnissen stehen. Joseph Stiglitz nennt als Beispiel die Eigentümer von Bergbauunternehmen und ihre Arbeiter. Da sie in erheblichem Umfang zur globalen Erwärmung und zum Klimawandel beitragen, müssen sie damit rechnen, dass man ihren Betrieb schließt. Um die politische Macht zu erlangen, bedurfte es der Unterstützung der Wirtschaft insgesamt, die als Gegenleistung Deregulierung und Steuersenkungen verlangte. Joseph Stiglitz war Professor für Volkswirtschaft in Yale, Princeton, Oxford und Stanford. Er wurde 2001 mit dem Nobelpreis für Wirtschaft ausgezeichnet.
Martha Nussbaum fordert Gerechtigkeit
Um die Frage, was für ein gutes Leben wichtig ist, geht es Martha Nussbaum und Amartya Sen, die den „capabilities“-Ansatz maßgeblich entwickelt haben. Katia Henriette Backhaus erklärt: „Nussbaum versteht ihre Variante als Teil des politischen Liberalismus. Es gibt jedoch grundlegende Unterschiede zur Debatte um „greening liberalism“. Soziale Gerechtigkeit, Gleichheit und die Lebensqualität stehen im Kern von Martha Nussbaums Überlegungen, die sich darum drehen, was eine Person fähig ist, zu tun und zu sein. Davon ausgehend bildet sie ihre Gerechtigkeitstheorie. Eine Kombination interner Fähigkeiten und externer Möglichkeiten macht den umfassenden Charakter dieses Ansatzes aus. Dieser fordert von Gesellschaft und Staat, diese beiden Aspekte menschlicher „capabilities“ zu gewährleisten. Katia Henriette Backhaus hat an der Universität Frankfurt am Main im Bereich der politischen Theorie promoviert. Sie lebt in Bremen und arbeitet als Journalistin.
Der Liberalismus ist weltweit stark gefährdet
In seinem neuen Buch „Der Liberalismus und seine Feinde“ benennt Francis Fukuyama die Probleme der Gegenwart und wie sich eine liberale Gesellschaft dazu verhalten muss. Seine Fragen sind so aktuell wie nie: „Warum haben sich so viele Menschen von der Demokratie und Freiheit entfernt? Und wie machen wir den Liberalismus endlich wieder attraktiv und stark?“ Mit seinem Werk will der Autor eine Verteidigung des klassischen Liberalismus vorlegen, denn er vertritt die These, dass dieser heute überall auf der Welt stark gefährdet ist. Früher mochte man ihn für selbstverständlich halten. Doch heute müssen seine Tugenden aufs Neue klar dargelegt und hervorgehoben werden. Mit „Liberalismus“ bezieht sich Francis Fukuyama auf die Lehre, die in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts erstmals in Erscheinung trat. Francis Fukuyama ist einer der bedeutendsten politischen Theoretiker der Gegenwart.
Der Liberalismus muss sich reflexiv regenerieren
Im Zeitalter der Philosophen, der Aufklärung, geboren, hält der neuzeitliche Liberalismus ein weiteres Element für unverzichtbar. Zum Erfahrungsbezug, zu dem legitimatorischen Individualismus und dem freien Spiel der Kräfte innerhalb von Verfassung und Recht tritt eine handlungsrelevante Selbstkritik, sichtbar im Willen, sich angesichts neuer Herausforderungen zu verändern. Otfried Höffe stellt klar: „Ohne dieses Element, eine reflexive Regeneration ist der Liberalismus nicht zukunftsfähig; vor allem verdient er ohne es nicht, als aufgeklärt zu gelten.“ So hat sich der in Europa dominante Liberalismus längst um politische Mitwirkungsrechte und um freiheits- und demokratiefunktionale Sozialrechte erweitert. Otfried Höffe fordert die Grundelemente des Liberalismus in einer interkulturell verständlichen Sprache zu legitimieren. Otfried Höffe ist Professor für Philosophie und lehrte in Fribourg, Zürich und Tübingen, wo er die Forschungsstelle Politische Philosophie leitet.
Der Liberalismus orientiert sich am Ideal der Freiheit
Der Liberalismus sieht seine Hauptaufgabe in der Beschränkung der Zwangsgewalt jeder Regierung. Dementsprechend verantwortet er einen zuverlässigen Inhalt der Gesetze. In der Demokratie dagegen geht es im Grundsatz um das Verfahren, in dem man bestimmt, was als Gesetz zu gelten hat. Also geht es unter anderem um die Regierungsform der Herrschaft der Mehrheit. Friedrich A. Hayek versteht den Liberalismus als eine politische Lehre, die Ziele und Aufgaben des Staates vorschlägt. Dabei orientiert er sich am Ideal der Freiheit. Katia Henriette Backhaus ergänzt: „Demokratie ist für ihn hingegen ein politisches Verfahren, ein Mittel, um die Meinung der Mehrheit zur Geltung zu bringen.“ Katia Henriette Backhaus hat an der Universität Frankfurt am Main im Bereich der politischen Theorie promoviert. Sie lebt in Bremen und arbeitet als Journalistin.
Der bürgerliche Konsum war nachhaltig
Mit dem Bericht des Club of Rome von 1972 erhielt die alte Vorstellung des Konsums einen Dämpfer. Dessen Essenz im vulgären wie im eleganteren Sinne von Mehr an Quantität und Qualität bedeutete. Ulf Poschardt erklärt: „Direkt nach den sozialistischen Utopien der Sechzigerjahre begann die Zeit der bürgerlichen Utopien.“ In diesen war die Verantwortung des Konsumenten die staatsbürgerliche Fortschreibung seiner Freiheiten. Der bürgerliche Konsum war in der Tendenz nachhaltig, zumindest wenn er sich um repräsentative Symbolik bemühte. Allerdings versäumten es die bürgerlichen Politiker und Intellektuellen, bis auf wenige Ausnahmen, sich diesen Ideen zu verschreiben. Dabei hatten es konservative Bürger immer so gehalten: Nachhaltig ist, was man vererben kann und man nicht wegeschmeißen muss. Seit 2016 ist Ulf Poschardt Chefredakteur der „Welt-Gruppe“ (Die Welt, Welt am Sonntag, Welt TV).
Die Freiheit muss immer verteidigt werden
Die Bedeutung der Freiheit nicht zu leugnen und sie immer wieder zu hinterfragen und damit zugleich zu verteidigen, ist eine wichtige Aufgabe. Vor allem geht es auch um Folgendes. Nämlich die Freiheit auf ihre Angemessenheit in Bezug auf den Kontext, in dem sie gelebt wird oder werden soll, zu prüfen. Katia Henriette Backhaus erläutert: „Das setzt voraus, die sich stets wandelnde gesellschaftliche und politische Gegenwart klar zu analysieren.“ Daneben sollte man eine Position für oder gegen eine bestimmte Konzeption von Freiheit einnehmen. Zugleich gibt es folgendes Ziel. Nämlich eine konkrete Vorstellung davon zu entwickeln, was Freiheit unter den gegenwärtigen Umständen bedeuten kann und soll. Katia Henriette Backhaus hat an der Universität Frankfurt am Main im Bereich der politischen Theorie promoviert. Sie lebt in Bremen und arbeitet als Journalistin.
John Rawls entwickelt eine Gerechtigkeitstheorie
Im Allgemeinen hat John Rawls versucht, dass sein Liberalismus vermeidet, den Bürgern eines liberalen Regierungssystems eine bestimmte Konzeption des Guten aufzudrängen. Seine Gerechtigkeitstheorie beruht durchaus auf dem Gedanken, dass Autonomie für sich genommen gut für die Menschen ist. Und dass diesen genug Raum für deren Ausübung gelassen werden sollte. Danielle Allen ergänzt: „Sie enthält auch einen knappen Ausblick auf das demokratischer Gleichheit innewohnende menschliche Gut.“ Jürgen Habermas vertritt die These, dass Demokratie an sich wertvoll ist. Weil politische Teilhabe nicht nur für die Selbstachtung, sondern für volles menschliches Wohlergehen unverzichtbar ist. John Rawls lehnte die Wahrheit des klassischen Humanismus ab. Die Politikwissenschaftlerin und Altphilologin Danielle Allen lehrt als Professorin an der Harvard University. Zugleich ist sie Direktorin des Edmond J. Safra Center for Ethics in Harvard.
Die liberalen Demokratien sind gefährdet
Mit Überzeugung und Selbstgewissheit hat das liberale Establishment den weltweiten Vormarsch des Ultrakapitalismus betrieben. Und dies unbeirrt durch alle Krisen hindurch, konsequent seit den siebziger Jahren. Dieses Unterfangen ist laut Roger de Weck gelungen. Trotzdem mündet es jetzt in ein doppeltes Fiasko: „Sowohl die liberale Wirtschaft als auch die liberale Demokratie sind weniger liberal geworden.“ Die Marktwirtschaft hat sich in eine Machtwirtschaft verwandelt. Zudem rütteln zwei Spielarten des Autoritarismus am Fundament liberaler Demokratien. Erstens die Willkürherrschaft der Reaktionäre. Zweitens die Geldherrschaft von Milliardären, sprich Plutokratie. Der Sieg der Neoliberalen bedrängt den Liberalismus und die Liberalität – eine fatale Erfolgsgeschichte. Im Kapitalismus hatte das Kapital seit je Vorrang vor andern Faktoren der Produktion. Roger de Weck ist ein Schweizer Publizist und Ökonom.
Reichtum darf kein Selbstzweck sein
Mit den „Grundsätzen der politischen Ökonomie“ (1848) schreibt John Stuart Mill das für den englischen Sprachraum wichtigste wirtschaftstheoretische Werk des 19. Jahrhunderts. Der Autor wendet sich in seinem Buch gegen utopische Sozialisten. Diese wollen den Staat an die Stelle des freien Wettbewerbs setzen. Otfried Höffe erklärt: „Weil die einzelnen Menschen eigennützig handelten und zugleich ihre Interessen selbst am besten beurteilen könnten, bringe die staatliche Nichteinmischung eine doppelte Optimierung zustande. Nämlich die für den Utilitaristen Mill wichtige effizienteste Staatstätigkeit und in liberaler Perspektive den stärksten Anreiz zur Entwicklung des einzelnen.“ Die „ökonomische“ Ansicht vom Vorrang der Wirtschaft lehnt John Stuart Mill jedoch ab. Der Primat liege allein bei der Politik. Otfried Höffe ist Professor für Philosophie und lehrte in Fribourg, Zürich und Tübingen, wo er die Forschungsstelle Politische Philosophie leitet.
Die Philosophie kann das Leben verändern
Das Titelthema des neuen Philosophie Magazins 01/2022 beschäftigt sich mit der Frage: „Kann Philosophie mein Leben ändern?“ Chefredeakteurin Svenja Flaßpöhler betont in ihrem Editorial, dass die drängenden politischen Fragen von fundamentalen existenziellen Fragen nicht zu trennen sind. Die Redaktion hat den Titel der Jubiläumsausgabe deshalb gewählt, weil jede große Transformation konkret im eigenen Dasein beginnt. Und die Philosophie besitzt das Potenzial, den notwendigen Wandel anzustoßen. Sie befähigt im günstigsten Fall Menschen, mündige Entscheidungen zu treffen. Dabei ist der begründete Zweifel immer der erste Schritt zur Veränderung. Die Zerstörung angenehmer Gewissheiten ist schließlich seit jeher philosophische Methode, von Sokrates über Arthur Schopenhauer bis hin zu Emil Cioran. Jeder sollte sich die Frage stellen, ob er das Leben führt, das er führen will und je nachdem wie die Antwort ausfällt, weitreichende Entscheidungen zu treffen.
Die Freiheit ermöglicht ein menschenwürdiges Leben
Chefredakteurin Svenja Flaßpöhler meint in ihrem Editorial, dass die Titelfrage des neuen Philosophe Magazins 06/2021 provokant sei. Sie lautet: „Muss die Freiheit sterben, damit wir leben können?“ Denn immerhin hat die philosophische Strömung des Liberalismus vollkommen zur Recht darauf gepocht, dass gerade die Freiheit es ist, die Leben – wahres, menschenwürdiges Leben – überhaupt erst ermöglicht. Viele Menschen betrachten die Selbstbestimmung als den Kern der Freiheit. Freiheit ist das Gegenteil von Zwang. Ein freier Mensch verfügt über sich und entscheidet selbst. Er ordnet sich nicht unter, sondern gibt sich selbst ein Gesetz. Die Freiheit muss verteidigt werden. Darin sind sich Aufklärer wie Immanuel Kant, Liberale wie John Stuart Mill und Individualisten wie Friedrich Nietzsche einig. Die Freiheit muss geschützt werden vor der Macht des Staates, vor der herrschenden Moral und vor dem Druck der Mehrheit.
Ideen halfen beim Aufstieg des Nationalismus
Ideen waren laut Francis Fukuyama wichtig, um den Aufstieg des Nationalismus zu verstehen. Doch außerdem fanden bedeutende wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen statt. Diese bereiteten seinem Erscheinen in Europa des 19. Jahrhunderts den Boden. Francis Fukuyama blickt zurück: „Die europäische Ordnung des Mittelalters war hierarchisch und nach sozialen Klassen gegliedert gewesen.“ Der Feudalismus teilte die Bevölkerungen Europas zahllosen winzigen Gerichtsbarkeiten zu. Und er war darauf angelegt, sie an ihrem jeweiligen Ort festzuhalten. Eine moderne Marktwirtschaft ist im Unterschied dazu auf die freie Bewegung von Arbeitskräften, Kapital und Ideen angewiesen. Eine umfassende Anerkennung liberaler Gesellschaften war besonders für die kapitalistische Entwicklung förderlich. Francis Fukuyama ist einer der bedeutendsten politischen Theoretiker der Gegenwart. Sein Bestseller „Das Ende der Geschichte“ machte ihn international bekannt.
John Rawls repräsentiert den neuen Liberalismus
Für den neueren Liberalismus dürfte John Rawls mit seiner „Theory of Justice“ (1971) der herausragende Repräsentant sein. An der unangefochtenen Spitze seiner berühmten Prinzipien der Gerechtigkeit steht eine Variante von Immanuel Kants einschlägigem Prinzip. Otfried Höffe erklärt: „Danach hat jeder das gleiche Recht auf das umfangreichste Gesamtsystem gleicher Grundfreiheiten, das mit demselben Recht aller anderen verträglich ist.“ Dieses Prinzip spricht sich sowohl für die liberalen Freiheitsrechte als auch die demokratischen Mitwirkungsrechte aus. In einem zweiten Prinzip wird es um ein hohes Maß an Sozialstaatlichkeit erweitert. Denn es erlaubt zwar wirtschaftliche und soziale Ungleichheiten, aber ist nur unter den Bedingungen fairer Chancengleichheit. Um Gerechtigkeit zu garantieren, muss eine zweiten Bedingung hinzukommen. Die entsprechende Wirtschafts- und Sozialordnung soll auch den Schlechtestgestellten zugutekommen. Otfried Höffe ist Professor für Philosophie und lehrte in Fribourg, Zürich und Tübingen, wo er die Forschungsstelle Politische Philosophie leitet.
Viele halten die Religion für etwas Besonderes
Während des größten Teils der Menschheitsgeschichte hatten die Menschen das Gefühl, dass Religion und freie Meinungsäußerung in einem Spannungsverhältnis standen. Und dem größten Teil der Menschheit geht das auch heute noch so. Timothy Garton Ash weiß: „Bei den Kämpfen um die Meinungsfreiheit in Europa und Nordamerika des 17. und 18. Jahrhunderts war ein zentrales Anliegen die Freiheit, verschiedene Religionen predigen und praktizieren zu können.“ Erstaunlicherweise stehen bei vielen europäischen Ländern immer noch Blasphemievergehen im Strafgesetzbuch. Allerdings ahndet man sie nur selten. In Russland und Polen verurteilt man freilich Menschen wegen der „Verletzung religiöser Gefühle“. Irland führte im Jahr 2009 den Strafbestand der blasphemischen Verunglimpfung wieder ein. Timothy Garton Ash ist Professor für Europäische Studien an der Universität Oxford und Senior Fellow an der Hoover Institution der Stanford University.
Die Konservativen sind in einer Sinnkrise
Die Kirche nennt ihre im Erwachsenenalter getauften Schäfchen Neophyten. Oft sind diese neuen Gläubigen Eiferer. Sie sind intolerant wie die Neokonservativen, die jetzt weltweit auftrumpfen. Und sie sind streng dogmatisch wie die Neoliberalen, die nach wie vor den Ton angeben. Roger de Weck stellt fest: „Das Präfix „neo“ ist hier zum Fingerzeig geworden, dass eine demokratische in eine sehr direktive bis autoritäre Grundhaltung umschlagen kann. Archaisches lässt sich sehr wohl in moderne Formen gießen.“ Die politische Familie der Liberalen ist ein buntes Allerlei. Sozialliberale wollen die soziale Not lindern, weil sie Unfreiheit bedeutet. Wirtschaftsliberale fordern jederzeit noch mehr Freiheit vom Staat. Liberalkonservative hängen an der bürgerlichen Freiheit. Die stets uneinigen Liberalen debattieren und streiten. Roger de Weck ist ein Schweizer Publizist und Ökonom.
Willkürliche Machtausübung bedroht die Freiheit
Wenn man über Freiheit spricht, ist das, wovon man sich befreien will, ein bewegliches Ziel. Heutige Konservative mit intellektuellen Neigungen bezeichnen sich oft als „klassische Liberale“. Ihre Vorstellung von der menschlichen Freiheit wurde von John Locke und den Begründern des modernen Liberalismus geprägt. John Locke baute seine politische Argumentation auf dem Konzept der Freiheit auf. Sein Einfluss ging weit über die politische Sphäre hinaus. Sie prägt bis heute das Ideal einer Autonomie, die für den modernen Menschen zur zweiten Natur geworden ist. Matthew B. Crawford stellt fest: „Lockes Neudefinition der Politik machte eine Neudefinition der menschlichen Natur sowie der Stellung des Menschen in der Welt erforderlich. Letzten Endes musste er neu definieren, wie wir die Welt begreifen.“ Matthew B. Crawford ist promovierter Philosoph und gelernter Motorradmechaniker.
Jede Person hat ihre eigenen Mythen
Fast alle Menschen denken eher in Geschichten als in Fakten, Zahlen oder Gleichungen. Und je einfacher die Geschichte ist, desto besser. Yuval Noah Harari erklärt: „Jede Person, jede Gruppe und jede Nation hat ihre eigenen Erzählungen und Mythen.“ Doch im Verlauf des 20. Jahrhunderts formulierten die globalen Eliten in New York, Berlin und Moskau drei große Erzählungen. Diese nahmen für sich in Anspruch, die gesamte Vergangenheit zu erklären und die Zukunft der ganzen Welt vorherzusagen. Dabei handelt es sich um die faschistische, die kommunistische und die liberale Erzählung. Der Zweite Weltkrieg machte dem faschistischem Narrativ den Garaus, und von Ende der 1940er Jahre bis Ende der 1980er Jahre wurde die Welt zum Schlachtfeld zwischen nur noch zwei Erzählungen: Kommunismus und Liberalismus. Yuval Noah Harari ist Professor für Geschichte an der Hebrew University of Jerusalem.
Autorität gibt der Gesellschaft eine Struktur
Wer Macht hat, hat das Sagen. Diese Verbindung spiegelt sich laut Philipp Hübl in den Metaphern wider, mit denen man über Macht spricht. Wer „gehorcht“, der hört auf jemanden. Und wem etwas „gehört“, der hat Verfügungsgewalt darüber. Die etymologische und inhaltliche Nähe zwischen hören, gehören und gehorchen findet sich in vielen indogermanischen Sprachen. Nur wenn jemand Ansagen macht, hat eine arbeitsteilige Gruppe oder Gesellschaft eine Struktur. Genau das regelt das Prinzip der Autorität. Schon John Stuart Mill hat im Jahr 1859 festgestellt, dass neben Fortschritt auch Ordnung und Stabilität Grundbedürfnisse des Menschen sind. Mill zählte zu den Gründervätern des Liberalismus. Philipp Hübl ist Philosoph und Autor des Bestsellers „Folge dem weißen Kaninchen … in die Welt der Philosophie“ (2012).
Der Faschismus fördert das Fortbestehen des Kapitalismus
Für den deutschamerikanischen Philosophen, Politologen und Soziologen Herbert Marcuse war der Faschismus in Deutschland kein Bruch mit der Vergangenheit. Er war seiner Meinung nach die Fortsetzung von Tendenzen innerhalb des Liberalismus, die das kapitalistische Wirtschaftssystem unterstützten. Für Stuart Jeffries sah so die orthodoxe Lehre der Frankfurter Schule aus: „Der Faschismus bedeute keine Abschaffung des Kapitalismus, sondern war vielmehr ein Mittel, sein Fortbestehen zu sichern.“ Der deutsche Sozialphilosoph Max Horkheimer schrieb einmal: „Wer aber vom Kapitalismus nicht reden will, sollte auch vom Faschismus schweigen.“ Vielleicht musste man Deutscher sein, um dieses Postulat widerspruchslos zu akzeptieren. Max Horkheimer musste vor den Nazis zuerst nach Genf fliehen. Zusammen mit Leo Löwenthal, Erich Fromm und Herbert Marcuse zog er nach Genf um, um zusammen mit ihnen ihre Arbeit fortzusetzen. Stuart Jeffries arbeitete zwanzig Jahre für den „Guardian“, die „Financial Times“ und „Psychologies“.
Das Prinzip der Freiheit darf niemals aufgegeben werden
An dem für sie wesentlichen Prinzip der Freiheit zeigt die Moderne, dass sie kein schlechthin neues Ziel verfolgt, sondern eine anthropologisch Grundintention, eben die Freiheit, zur Blüte, am liebsten sogar zur Vollendung bringen will. Otfried Höffe warnt: „Wer das Prinzip Freiheit aufgibt, setzt also mehr als nur das Projekt der Moderne und Einsichten ihrer großen Denker aufs Spiel.“ Allerdings erweist sich die Freiheit samt Moderne als ein vielschichtiges, inneren Spannungen ausgesetztes, in mancher Hinsicht sogar widersprüchliches Ziel. Otfried Höffe versteht also die Freiheit als ein facettenreiches, intern spannungsgeladenes und von Widersprüchen durchwirktes Phänomen. Viele Vorhaben und Visionen, erneut sowohl der Menschheit im Allgemeinen als auch der Moderne im Besonderen, sind von einem Freiheitsgedanken inspiriert. Otfried Höffe ist Professor für Philosophie und lehrte in Fribourg, Zürich und Tübingen, wo er die Forschungsstelle Politische Philosophie leitet.
Der Westen muss seine eigenen Prinzipien formulieren
Die Praxis des westlichen Universalismus war den größten Teil seiner Geschichte alles andere als universell. Er schloss viele Menschen im eigenen Land und fast alle Menschen im Ausland aus. Die Frauen und die Mitglieder der „niedrigeren“ Gesellschaftsschichten wurden als Menschen zweiter Klasse behandelt. Thomas Jefferson, einer der Gründerväter der Vereinigten Staaten von Amerika, hielt sogar Sklaven. Timothy Garton Ash ergänzt: „Ab etwa 1500 manifestierte sich der westliche Universalismus für den größten Teil der Welt als Kolonialismus.“ Für einige hat sich diese Geschichte des westlichen Universalismus, der sich als Imperialismus manifestiert, bis in die heutige Zeit fortgesetzt. Timothy Garton Ash ist Professor für Europäische Studien an der Universität Oxford und Senior Fellow an der Hoover Institution der Stanford University.
Der Liberalismus brachte Frieden und Wohlstand
Der Liberalismus hat trotz zahlreicher Defizite eine deutlich bessere Bilanz aufzuweisen als jede seiner Alternativen. Yuval Noah Harari stellt fest: „Die meisten Menschen genossen nie mehr Frieden oder Wohlstand als unter der Ägide der liberalen Ordnung des frühen 21. Jahrhunderts.“ Zum ersten Mal in der Geschichte sterben weniger Menschen an Infektionskrankheiten als an Altersschwäche, weniger Menschen sterben an Hunger als an Fettsucht, und durch Gewalt kommen weniger Menschen ums Leben als durch Unfälle. Doch der Liberalismus hat keine offenkundigen Antworten auf die größten Probleme, vor denen die Menschheit steht: den ökologischen Kollaps und die technologische Disruption. Der Liberalismus vertraute traditionell auf das Wirtschaftswachstum, um wie durch Zauberhand schwierige gesellschaftliche und politische Konflikte zu lösen. Yuval Noah Harari ist Professor für Geschichte an der Hebrew University of Jerusalem.