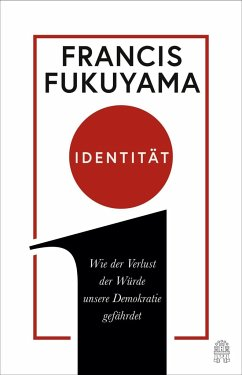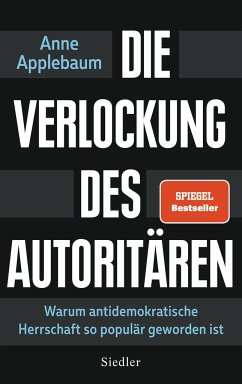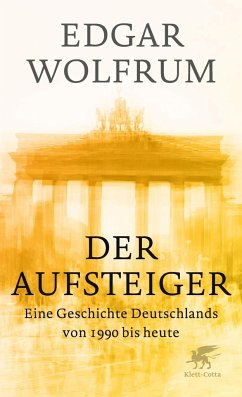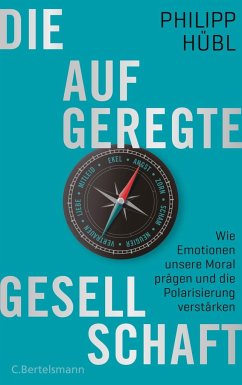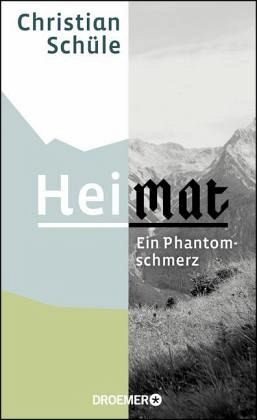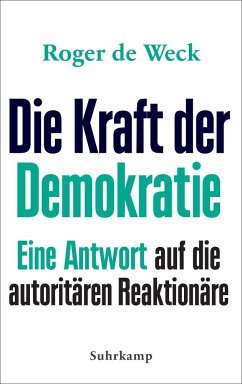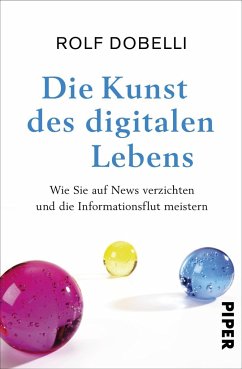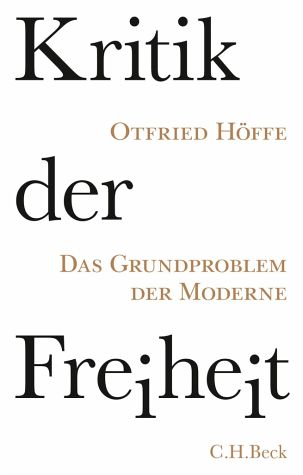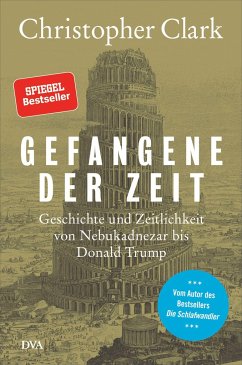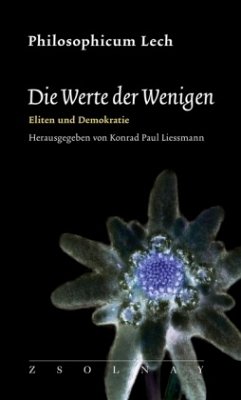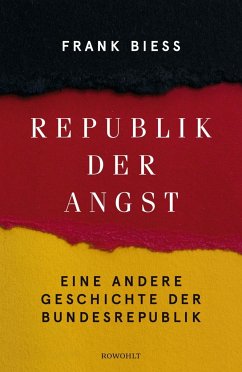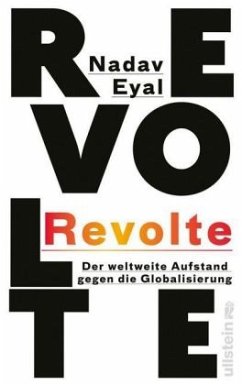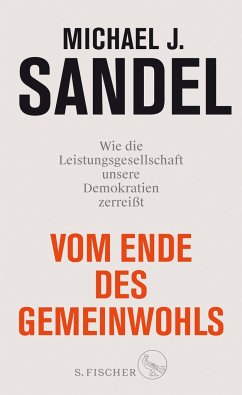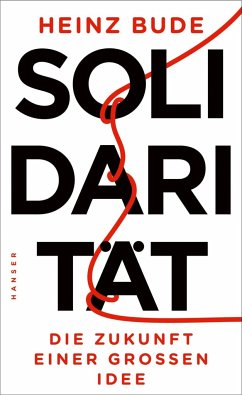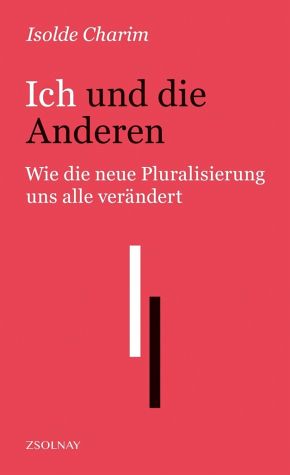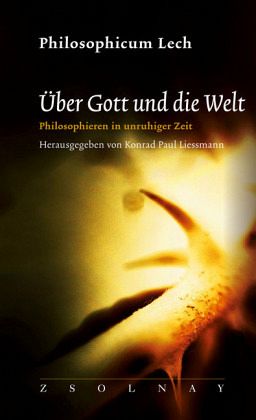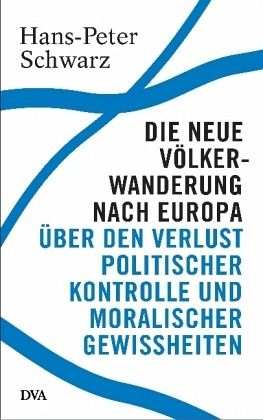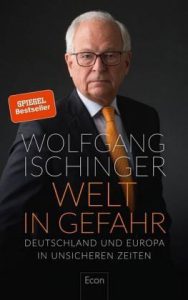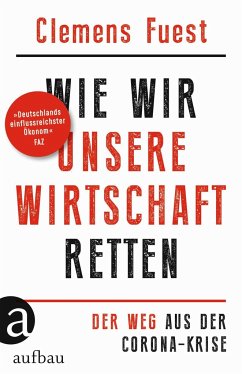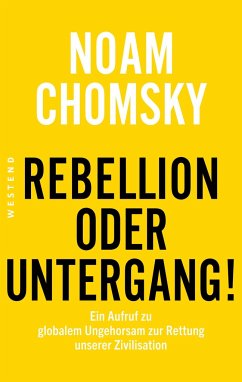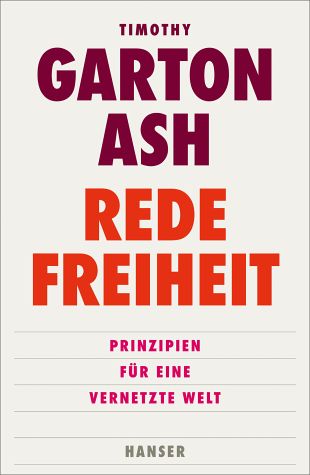Ideen waren laut Francis Fukuyama wichtig, um den Aufstieg des Nationalismus zu verstehen. Doch außerdem fanden bedeutende wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen statt. Diese bereiteten seinem Erscheinen in Europa des 19. Jahrhunderts den Boden. Francis Fukuyama blickt zurück: „Die europäische Ordnung des Mittelalters war hierarchisch und nach sozialen Klassen gegliedert gewesen.“ Der Feudalismus teilte die Bevölkerungen Europas zahllosen winzigen Gerichtsbarkeiten zu. Und er war darauf angelegt, sie an ihrem jeweiligen Ort festzuhalten. Eine moderne Marktwirtschaft ist im Unterschied dazu auf die freie Bewegung von Arbeitskräften, Kapital und Ideen angewiesen. Eine umfassende Anerkennung liberaler Gesellschaften war besonders für die kapitalistische Entwicklung förderlich. Francis Fukuyama ist einer der bedeutendsten politischen Theoretiker der Gegenwart. Sein Bestseller „Das Ende der Geschichte“ machte ihn international bekannt.
Politik
Der Einparteienstaat wurde 1917 erfunden
Monarchie, Tyrannei, Oligarchie, Demokratie – diese Herrschaftsformen kannten schon Platon und Aristoteles vor über zwei Jahrtausenden. Doch der nicht freiheitliche Einparteienstaat wurde erst 1917 von Lenin in Russland erfunden. Heute ist er überall auf der Welt von China über Venezuela bis nach Zimbabwe zu finden. Anne Applebaum stellt fest: „Im Gegensatz zum Marxismus ist die illiberale Einparteienherrschaft keine Philosophie. Sie ist ein Mechanismus des Machterhalts und verträgt sich mit vielen Ideologien.“ Sie funktioniert, weil sie zweifelsfrei definiert, wer der Elite angehört – der politischen Elite, der kulturellen Elite, der finanziellen Elite. In den vorrevolutionären Monarchien Russlands und Frankreichs fiel das Recht zur Herrschaft der Aristokratie zu. Diese definierte sich über strenge Regeln der Heirat und der Etikette. Anne Applebaum ist Historikerin und Journalistin. Sie arbeitet als Senior Fellow an der School of Advanced International Studies der Johns Hopkins University.
Das 20. Jahrhundert war eine Zeit der Vertreibung
Das 20. Jahrhundert war ein Zeitalter der gewaltsamen Vertreibung von Menschen aus ihrer Heimat, von Flucht und Entwurzlung. Flucht und Elendsmigration hat es zu unterschiedlichen Zeiten in der ganzen Welt gegeben. So etwa in den 1970er Jahren, als eine riesige Fluchtwelle der „Boatpeople“ in Asien anhob. Seit den Massenvertreibungen und Deportationen während und unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg war Europa von keiner Zwangsmigration vergleichbaren Ausmaßes heimgesucht worden wie in den 1990er Jahren. Edgar Wolfrum erklärt: „Als Jugoslawien zerfiel und man auf dem Balkan Kriege führte, setzten massive Vertreibungen und ethnische Säuberungen ein. Fünf Millionen Menschen waren von diesem neuen nationalistischen Wahn betroffen.“ Seit der Jahrtausendwende versuchen nun Jahr für Jahr Tausende von afrikanischen Elendsflüchtlingen nach Europa zu gelangen. Edgar Wolfrum ist Inhaber des Lehrstuhls für Zeitgeschichte an der Universität Heidelberg.
Verunglimpfungen funktionieren oft über Ekel
In den USA sind Reinheitsthemen im rechten Lager schon lange verbreitet. Der Anführer der amerikanischen Alt-Right-Bewegung, Richard Spencer, träumt von einer „Erneuerung“ des weißen Volkes durch „Wiedergeburt“. Und die bibeltreuen Christen halten Homosexualität für eine moralische Verunreinigung und die Homo-Ehe für das Werk Satans. Philipp Hübl erklärt: „Vor allem Verunglimpfungen, also abfällige Bezeichnungen für Fremde und Minderheiten, funktionieren oft über Ekel.“ Durch den erscheint deren Aussehen, Essgewohnheiten und Sitten als abstoßend. Vergleiche mit Tieren, Essen oder Exkrementen sind ebenfalls weit verbreitet. Ein Ausdruck wie „Krauts“ oder „Kartoffeln“ für Deutsche erscheint im internationalen Vergleich da fast wie ein Kosename. Der Ausdruck „links-grün versifft“ leitet sich übrigens von der Geschlechtskrankheit Syphilis ab. Philipp Hübl ist Philosoph und Autor des Bestsellers „Folge dem weißen Kaninchen … in die Welt der Philosophie“ (2012).
Integration braucht den Willen zur Zuwendung
Neben „Bildung“ geht vielen Zeitgenossen nur noch ein Begriff aus dem Arsenal spätmoderner Problemlösungsrhetorik schneller über die Lippen: Integration. Als wäre mit dem Aussprechen des Worts bereits das Programm benannt. Als wäre Integration eine Währung, die sich einfach so konvertieren ließe. Ohne auch nur zu fragen, ob damit womöglich nicht ein viel zu hoher Anspruch formuliert ist, ob es sich nicht um Inflationsgefahr handeln könnte und man sich besser über Inklusion, Annäherung oder temporäre Hospitalität unterhalten sollte. Christan Schüle ergänzt: „Oft werden besagte Leitbegriffe gekoppelt in der Annahme, durch mehr Bildung erreiche man bessere Integration.“ Integration setzt Integrität voraus: den Willen zur Zuwendung, sonst wäre sie ein reich sozialtechnisches Verfahren über die Köpfe der Menschen hinweg. Diese nehmen eine derartige Fremdbestimmung, so ist zu vermuten, auf Dauer nicht hin. Seit dem Sommersemester 2015 lehrt Christian Schüle Kulturwissenschaft an der Universität der Künste in Berlin.
Die Autoritären sind auf dem Vormarsch
Es herrscht Eile. So pflegen jetzt Autoritäre ihren Autoritarismus zu rechtfertigen. Alles sei dringlich inmitten der „Völkerwanderung“, wie die Neue Rechte warnt, und in Zeiten „schöpferischer Zerstörung“ (Joseph Schumpeter), wie Neoliberale verheißen. Roger de Weck fügt hinzu: „Im globalen Kulturkampf gegen islamische und afrikanische Massen kämpft das Abendland um sein Überleben. Im globalen Wirtschaftskampf sind alle Konzerne existenziell gefährdet.“ Jederzeit besteht „sofortiger Handlungsbedarf“. Das ist die Stunde der Autoritären. Die Dramatik der Verhältnisse untermauert ihre Kritik an der schwerfälligen Demokratie. Ausnahmezustände rechtfertigen es, die freie Debatte abzuwürgen und die Einwände kleinlicher „Bedenkenträger“ abzuschmettern. Die offene Gesellschaft lässt sich ganz und gar unkreativ zerstören. Wie viel Demokratie erträgt der Ultrakapitalismus? Sein Vordenker, der neoliberale Ökonom Milton Friedman, beriet 1975 den chilenischen Diktator Augusto Pinochet. Roger de Weck ist ein Schweizer Publizist und Ökonom.
Die Demokratie braucht guten Journalismus
Eine Demokratie funktioniert nur, wenn sie von einer Berichterstattung begleitet wird, welche die Wahrheit ans Licht bringt und die Sachverhalte in ihrer Komplexität darstellt. Das ist bei Weitem schwieriger als News-Reporting. Rolf Dobelli erläutert: „Was wir brauchen, sind zwei Arten des Journalismus. Zum einen investigativen Journalismus, der Fakten und Missstände aufdeckt. Zum anderen einen Journalismus, der das größere Bild beschreibt. Hintergründe und Erklärungen liefert, nennen wir es Erklärungspublizistik.“ Beide Arten von Journalismus sind schwierig. Beide sind teuer. Sie verlangen Meisterschaft auf Seiten der Produzenten und Konzentration aufseiten der Konsumenten. Und beide funktionieren schlecht im Format der News. Der Bestsellerautor Rolf Dobelli ist durch seine Sachbücher „Die Kunst des klaren Denkens“ und „Die Kunst des klugen Handelns“ weltweit bekannt geworden.
In der Demokratie geht die Herrschaft vom Volk aus
Auch wenn die Demokratie in vielerlei Gestalt auftritt, gibt es doch einen gemeinsamen Kern. Otfried Hoffe kennt ihn: „Dessen nähere Bestimmung kann man aus den drei Dimensionen mit insgesamt Gesichtspunkten aufbauen, wobei in der vollentwickelten Gestalt ein hohes Maß an Partizipation noch hinzukommt.“ Die erste legitimatorische Dimension ergänzt erstens einen formalen Gesichtspunkt, dass die Herrschaft von den Betroffenen ausgeht um zweitens den inhaltlichen Aspekt, dass sich die Herrschaft von jedem einzelnen Betroffenen und zusätzlich von der Gesamtheit rechtfertigen lässt. Zur formalen, herrschaftslegitimierenden kommt hier inhaltlich, als herrschaftsnormierende Demokratie, die universale Konsensfähigkeit dazu. Sie wird dort erfüllt, wo die Herrschaft als Gewährleistung der Freiheitsrechte jedem einzelnen und zusätzlich der Gesamtheit zugutekommt. Otfried Höffe ist Professor für Philosophie und lehrte in Fribourg, Zürich und Tübingen, wo er die Forschungsstelle Politische Philosophie leitet.
Der Faschismus war totalitär
Der Aufstieg politischer Regime mit dem Anspruch, das gesamte Leben der Bürger uneingeschränkt zu bestimmen und zu kontrollieren, zählt zu den bemerkenswertesten Kennzeichen des 20. Jahrhunderts. Der italienische Faschistenführer Benito Mussolini schrieb im Jahr 1932: „Alles ist im Staat beschlossen und nichts Menschliches oder Geistiges existiert außerhalb des Staates.“ In dieser Hinsicht erklärte er, sei der Faschismus totalitär. Der faschistische Staat dominiere als die Summe und Einheit aller Werte die Gesamtheit des Lebens. Christopher Clark stellt fest: „Liberale Kritiker des italienischen Regimes erkannten schon bald die Ähnlichkeiten zwischen Mussolinis System und dem kommunistischen Regime in Russland.“ Amerikanische Politologen erkannten bei der Betrachtung der neuen europäischen Regime – seien sie stalinistisch, faschistisch oder nationalsozialistisch – eine qualitativ neue Form der Politik. Christopher Clark lehrt als Professor für Neuere Europäische Geschichte am St. Catharine`s College in Cambridge.
Gute Eliten dienen den anderen
Gute Regierungen dienen den Regierten, schlechte Regierungen dienen sich selbst. Oder – frei nach William Shakespeare – dienen oder sich bedienen: Das ist hier die Frage. Katja Gentinetta stellt fest: „Mit diesen wenigen Sätzen ist das Qualitätskriterium für Eliten eigentlich schon umrissen. Platon hat es formuliert, Aristoteles hat es ausgeführt und systematisiert.“ Genauso gilt: Gute Eliten dienen den anderen beziehungsweise allen, schlechte Eliten dienen sich selbst. Nach der Wahrnehmung von Katja Gentinetta ist dieses Kriterium weitgehend außer Blick geraten, ja verloren gegangen. Aktuell herrscht eine „Gleichmachergesellschaft“, die zwar begrüßenswerter Weise ein Produkt der fortschreitenden Demokratisierung ist, jedoch zu Überschießen neigt. Dieser Entwicklung ist es geschuldet, dass ein Qualitätskriterium für Eliten weitgehend verschwunden ist. Dr. Katja Gentinetta ist Politikphilosophin, Publizistin und Lehrbeauftragte an den Universitäten St. Gallen, Zürich und Luzern.
Ängste sind in Deutschland weit verbreitet
Der bayerische Kulturpolitiker Dieter Sattler beschriebt im Jahr 1947 in den „Frankfurter Heften“ die Angst als eine „deutsche Krankheit“, als nationale Pathologie: „Unser Volk hat beinahe vor allem Angst. Es ist seelisch schwer erkrankt.“ Dieter Sattler war überzeugt, dass „jeder, der uns von der Angst heilt, Deutschland ernstlich heilt. Demokratie war für ihn gleichbedeutend mit der „Freiheit vor der Angst“. Frank Biess ergänzt: „Der Erfolg der Demokratie im Nachkriegsdeutschland hing demnach von der Überwindung der Angst ab.“ Die Geschichte der Bundesrepublik ist also auch eine Geschichte ihrer Ängste. Dieter Sattlers Beobachtungen waren nur eine von vielen ähnlichen Diagnosen einer tiefen Unsicherheit und Angst in der Nachkriegsgesellschaft. Frank Biess ist Professor für Europäische Geschichte an der University of California, San Diego.
Der Fundamentalismus fußt auf einer großen Lüge
Fundamentalismus ist eine Reaktion. Nämlich auf die Moderne und auf die Ideen der Globalisierung, die mit ihrer stetigen Ausbreitung die traditionellen Ideen und Machtstrukturen bedrohen. Die Moderne und die Globalisierung bringen Fragen und Zweifel hinsichtlich der Heiligen Schriften und ihrer exklusiven Mittler mit sich. Damit lösen sie Reaktionen aus. Eine davon ist die Integration von religiösen Ideen und Moderne. Nadav Eyal fügt hinzu: „Eine andere Reaktion ist die Ablehnung jeglicher derartiger Verquickungen und die Behauptung, nur Extremismus schütze vor Verfall.“ Der Fundamentalismus fußt auf einer gigantischen Lüge. Denn er setzt nicht den geistigen Weg des Propheten Mohammed oder irgendeines anderen Propheten fort. Der Fundamentalist erfindet Auslegungen, Geschichten oder Traditionen. Diese präsentiert er als altüberkommene religiöse Grundsätze. Nadav Eyal ist einer der bekanntesten Journalisten Israels.
Die Demokratie ist in Gefahr
Die Demokratie durchlebt gefährliche Zeiten. Die Gefahr erkennt man in zunehmender Fremdenfeindlichkeit und wachsender öffentlicher Unterstützung für autokratische Gestalten. Diese testen die Grenzen demokratischer Normen aus. Das ist an sich schon beunruhigend. Michael J. Sandel warnt: „Ebenso alarmierend ist jedoch die Tatsache, dass Parteien und Politiker der Mitte kaum verstehen, welche Unzufriedenheit die Politik in aller Welt in Aufruhr versetzt.“ Manche prangern das Anschwellen des Populismus als wenig mehr denn eine rassistische, fremdenfeindliche Reaktion auf Immigranten und Multikulturalismus an. Ander betrachten ihn vorwiegend in ökonomischen Begriffen. Nämlich als Protest gegen den Verlust von Arbeitsplätzen, den der globale Handel und neue Technologien mit sich bringen. Michael J. Sandel ist ein politischer Philosoph, der seit 1980 in Harvard lehrt. Er zählt zu den weltweit populärsten Moralphilosophen.
Die Globalisierung verdichtet Räume
In dem Maße, in dem sich die Welt durch Digitalisierung vergrößert, kehrt Heimat in den philosophischen und politischen Diskurs über die Frage nach Zugehörigkeit in Zeiten permanenter Migration. Christian Schüle stellt fest: „Globalisierung hat Räume vergrößert und zugleich verdichtet; je globalisierter die Welt gerät, desto kleingeistiger wird sie gedacht.“ Auffällig ist, dass kleine, relativ bevölkerungsarme, oft von vielen Anrainern umgebene Länder zu einer Inwendigkeit mit Außenverschluss neigen: die Schweiz, Österreich, Ungarn, Polen, die Slowakei – Länder, die man im Laufe der Menschheitsgeschichte oftmals überrollte und zur Disposition stellte. Durchgangsländer, deren Identität immer dem vorgegebenen Narrativ des Eroberers entsprach. Die Reaktionen auf den drohenden Verlust der Heimat verstärken sich in starkem Maße. Seit dem Sommersemester 2015 lehrt Christian Schüle Kulturwissenschaft an der Universität der Künste in Berlin.
Der Kommunismus ist untergegangen
Das „Kommunistische Manifest“ von Karl Marx und Friedrich Engels aus dem Jahre 1848 beginnt bekanntlich mit den Worten: „Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst des Kommunismus.“ Heinz Bude erläutert: „Es sieht einen Endkampf zwischen Bourgeoise und Proletariat vor Augen.“ Das Manifest verspricht, dass dieser bald versteckte, bald offene Kampf mit einer revolutionären Umgestaltung der ganzen Gesellschaft enden wird. Ansonsten gibt es nur den gemeinsamen Untergang der kämpfenden Klassen. Der Kommunismus ist im 20. Jahrhundert auf- und untergegangen. Auch die Rebellion von 1968 ist nach fünfzig Jahren endgültig Geschichte geworden. Dennoch ist das Gespenst des Kommunismus heute wieder unterwegs. Heinz Bude studierte Soziologie, Philosophie und Psychologie. Seit dem Jahr 2000 ist er Inhaber des Lehrstuhls für Makrosoziologie an der Universität Kassel.
Populisten glauben nicht an ihre eigene Rhetorik
Woran kann man populistische Parteien erkennen? Der Politikwissenschaftler Jan-Werner Müller antwortet: „Linke und rechte Politiker verwandeln sich in Populisten, wenn sie behaupten, das wahre, echte und einzige Volk zu repräsentieren.“ Diese Aussage enthält drei Teilaspekte. Erstens die Idee einer korrupten Elite, die nicht zum wahren Volk gehört. Zweiens die Idee eines homogenen Volkswillens, den nur der Populist vertreten kann. Und drittens Antipluralismus, also die Idee einer homogenen Wählerschaft. Philipp Hübl ist da anderer Ansicht: „Bei genauer Betrachtung jedoch sind die Teilelemente der Analyse fraglich. Erstens glauben weder die Populisten an ihre eigene Rhetorik noch ihre Wähler.“ Die Alternative für Deutschland (AfD) positioniert sich beispielsweise gegen alle anderen Parteien, die über 80 Prozent der Wähler repräsentieren. Philipp Hübl ist Philosoph und Autor des Bestsellers „Folge dem weißen Kaninchen … in die Welt der Philosophie“ (2012).
Die homogene Gesellschaft ist eine Illusion
Die Deutschen leben in einer pluralisierten Gesellschaft. Das ist nicht nur ein relativ neues Faktum. Das ist auch ein unhintergehbares Faktum: Es gibt keinen Weg zurück in eine nicht-pluralisiert, in eine homogene Gesellschaft. Isolde Charim erklärt: „Um die Reichweite und das ganze Ausmaß der Neuheit zu ermessen, muss man sich den „prä-pluralen“ Gesellschaften, also den Gesellschaften Westeuropas vor ihrer Pluralisierung zuwenden.“ Denn diese geben das Vergleichsmodell ab. Diese homogenen Gesellschaften, also diese Gesellschaften einer relativen ethischen, religiösen und kulturellen Einheitlichkeit sind gewissermaßen die Negativfolie. Der Hintergrund, von dem sich die heutige, pluralisierte Gesellschaft abhebt. Diese homogenen Gesellschaften waren nicht einfach da. Sie sind nicht einfach gewachsen, sozusagen natürlich. Die Philosophin Isolde Charim arbeitet als freie Publizistin und ständige Kolumnistin der „taz“ und der „Wiener Zeitung“.
Kriege führten früher nur Staaten
Es ist für Herfried Münkler nicht die Anzahl der Kriege, die sich in jüngster Zeit signifikant geändert hat, und es sind auch nicht die bloßen Zahlen der im Rahmen von Kriegshandlungen Getöteten und Verstümmelten, die zu gesteigerter Sorge Anlass geben. Vielmehr ist es die Art der Kriege, die größte Aufmerksamkeit fordert. Die neuen Kriege zeichnen sich dadurch aus, dass die Staaten nicht länger die Monopolisten des Krieges sind. Sondern substaatliche Akteure, Warlords, Netzwerkorganisationen und so weiter führen Kriege und bestimmen weitgehend die Rhythmik des Kriegsgeschehens. Dadurch ist die Politik der Kriegsvermeidung und Friedensicherung sehr viel schwieriger geworden, als dies in Zeiten der Fall war, da es sich bei Kriegen um eine wesentlich zwischenstaatliche Angelegenheit handelte. Prof. Dr. Herfried Münkler ist Professor für Theorie der Politik an der Humboldt-Universität in Berlin.
Grenzkontrollen sind staatliche Machtpolitik
In der heutigen globalen Staatengesellschaft ist das Europa der offenen Grenzen ein Sonderfall. Mit den Worten von Hans-Peter Schwarz könnte man auch sagen: „Es war und ist ein Großexperiment mit höchst ungewissem Ausgang.“ Der völkerrechtliche Normalfall sind nicht offene Staatsgrenzen, sondern mehr oder weniger wachsam kontrollierte Landesgrenzen. Immer noch ist ein Staat mit Territorialhoheit und allein von ihm selbst kontrollierten Grenzen der Regelfall. Auf diesen haben sich die rund 200 Mitglieder der Staatengesellschaft mit ihren heterogenen Regimen geeinigt. Nach den schrecklichen Erfahrungen, welche die Völker Europas in endlosen Kriegen um Territorien – und damit auch um die geheiligten Staatsgrenzen – gemacht hatten, war es kein Wunder, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die Vision eines Europas ohne Grenzen an Strahlkraft gewann. Hans-Peter Schwarz zählt zu den angesehensten Politologen und Zeithistorikern in Deutschland.
Fundamentalisten kämpfen gegen die Globalisierung
Der Fundamentalist ist eine Erscheinung der Gegenwart. Er bedient sich moderner Mittel, um die Moderne selbst auszulöschen. Die Fundamentalisten verschmähen kein Werkzeug der Globalisierung, inklusive Hollywood. In der fundamentalistischen Globalisierung gibt es für ihre Anhänger eine herzerwärmende patriarchische Hierarchie. Nadav Eyal stellt fest: „Seltsamerweise lehnen Fundamentalisten den Universalismus nicht ab. Sie betrachten liberale, universale Ideen vielmehr als Konkurrenz zu ihrer eigenen universalen Agenda.“ Fundamentalismus und Globalisierung sind nicht Materie und Antimaterie, sondern zwei Seiten einer Medaille. Fundamentalisten betrachten sich selbst als die würdigsten und tödlichsten Bannerträger im Kampf gegen die Globalisierung. Die große Stärke des Fundamentalisten liegt in seiner Entschlossenheit, ein apokalyptisches Szenario selbst gezielt herzustellen. Das Ziel ist eine Prophetie, die sich selbst erfüllt. Nadav Eyal ist einer der bekanntesten Journalisten Israels.
Wolfgang Ischinger verbreitet Optimismus
Trotz der vielen Krisen überall auf der Welt, gibt es durchaus Grund zum Optimismus. Wolfgang Ischinger erläutert: „Denn nimmt man einmal ein wenig Abstand von den tagesaktuellen Nachrichten und versucht, das große Ganze in den Blick zu nehmen, bietet sich das Bild einer Menschheit, die immer friedlicher, aber auch gesünder und reicher geworden ist.“ Dieses Bild, so betonte der Harvard-Professor Steven Pinker immer wieder, zeigt, dass sich die Menschheit insgesamt in die richtige Richtung bewegt. Steven Pinkers Optimismus wird durch wichtige aktuelle Kennzahlen gestützt. Egal wie oft man in den Nachrichten von Kriegen und Kriegsopfern hört und liest, Fakt ist: Die globalen Opferzahlen sind in den Jahrzehnten seit dem Zweiten Weltkrieg deutlich zurückgegangen. Wolfgang Ischinger ist Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz und einer der renommiertesten deutschen Experten für Außen- und Sicherheitspolitik.
Die Demokratie entspricht oft nicht dem Idealbild
Zwei Aspekte übersieht man bei einem oberflächlichen Verständnis der Demokratie gerne. Auch die Demokratie bedarf der Rechtfertigung. Diese ist von einer qualifizierten, konstitutionellen Demokratie überzeugender als von einer simplen Volksherrschaft zu erwarten. Otfried Höffe betont: „Die konstitutionelle Demokratie dürfte sogar zu den größten kulturellen Innovationen der Menschheit gehören.“ Mit den konstitutionellen Elementen kommt freilich eine Spannung in den Demokratiebegriff. Eine Rechtfertigung benötigt auch die Demokratie. Denn auch sie verzichtet nicht die Kerngrammatik des Zusammenlebens, nämlich auf ein zwangsbefugtes Recht. Deswegen hat sie einen Herrschaftscharakter, der der Rechtfertigung bedarf. Offensichtlich fällt diese leichter, wenn die Herrschaft die Betroffenen selbst ausüben. Das im Westen gelebte Votum für die Demokratie ist deshalb berechtigt. Hinsichtlich der Rechtfertigung von Herrschaft gibt es keine ernsthafte Alternative. Otfried Höffe ist Professor für Philosophie und lehrte in Fribourg, Zürich und Tübingen, wo er die Forschungsstelle Politische Philosophie leitet.
Clemens Fuest analysiert die Exit-Debatte
Die aktuellen Kontaktbeschränkungen in Deutschland verstärken psychische Krankheiten Wie Depressionen. Häusliche Gewalt und andere soziale Probleme nehmen zu. Menschen, die sich in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht sehen, werden oft krank. Clemens Fuest erläutert: „Die Kosten des Shutdowns gehen außerdem weit über den Ausfall von Produktion und Wertschöpfung im engeren Sinne hinaus.“ Durch die Schließung von Schulen und Kindergärten unterbleiben Investitionen in die Bildung. Die in Deutschland ohnehin ausgeprägte Ungleichheit der Bildungschancen verschärft sich. Zu Hause statt in der Schule zu lernen, fällt Kindern aus bildungsfernen Milieus deutlich schwerer als anderen. Darüber hinaus kann ein leistungsfähiges Gesundheitssystem mittelfristig nur auf der Basis einer funktionierenden Wirtschaft bestehen. Aus all diesen Gründen besteht die Aufgabe des Krisenmanagements in der Pandemie nicht darin, entweder der Gesundheit oder der Wirtschaft Priorität einzuräumen. Clemens Fuest ist seit April 2017 Präsident des ifo Instituts.
Noam Chomsky plädiert für zivilen Ungehorsam
Auf die Frage, was er von zivilem Ungehorsam hält, von Aktionen, bei denen man sich beispielsweise irgendwo ankettet und dann dafür vielleicht eingesperrt wird, antwortet Noam Chomsky: „Ich habe mich selbst sehr häufig an solchen Aktionen beteiligt. War etliche Male im Gefängnis und musste zeitweise mit einer hohen Gefängnisstrafe rechnen.“ Er ist der Meinung, dass ziviler Ungehorsam eine legitime Taktik ist. Aber es kommt auf die Art und Weise an, wie man sie durchführt. Diese ist seiner Ansicht nach oft nicht legitim. Man praktiziert ihn oft als eine Art Zurschaustellung der eigenen Rechenschaft. Ein Mensch nimmt das Risiko auf sich, weil sein Gewissen, sein Verhältnis zu Gott oder was auch immer ihm das befehlen. Aber auf die Folgen seiner Aktion kommt es nicht an. Noam Chomsky ist Professor emeritus für Sprachwissenschaft und Philosophie am Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.).
Die Redefreiheit ist ein Recht für jedermann
„Wir – alle Menschen – müssen in der Lage und befähigt sein, frei unsere Meinung zu äußern und ohne Rücksicht auf Grenzen, Informationen und Ideen zu suchen, zu empfangen und mitzuteilen.“ Dieses Prinzip ist für Timothy Garton Ash diejenige Freiheit, von der alle anderen Freiheiten abhängen. Die Fähigkeit zu sprechen unterscheidet den Menschen von anderen Tieren und von allen bislang erfundenen Maschinen. Nur wenn man seine Gedanken und Gefühle voll und ganz ausdrücken kann, kann man sein Menschsein voll und ganz realisieren. Nur wenn man seine Mitmenschen sehen und hören kann, kann man wirklich verstehen, was es heißt, ein anderer zu sein. Timothy Garton Ash ist Professor für Europäische Studien an der Universität Oxford und Senior Fellow an der Hoover Institution der Stanford University.