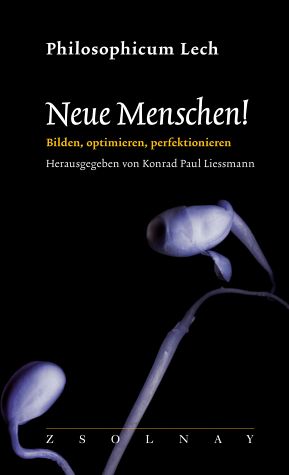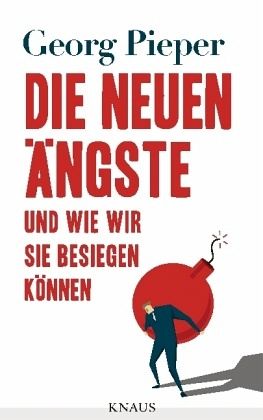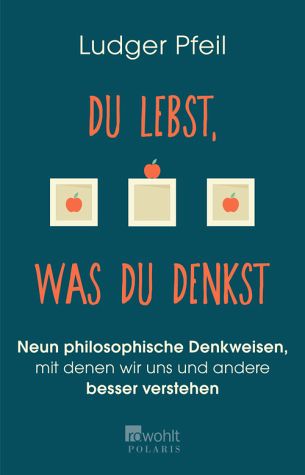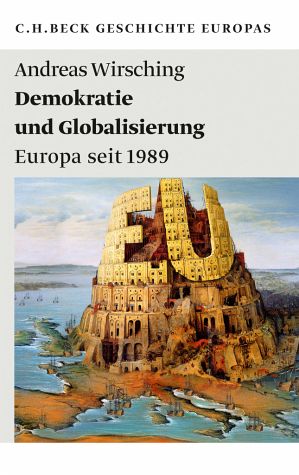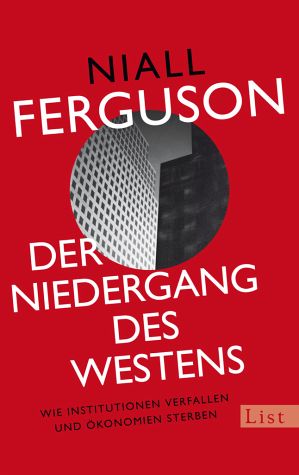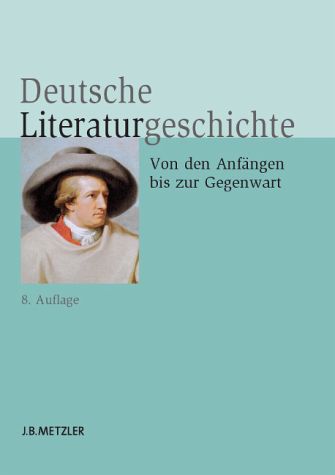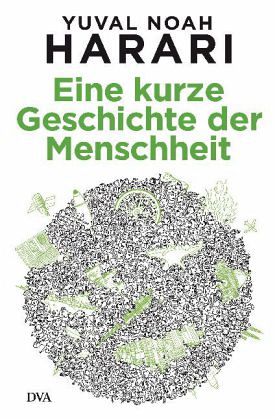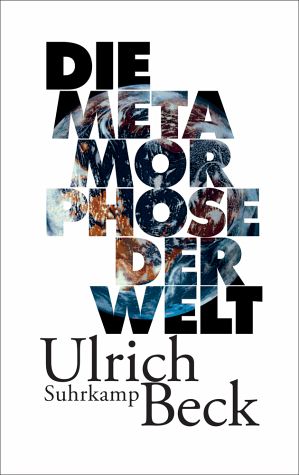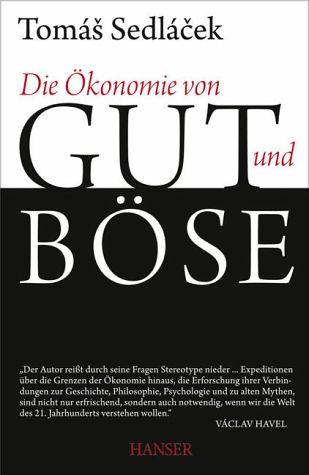Gesunde Angst ist ein Mechanismus des Schutzes, der das Überleben eines Menschen sichert. Sie warnt und hält einen davon ab, unverantwortliche Risiken einzugehen. Georg Pieper ergänzt: „Zugleich mobilisiert Angst Kräfte, um eine Gefahrensituation zu überstehen und etwa bei einer Schlägerei oder einem Hausbrand schnell weglaufen zu können.“ Aber es gibt eben auch übertriebene Angst, die einen Menschen nicht schützt, sondern im Gegenteil eher Probleme macht. Sie hat einen negativen Einfluss auf das Lebensgefühl und die Lebensgestaltung, und sie vergiftet das Klima in der Gesellschaft. Dieser Angst sollte man deshalb nicht die Macht über sein Denken und Handeln überlassen, sondern dafür sorgen, dass sie von Stärke, Selbstbewusstsein, positiven Gefühlen und Zuversicht gelenkt werden. Dr. Georg Pieper arbeitet als Traumapsychologe und ist Experte für Krisenintervention.
Das Klima formt Köper und Geist
Abgeleitet von κλίνω – das griechische Wort für neigen – meint Klima zunächst einmal nicht mehr und nicht weniger als den Einfallswinkel der Sonne an einem gegebenen Ort. Klima ist also ursprünglich, bei Eratosthenes, Hipparchos und Aristoteles, eine geographische Kategorie, ein Breitengrad. Eva Horn fügt hinzu: „Es bezeichnet Zonen oder, mit einem Ausdruck des 18. … Weiterlesen