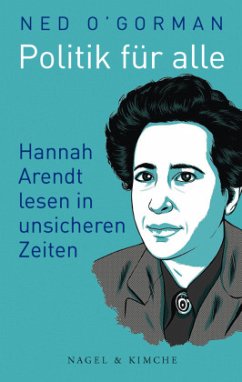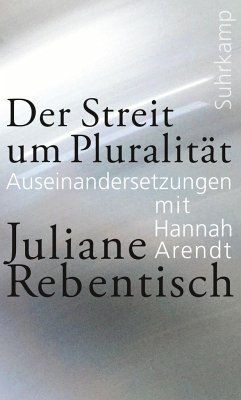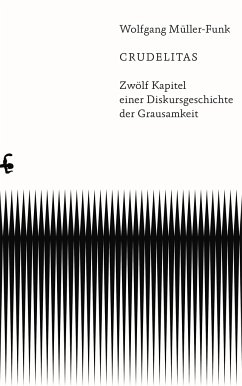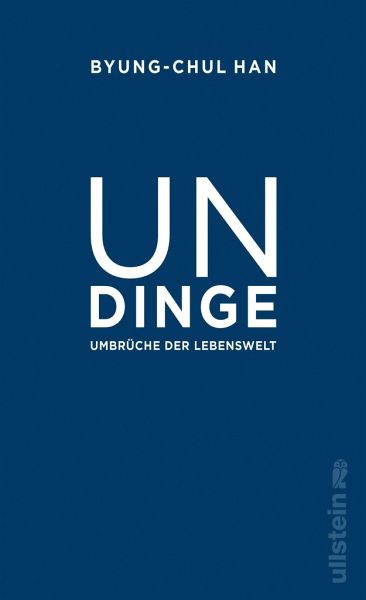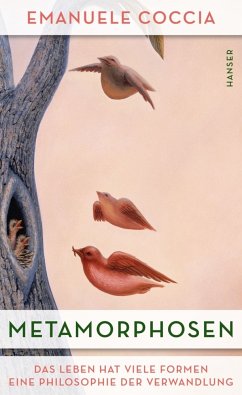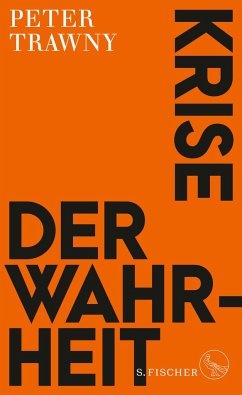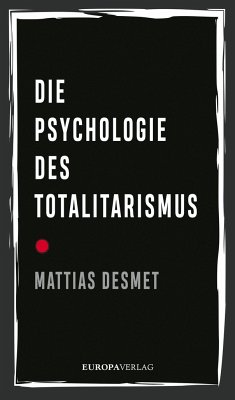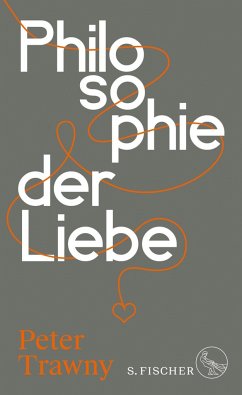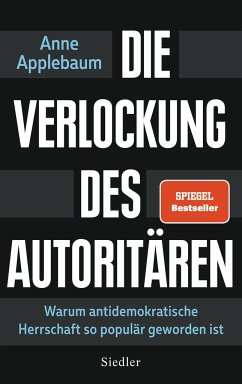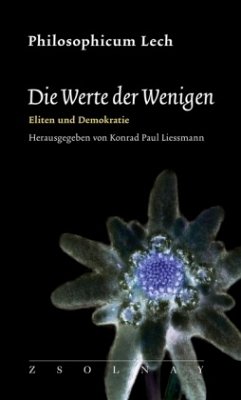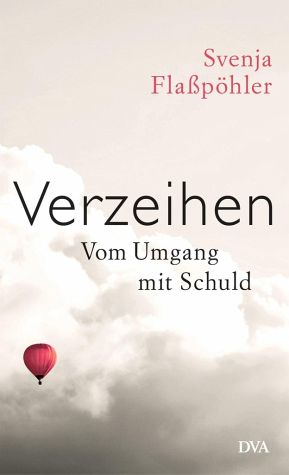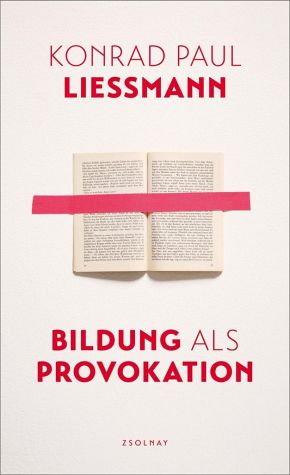Ned O’ Gorman kritisiert politische Kurzsichtigkeit, Malaise und Missgunst. In seinem Buch „Politik für alle“ plädiert er nicht für ein Weniger, sondern für ein Mehr an Politik. Und er fordert, die Politik ernster zu nehmen, statt sie abzuschreiben und ihr eine wohlüberlegte Chance zu geben. Zu diesem Zweck untersucht Ned O’ Gorman das Werk einer der prononciertesten Fürsprecherin der Politik im 20. Jahrhundert: Hannah Arendt (1906 – 1975). Die in Deutschland geborene Jüdin floh in den 1930er-Jahren vor den Nazis und ließ sich in den Vereinigten Staaten nieder. Von nun an arbeitete sie dreißig Jahre lang an „Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft“, einer scharfen Analyse des Totalitarismus. Sie schrieb zudem viele andere Bücher und Artikel, deren Themen von der Revolution bis zur Verantwortung des Menschen für den Erhalt der Welt reichten. Ned O’ Gorman ist Professor für Kommunikationswissenschaften an der University of Illinois.
Hannah Arendt
Nicht selten verdunkelt sich der Raum der Öffentlichkeit
Heutzutage ist nicht nur eine Abkehr von der Wahrhaftigkeit, sondern auch von der Unterscheidung zwischen Wahrheit und Unwahrheit überhaupt, zu beobachten. Juliane Rebentisch stellt fest: „Die Effekte dieser Abkehr, die mit einer offiziellen Geringschätzung der Welt und der Öffentlichkeit einhergehen, sind dramatisch.“ Denn durch diese Geringschätzung wird nicht nur die Frage, ob etwas wahr oder unwahr ist, ersetzt durch die nach den eigenen Interessen.“ Eine solche Umstellung wird vielmehr die Gemeinsamkeit der Welt, in der allein ihr Bestand gewahrt werden kann, zerfallen lassen. Hannah Arendt schreibt: „In der Geschichte sind Zeiten, in denen der Raum der Öffentlichkeit verdunkelt und der Bestand der Welt fragwürdig wird, nicht selten.“ Juliane Rebentisch ist Professorin für Philosophie und Ästhetik an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach am Main.
Terror und Gewalt führen zu keiner stabilen Macht
Gewalt und Macht lassen sich mit Hannah Arendt dadurch unterscheiden, dass Erstere prozessual, dynamisch und zeitlich begrenzt ist. Letztere stellt dagegen eine strukturelle Größe dar, die dauerhaft, und, was fast dasselbe ist, institutionalisiert ist. Gewalt ist ein Komplement von Macht, insofern sie, wie Michel Foucault dargelegt hat, auf einem System von möglichen psychischen und/oder physischen Bestrafungen basiert, die gleichsam den symbolischen Horizont aller Macht bildet. Wolfgang Müller Funk ergänzt: „Das, was als politischer Körper bezeichnet wird, wäre gewissermaßen der Foucaultsche Aspekt des Zusammenhangs von Macht und Gewalt. Jenseits der Befunde des französischen Denkers besteht der Verdacht, dass keine Macht, die allein auf Terror und Gewalt beruht, dauerhaft stabil ist. Wolfgang Müller-Funk war Professor für Kulturwissenschaften in Wien und Birmingham und u.a. Fellow an der New School for Social Research in New York und am IWM in Wien.
Die Wahrheit stabilisiert das Leben der Menschen
Hannah Arendt hält wie Martin Heidegger an der terranen Ordnung fest. So beschwört sie oft Halt und Dauer. Byung-Chul Han fügt hinzu: „Nicht nur Weltdinge, sondern auch die Wahrheit haben menschliches Leben zu stabilisieren. Im Gegensatz zur Information besitzt die Wahrheit eine Festigkeit des Seins.“ Dauer und Beständigkeit zeichnen sie aus. Wahrheit ist Faktizität. Sie leistet jeder Veränderung und Manipulation Widerstand. So bildet sie das Fundament der menschlichen Existenz. Hannah Arendt schreibt: „Wahrheit könnte man begrifflich definieren als das, was der Mensch nicht ändern kann. Metaphorisch gesprochen ist sie der Grund, auf dem wir stehen, und der Himmel, der sich über uns erstreckt.“ Bezeichnenderweise siedelt Hannah Arendt die Wahrheit zwischen Erde und Himmel an. Die Bücher des Philosophen Byung-Chul Han wurden in mehr als zwanzig Sprachen übersetzt.
Hannah Arendt lehrt die „menschliche Bedingtheit“
Hannah Arendts Texte enthalten eine Art Grundkurs in Politik. Er basiert auf einigen Tatsachen, die man mit den fünf Sinnen und dem gesunden Menschenverstand begreifen kann. Ned O’ Gorman erläutert: „Zunächst fordert Arendt uns auf, unsere Grundsituation als Menschen in den Blick zu nehmen. Insbesondere die erste und wichtige Tatsache: dass nämlich du und ich und andere zusammen auf dieser Erde leben.“ Hannah Arendt bezeichnet dies als „menschliche Bedingtheit“. Es ist bedeutsam, dass Arendt ihr Nachdenken über Politik mit der conditio humana beginnt und nicht etwa mit der sogenannten „Natur des Menschen“. Viele andere bekannte Namen der politischen Philosophie der Moderne sahen das anders. Sie nahmen an, Politik sei in der einen oder anderen Weise eine Antwort auf und ein Umgehen mit dem Problem der „menschlichen Natur“. Ned O’ Gorman ist Professor für Kommunikationswissenschaften an der University of Illinois.
Grausamkeit sollte eigentlich unmöglich sein
Die Grausamkeit gehört für Friedrich Nietzsche zur ältesten Festfreude der Menschheit. Auf der anderen Seite sollte Grausamkeit eigentlich unmöglich sein. Denn es dürfte sie nicht geben, wo es menschlich zugehen soll. Wolfgang Müller-Funk weiß jedoch auch: „Wer sich mit der systematischen Quälerei anderer Menschen, Individuen oder Gruppen, beschäftigt, droht von ihr angezogen zu werden.“ Unmöglich ist die Grausamkeit aber ebenso, weil es schwer ist, sich unvoreingenommen mit ihr zu beschäftigen. Der Schrecken vor ihr führt leicht dazu, sie zu verkennen. Die Aussage, dass Grausamkeit unmenschlich ist, geht leicht von den Lippen. Doch die Entgegensetzung von „menschlich“ und „unmenschlich“ ist fragwürdig. Wolfgang Müller-Funk war Professor für Kulturwissenschaften in Wien und Birmingham und u.a. Fellow an der New School for Social Research in New York und am IWM in Wien.
Die Kirche begreift die Geburt als Wunder
Es gibt kaum Literatur zum Thema Geburt. Und wenn es welche gibt, drängt man sie an den Rand „erhabener“ Wissensbestände. Emanuele Coccia stellt fest: „Dafür sind bildliche Zeugnisse im Überfluss vorhanden und haben über die Jahrhunderte die Reflexionen rund um dieses Phänomen genährt.“ Tatsächlich zählt die Nativität zu den häufigsten Motiven der europäischen Malerei. Allerdings ist der Blick der Maler durch das theologische Prisma verzerrt. Die Geburt, die sie schildern, ist kein gewöhnliches, sondern ein einmaliges, nicht darstellbares und widernatürliches Ereignis. Die christliche Theologie hat dazu beigetragen, die Geburt zu etwas Undenkbarem zu machen. Denn sie ließ sie aus jeglichem naturalistischen Rahmen heraustreten, wusste sie gegen die Natur auszuspielen und begriff sie als Wunder. Emanuele Coccia ist Professor für Philosophiegeschichte an der École des Hautes Études en Sciences Sociales in Paris.
Sokrates verführte Bürger zur Philosophie
Sokrates wendet sich nicht im Namen einer vermeintlich höheren Wahrheit von den gewöhnlichen Sterblichen und ihren Meinungen ab. Sondern er legt in den Meinungen selbst ein Wahrheitspotenzial frei. Juliane Rebentisch weiß: „Seine Mäeutik, die sokratische Hebammenkunst, zwingt die Gegenüber im Gespräch dazu, ihre Meinungen im Spiegel anderer möglicher Sichtweisen zu betrachten und so auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen.“ Eben darin war Sokrates skandalös: dass er die gewöhnlichen Bürger zur Philosophie verführte. Mit dem Ergebnis, dass sich die „unbedarfte Sittlichkeit Athens“ zersetzte. So nannte Hegel das vorkritische Verhältnis der Athener zu den geltenden Gesetzen und Geboten. In seinen Augen ist das sokratische Prinzip jedoch von einem entscheidenden Mangel gekennzeichnet. Juliane Rebentisch ist Professorin für Philosophie und Ästhetik an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach am Main.
Die eine unabhängige Wahrheit gibt es nicht
Gotthold Ephraim Lessing war davon überzeugt, dass es die eine unabhängige Wahrheit nicht gibt. Sondern dass es Wahrheit nur durch den Vergleich der Perspektiven verschiedener Menschen geben kann. Denn im Streit der Meinungen, im Prozess des Austauschs von Gründen, ist es möglich, dass die jeweils perspektivischen Bestimmungen der Wahrheit an Allgemeinheit gewinnen. Dadurch werden sie mehr als subjektive, willkürliche Bestimmungen oder bloße Meinungen. Juliane Rebentisch erklärt: „Dennoch aber, und auch das war Lessing durchaus bewusst, kann keine Bestimmung der Wahrheit die Bedingung der Endlichkeit aufheben. Auch die jeweils als allgemein gültig akzeptierten Bestimmungen bleiben prinzipiell an die Möglichkeit ihrer Bestreitung ausgesetzt.“ Nichts, auch das, was sich als Wahrheit etablieren mag, ist vor dieser Möglichkeit sicher oder sollte es sein. Juliane Rebentisch ist Professorin für Philosophie und Ästhetik an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach am Main.
Hannah Arendt fordert die Kultivierung der Politik
Hannah Arendt fordert, dass die Menschen an der Praxis und Kultivierung der Politik arbeiten müssen. Denn man kann ihr nicht entgehen, so sehr man es auch versuchen möchte. Wirtschaft, Wissenschaft, Technik, Religion, Rasse oder individuelle Selbstverwirklichung können die Menschen nicht aus den Zwängen der politischen Verfasstheit befreien. Ebenso wenig eröffnen sie den Horizont des ewigen Fortschritts. Ned O’ Gorman stellt fest: „Die Auswirkungen dieser Möchtegernwelt ohne Politik auf das 20. Jahrhundert waren absolut katastrophal.“ Der Anspruch auf eine historische Bestimmung der arischen Rasse brachte den Holocaust hervor. Die Anforderungen der sowjetischen Kollektivierung endeten im Gulag. Der Vorrang der Physik über die Politik führte zur Atombombe. Und die „Eroberung der Märkte“ verursachte Bürgerkriege in Zentral- und Südamerika. Ned O’ Gorman ist Professor für Kommunikationswissenschaften an der University of Illinois.
Bestimmte Wahrheiten gelten überall
Es gibt scheinbar Wahrheiten, die gelten für jedermann überall. Das haben Philosophen schon früh festgestellt. Peter Trawny blickt zurück: „So jemand wie Platon hat davon gesprochen, dass es „Ideen“ gebe, die uns die Wahrnehmung und Erkenntnis von konkreten Dingen und Tatsachen ermöglichen.“ Menschen müssen schon wissen, was schön ist, bevor sie etwas als schön bezeichnen können. Dabei geht es nicht darum, ob das jeweils Besondere, das ein Mensch für schön hält, ebenso von einer anderen Person für schön gehalten wird. Es geht vielmehr darum, dass jeder Mensch Schönheit kennt –, was immer er im Einzelnen schön findet. Aus diesen scheinbar universellen Wahrheiten hat man dann auch in moralischer und politischer Hinsicht Konsequenzen gezogen. Peter Trawny gründete 2012 das Matin-Heidegger-Institut an der Bergischen Universität in Wuppertal, dessen Leitung er seitdem innehat.
Mattias Desmet erforscht die Psychologie des Totalitarismus
In seinem neuen Buch „Die Psychologie des Totalitarismus“ analysiert Mattias Desmet unter andere den psychologischen Prozess der Massenbildung. Dadurch kann er die geradezu verblüffenden Merkmale einer totalisierten Bevölkerung verstehen. Ein Kennzeichen besteht in der radialen Bereitschaft der Individuen, ihre persönlichen Interessen aus Solidarität mit dem Kollektiv – das heißt mit der Masse – zu opfern. Ein weiteres Merkmal ist die Intoleranz gegenüber dissidenten Stimmen und die Empfänglichkeit für absurde – pseudowissenschaftliche – Indoktrination und Propaganda. Matthias Desmet erklärt: „Massenbildung ist im Grunde eine Form von Gruppenhypnose, die Individuen jeglicher Fähigkeit zu kritischer Distanz und ethischem Bewusstsein beraubt. Dieser Prozess ist schleichend; eine Bevölkerung fällt ihm arglos zum Opfer.“ Mattias Desmet ist Professor für Klinische Psychologie an der Abteilung für Psychoanalyse und klinische Beratung der Universität Gent.
Liebe berührt eine Person im Innersten
Liebe ist ein wichtiger Teil der Intimität eines Menschen. Das, was eine Person im Innersten berührt, was sie im Innersten mit sich selbst und dem oder der Geliebten auszuhandeln haben, entzieht sich der öffentlichen Welt von Arbeit und Unterhaltung. Obwohl Intimität nicht schon mit dem Privaten übereinstimmt, möchte Peter Trawny zunächst einräumen, dass alles, „was unsere Liebe betrifft, unter uns bleibt“. Hannah Arendt hat das vielfach behauptet. Die „Eigenschaften des Herzens“ bedürfen der „Dunkelheit und des Schutzes gegen das Licht der Öffentlichkeit.“ Nur so können sie sich entfalten und bleiben was sie sind. Nämlich die innersten, verborgenen Antriebe, die sich zur öffentlichen Schaustellung nicht eignen. Peter Trawny gründete 2012 das Matin-Heidegger-Institut an der Bergischen Universität in Wuppertal, dessen Leitung er seitdem innehat.
Die Weltordnung justiert sich neu
Das Philosophie Magazin Nr. 04/2022 stellt im Titelthema die Frage „Wohin steuert die Geschichte?“ Die Antworten darauf sind vielfältig und beschäftigen Philosophen von der Antike bis zur Gegenwart. Jetzt da der Ukrainekrieg die Welt in große Ungewissheit stürzt und die Weltordnung sich neu justiert, ist sie drängender denn je. Es gibt eine Disziplin, die seit jeher versucht, Gesetze im Gang der Geschichte zu erkennen. Chefredakteurin Svenja Flaßpöhler kennt sie: „Die Geschichtsphilosophie ist es, die versteckte Logiken aus der scheinbaren Willkür herauspräpariert, um die menschliche Gattung in einen überwölbenden Gesamtkontext zu stellen.“ Wird Hegel recht behalten? Ist der Krieg eine dialektische Volte, die den Pfad des Fortschritts schlussendlich vorantreiben wird. Friedrich Nietzsche dagegen ging von einen zyklischen Geschichtsverlauf aus: Dann wäre der Krieg die Wiederkehr des Immergleichen, aus dem es kein Entrinnen gibt.
Der totalitäre Mensch ist radikal isoliert
Die Philosophin Hannah Arendt war eine der Ersten, die sich mit dem Totalitarismus auseinandersetzte. Sie beschrieb die „totalitäre Persönlichkeit“ als radikal isolierte Menschen, deren Bindung weder an die Familie noch an Freunde, Kameraden oder Bekannte einen gesicherten Platz in der Welt garantiert. Dass es überhaupt auf der Welt ist und in ihr einen Platz einnimmt, hängt für ein Mitglied der totalitären Bewegung ausschließlich von seiner Mitgliedschaft in der Partei und der Funktion ab, die sie ihm zugeschrieben hat. Anne Applebaum ergänzt: „Theodor W. Adorno, der vor den Nationalsozialisten in die USA geflohen war, vertiefte den Gedanken weiter. Unter dem Einfluss von Sigmund Freud suchte er die Ursprünge der autoritären Persönlichkeit in der frühen Jugend, etwa gar in unterdrückten homosexuellen Neigungen.“ Anne Applebaum ist Historikerin und Journalistin. Sie arbeitet als Senior Fellow an der School of Advanced International Studies der Johns Hopkins University.
Hannah Arendts Denken ist aktueller denn je
In ihrem neunen Buch „Der Streit um Pluralität setzt sich Juliane Rebentisch mit der politischen Philosophie Hannah Arendts auseinander. Es besteht für die Autorin kein Zweifel, dass die Schriften von Hannah Arendt heute nicht zuletzt aufgrund ihrer Aktualität ihrer Themen wieder mit großem Interesse liest. Schonungslos beschreibt sie die Unzumutbarkeiten von Flucht und Staatenlosigkeit. Ihre eindrücklichen Überlegungen zum Verhältnis von Politik und Wahrheit haben Eingang in die öffentlichen Debatten der Gegenwart gefunden. Hannah Arendt Leben war bekanntlich geprägt durch die Erfahrungen von Antisemitismus, Staatsterror, Flucht und Staatenlosigkeit. Juliane Rebentisch betont: „Die geistesgeschichtliche Bedeutung Hannah Arendts bemisst sich nicht zuletzt an den zum Teil heftigen Kontroversen, die ihre Publikationen in der Öffentlichkeit auslösten.“ Juliane Rebentisch ist Professorin für Philosophie und Ästhetik an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach am Main.
Die Wahrheit ist in großer Gefahr
Es tobt eine Riesenschlacht um die Wahrheit. Es gibt Fake News, alternative Fakten, Verschwörungstheorien, die Lügenpresse und ein postfaktisches Zeitalter. Die Öffentlichkeit wird erschüttert von Schlagworten und Diskussionen um alles oder nichts. Peter Trawny warnt in seinem neuen Buch „Krise der Wahrheit“: „Die Situation ist unübersichtlich. Es droht ein allgemeiner Orientierungsverlust. Alles weist darauf hin, dass es einen gefährlichen Anschlag auf die Wirklichkeit gibt, eine Krise der Wahrheit.“ Aus unsichtbaren Informationskanälen bricht ein Virus hervor und vergiftet die Gesellschaft. Ein Streit um die Deutungshoheit der Wahrheit ist unvermeidbar. Der Naturwissenschaft liegen Regeln zugrunde, die alle kennen können und wenig Anlass zu Misstrauen bieten. Die Frage wäre also, warum man diese Regeln zu ignorieren versucht. Peter Trawny gründete 2012 das Matin-Heidegger-Institut an der Bergischen Universität in Wuppertal, dessen Leitung er seitdem innehat.
Glück sollte das Endziel des politischen Lebens sein
Ned O’Gorman beschreibt in seinem neuen Buch „Politik für alle“ das Denken von Hannah Arendt. Er bewegt sich dabei zwischen einer Einführung in ihre Arbeit und den Werken anderer wichtiger politischer Denker. Der Autor verteidigt dabei engagiert die Politik im Zeitalter der politischen Erschöpfung. Im Vorwort schreibt Ned O’Gorman: „Dieses Buch handelt vom Glück.“ Viele Menschen kennen die Redewendung vom „Streben nach Glück“. Sie war und ist revolutionär. Für die Unterzeichner der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung und die Menschen, die sie vertraten, war Glück das Ziel des politischen Lebens. Heute ist fast niemand mehr daran gewöhnt, Politik mit Glück zu verbinden. Viel eher assoziiert man sie mit negativen Gefühlen wie Elend, Depression, Apathie, Empörung oder Wut. Ned O’Gorman ist Professor für Kommunikationswissenschaften an der University of Illinois.
Wahr und falsch sind kaum mehr zu unterscheiden
In seinem neuen Buch „Undinge“ vertritt Byung-Chul Han die These, dass die rapide steigende Informationsflut die Menschen in eine postfaktische Gesellschaft stürzt. In vielen Fällen ist sogar die Unterscheidung zwischen wahr und falsch aufgehoben. Informationen zirkulieren nun ohne jeden Realitätsbezug in einem hyperrealen Raum. Byung-Chul Han stellt fest: „Die Welt wird zusehends unfassbarer, wolkiger und gespenstischer.“ Schon vor Jahrzehnten stellte der Medientheoretiker Vilém Flusser fest, dass Undinge von allen Seiten in die Umwelt der Menschen eindringen. Weil sie die Dinge verdrängen, nennt man sie Undinge. Byung-Chul Han entwickelt in „Undinge“ sowohl eine Philosophie des Smartphones als auch eine Kritik der künstlichen Intelligenz aus ungewohnter Perspektive. Byung-Chul Han ist ein koreanisch-deutscher Philosoph, Kulturwissenschaftler und Autor. Seine Bücher wurden in mehr als zwanzig Sprachen übersetzt.
Oft bildet die Nacht den eigentlichen Liebesraum
Liebe geschieht an einer Schwelle. Begrüßung und Abschied, Nacht und Tag, Innen und Außen. In Liebesgeschichten ist es oft die Nacht, die den eigentlichen Liebesraum bildet. Die Nacht ist das Innen einer Berührung, die den Unterschied von Innen und Außen wiederholt und weitertreibt. Peter Trawny fügt hinzu: „Am Ende will die Romantische Liebe in ihr verschwinden, sich auflösen in unendliches Dunkel. Dieses Innen und Außen, seine Landschaft, die den Körper mit umfasst, ist die Landschaft der Liebe.“ Von Anfang an hat sie sich in die Tragödien, Gedichte, Gemälde und Filme eingeschrieben. Stets geht es um ein Hinein- und Herauskommen, um Räume und Orte, die dieser Bewegung entsprechen. Peter Trawny gründete 2012 das Martin-Heidegger-Institut an der Bergischen Universität in Wuppertal, das er seitdem leitet.
Das Böse ist eine spezielle Form der Blindheit
Es gibt das konzentrierte Bestreben zur Nivellierung der Urteilskraft und damit auch die Gleichmachung jeder Individualität. Dies geschieht im Namen eines stets werthaft überhöhten und letztlich anonymen Kollektivs. Das nennt Ayn Rand nun im eigentlichen Sinne „böse“. Wolfram Eilenberger erklärt: „Denn es ist aus ihrer Sicht ein Streben, das sich mit destruktivster sozialer Macht gegen all das wendet, was unsere Lebensform eigentlich gelingend und lebenswert macht.“ Das Böse ist also nicht eine metaphysische Kraft, ein transzendentes Prinzip oder ein ewiges „Nein“. Sondern es ist eine von anderen Menschen gezielt erzeugte und erwünschte Unfähigkeit, relevante Unterschiede auch als solche zu erkennen und vor allem anzuerkennen. Wolfram Eilenberger war langjähriger Chefredakteur des „Philosophie Magazins“, ist „Zeit“-Kolumnist und moderiert „Sternstunden der Philosophie im Schweizer Fernsehen.
Anne Applebaum kennt die Verlockung des Autoritären
In ihrem neuen Buch „Die Verlockung des Autoritären“ beantwortet Anne Applebaum die Frage was die Rückkehr zu autoritären Herrschaftsformen für viele Menschen so erstrebenswert macht. Dabei zeigt sie, welche Rolle dabei die sozialen Medien, Verschwörungstheorien und Nostalgie spielen. Sie unternimmt einen Streifzug durch die westliche Welt, die sich auf erschreckender Weise nach einer harten Hand und einem starken Staat sehnt. Zu in diesem Buch beschriebenen Menschen gehören nationalistische Ideologen genauso wie hochgesinnte politische Essayisten. Die einen verfassen anspruchsvolle Bücher, andere lancieren Verschwörungstheorien im Internet. Manche Menschen genießen das Chaos und wollen es herbeiführen, um der Gesellschaft eine neue Ordnung aufzuzwingen. Anne Applebaum ist Historikerin und Journalistin. Sie arbeitet als Senior Fellow an der School of Advanced International Studies der Johns Hopkins University.
Ein Verbrechen muss nicht verziehen werden
Die Philosophin Hannah Arendt schrieb 1953 in ihrem Aufsatz „Verstehen und Politik“: „Verstehen ist eine nicht endende Tätigkeit. Durch diese begreifen wir Wirklichkeit. In ständigem Abwandeln und Verändern, begreifen und versöhnen uns mit ihr. Das heißt, durch die wir versuchen, in der Welt zuhause zu sein.“ Manche Menschen versuchen die Bedingungen eines Verbrechens oder einer unmoralischen Handlung nachzuvollziehen. Dadurch bekommen sie wie Svenja Flaßpöhler salopp formuliert, wieder Boden unter ihre Füße. Zuerst schien die Welt gänzlich aus den Fugen geraten zu sein. Jetzt steht ihnen nicht mehr fremd, gar teuflisch gegenüber. Sondern sie ist jetzt der Rationalität zugänglich. Svenja Flaßpöhler erklärt: „Verstehen heißt, Zusammenhänge herzustellen, Kausalketten zu erkennen.“ Doch, so ergänzt Hannah Arendt, ein solches Verstehen zieht nicht notwendigerweise ein Verzeihen nach sich. Svenja Flaßpöhler ist promovierte Philosophin und stellvertretende Chefredakteurin des „Philosophie Magazin“.
Die Ideale der Revolution sind Freiheit und das Neue
Gelungene Revolutionen mögen politische Verhältnisse umstürzen, alte Systeme hinwegfegen, Personen beseitigen. In der Regel schaffen sie mehr und länger andauernde Probleme, als sie unmittelbar lösen. Konrad Paul Liessmann nennt ein Beispiel: „Der Enthusiasmus, der mancherorts für den sogenannten Arabischen Frühling, den man sich nach dem Modell der europäischen Revolutionen dachte, um sich gegriffen hatte, was so auch Ausdruck einer eklatanten Geschichtsvergessenheit gewesen, letzter Reflex einer unwissenden Revolutionsromantik.“ Nicht nur frisst wie Saturn die Revolution ihre Kinder – wie Pierre Victurnien Vergniaud, einer der Protagonisten der Französischen Revolution, am Gang zum Schafott bemerkte. Sondern sie muss ihre Anhänger immer auch enttäuschen. Prof. Dr. Konrad Paul Liessmann ist Professor für Methoden der Vermittlung von Philosophie und Ethik an der Universität Wien. Zudem ist er wissenschaftlicher Leiter des Philosophicum Lech.
Die Pflicht des Vergebens gilt nicht für das Böse
Die Philosophin Hannah Arendt vertritt die Meinung, verstimmte Verbrechen von der Möglichkeit des Verzeihens auszuschließen: „Zweifellos bildet die Einsicht >Denn sie wissen nicht, was sie tun< den eigentlichen Grund dafür, dass Menschen einander vergeben sollen; aber gerade darum gilt auch diese Pflicht des Vergebens nicht für das Böse, von dem der Mensch im Vorhinein weiß, und sie bezieht sich keineswegs auf den Verbrecher.“ Während für den französischen Philosophen Jacques Derrida nur das Unverzeihbare Gegenstand des Verzeihens ist, zieht Hannah Arendt genau den entgegengesetzten Schluss: Das Unverzeihliche mag rufen, so viel es will – verziehen wird es nicht. Svenja Flaßpöhler ergänzt: „Damit bleibt Arendts Begriff des Verzeihens innerhalb der Grenzen der Rationalität: Was jenseits der Grenzen liegt, ist nicht mehr verzeihbar.“ Svenja Flaßpöhler ist promovierte Philosophin und stellvertretende Chefredakteurin des „Philosophie Magazin“.