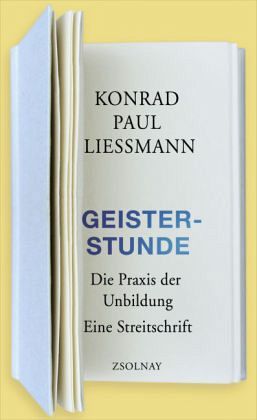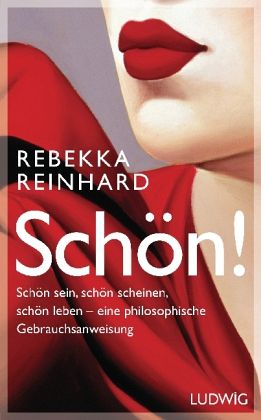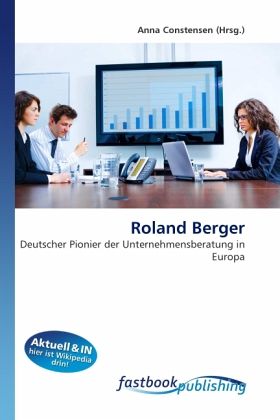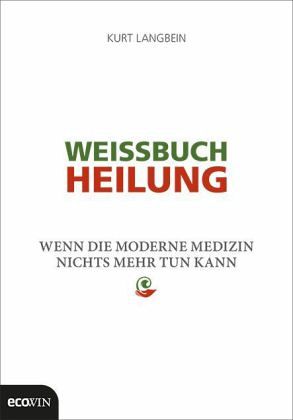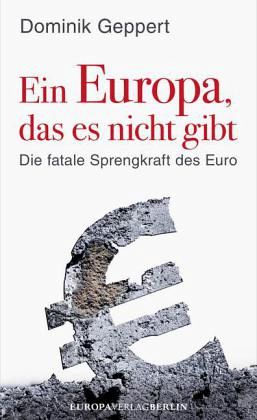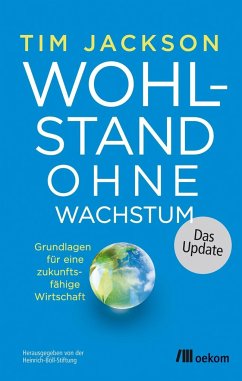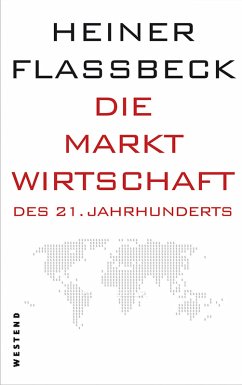„Nirgendwo wird so gerne über Utopien, bessere Rahmenbedingungen, ideale Betreuungsverhältnisse, innovative Didaktiken, neue Möglichkeiten, Aufgaben und Herausforderungen schwadroniert wie in Fragen der Bildung,“ behauptet Konrad Paul Liessmann. Und nirgendwo hält sich die hartnäckige Klage länger, dass sich nichts ändert, alles erstarrt und verknöchert ist, frontal vorgetragen wird, was dann auswendig gelernt werden muss, selektiert statt gefördert wird, alles verstellt und blockiert wird durch Überbleibsel aus der Vergangenheit, die endlich beseitigt werden müssen. Tatsächlich gibt es, vielleicht mit Ausnahme der katholischen Kirche, keine Institution, die so sehr unter Verdacht steht, sich allen Veränderungen zu verweigern, wie die Schule. Prof. Dr. Konrad Paul Liessmann ist Professor für Methoden der Vermittlung von Philosophie und Ethik an der Universität Wien und wissenschaftlicher Leiter des Philosophicum Lech.
Herausforderungen
Rebekka Reinhard erforscht die Absurdität
Die Erfahrung des Absurden machen laut Rebekka Reinhard nicht nur Jugendliche. Ganz im Gegenteil stellt die Absurdität die Standardsituation des modernen Menschen dar, der sich zwar damit abgefunden hat, dass kein Gott mehr sein Flehen erhört, dass sich ihm die Welt in der er lebt, schrecklich gleichgültig zeigt. Dennoch kann es der Mensch nicht lassen dieser Welt seinen Stempel aufzudrücken. Beispielsweise indem er in den Krieg zieht oder Bakterien mit künstlichem Erbgut produziert. Rebekka Reinhard schreibt: „ Im Alltag verbindet sich das Absurde mit der fraglosen Akzeptanz routinemäßiger Vorgänge.“ Die meisten Menschen freunden sich mit ihrer absurden Lage an, gewöhnen sich an sie, sie funktionieren.
Roland Berger stellt sein Vier-Säulen-Programm für Europa vor
Die Europäische Union (EU) ist der größte Wirtschaftsraum der Welt und steht dennoch vor gewaltigen Herausforderungen. So ist zum Beispiel die Wettbewerbsfähigkeit mangelhaft, die Jugendarbeitslosigkeit untragbar hoch, das Wachstum gering und die Verschuldung gigantisch. Weitere Rettungspakete für Griechenland und andere Krisenländer sind nicht ausgeschlossen, die die Glaubwürdigkeit des Euro erneut gefährden würden. Selbst im hochgelobten Deutschland gibt es viel zu tun. Der Berater-Doyen Roland Berger hat sich deshalb Gedanken gemacht, wie man Europa zukunftsfest machen könnte. Sein Programm für wirtschaftlich stabiles Europa besteht aus vier Säulen. Roland Berger (76) ist Deutschlands bekanntester Politik- und Unternehmensberater. Im Jahr 1967 gründete er die Roland Berger Strategy Consultants, in deren Aufsichtsrat er noch heute als Ehrenvorsitzender über die Geschäfte wacht.
In Gefahrensituationen ist gesunder Stress überlebensnotwendig
Seine Entwicklungsgeschichte hat dem Menschen die Fähigkeit verliehen, mit Gefahren und Herausforderungen durch neue Situationen ganz gut fertigzuwerden. Dabei spielt die Stressreaktion eine bedeutende Rolle. Kurt Langbein fügt hinzu: „Würde Stress keine körperlichen Auswirkungen haben, hätten es unsere Vorfahren nicht weit geschafft.“ Alle Reaktionen, die unter dem Begriff Stress zusammengefasst werden, bewirken zunächst einmal nichts, was die Gesundheit beeinträchtigen könnte. Eher ist das Gegenteil der Fall: In akut bedrohlichen Situationen wird der Kreislauf und die Atmung aktiviert, das Schmerzempfinden heruntergefahren, jede Zelle im Körper auf den Modus für Höchstleistungen geschaltet und das Immunsystem vorsorglich angekurbelt. Kurt Langbein studierte in Wien Soziologie und ist seit 1992 geschäftsführender Gesellschafter der Produktionsfirma Langbein & Partner Media. Er ist unter anderem Autor des Bestsellers „Bittere Pillen“. Sein aktuelles Buch heißt „Weissbuch Heilung“ und ist im Ecowin Verlag erschienen.
In der Europäischen Union fehlt es an Entwicklungsperspektiven
Die europäische Einigung nach 1945 ist laut Dominik Geppert von einem eigenartigen Spannungsverhältnis geprägt. Einerseits boten die Europäische Gemeinschaft und später die Europäische Union (EU) ihren Mitgliedern praktische Vorteile. Sie erleichterten das Handeln über Grenzen hinweg und ermöglichten die Koordination politischer Pläne. Dominik Geppert erläutert: „Auf diese Weise halfen sie den Nationalstaaten, die ihnen angehörten, sich gegenüber den ökonomischen und politischen Herausforderungen des zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts besser zu behaupten.“ Andererseits beinhaltete die europäische Einigung für Dominik Geppert von Beginn an auch die Perspektive einer Überwindung der Nationalstaaten durch die Integration. Im Vertrag von Maastricht war ausdrücklich vom Ziel einer immer engeren Einheit die Rede. Dominik Geppert ist seit 2010 ordentlicher Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.
Die Menschheit befindet sich mitten im Klimawandel
Mit der Verlässlichkeit stabiler Wetterlagen scheint es vorbei zu sein. Wir befinden uns laut Daniel Goeudevert mitten im Klimawandel. Obwohl das der eine oder andere Experte anders sieht und weiterhin seine wissenschaftlichen Zweifel pflegt, ob Erderwärmung und Wetterextreme wirklich durch menschlichen Einfluss verursacht sind. Daniel Goeudevert kritisiert, dass diese Wissenschaftler den Irrtum längst zu ihrem Hauptfeind erklärt haben und nur noch das mit Gewissheit Wissbare gelten lassen. Er schreibt: „Sobald Antworten mit dem Makel irgendeines Zweifels behaftet sind, erklären sie sich lieber für nicht zuständig. So erhalten sie ihre Unschuld und können im strengen Sinne niemals irren. Aber diese scheinbar rationale Strenge ist nur um den Preis der eigenen Borniertheit aufrechtzuerhalten, denn es handelt sich hierbei im Grunde um nichts anderes als um eine Kapitulation vor der Komplexität der Wirklichkeit.“
Tim Jackson fordert eine andere Makroökonomie
Tim Jackson, Professor für Nachhaltige Entwicklung am Zentrum für Umweltstrategien der Universität Surrey, glaubt, dass die Konsumgesellschaft wild entschlossen zu sein scheint, auf die Klimakatastrophe zuzusteuern. Das System lässt sich seiner Meinung nach allerdings auch nicht so einfach umbauen. Eine komplette Kehrtwende könnte die Menschheit sogar noch schneller ins Verderben führen. Änderungen in kleinen Schritten reichen aber mit Sicherheit auch nicht. Gar nichts bringt es, sich in eine Art Fatalismus zu flüchten, das heißt, hinzunehmen, dass der Klimawandel unausweichlich, die Welt ungleich ist, sich vielleicht sogar mit dem kommenden gesellschaftlichen Zusammenbruch abzufinden. Der Nachhaltigkeitsexperte hält diese Reaktion zwar für verständlich, auf keinen Fall für konstruktiv, da sie nicht unausweichlich ist. Es gibt immer Alternativen, auch wenn manche Politiker das Gegenteil behaupten.
Heiner Flassbeck fordert eine neue Marktwirtschaft
Heiner Flassbeck stellt in seinem neuen Buch „Die Marktwirtschaft des 21. Jahrhunderts“ die These auf, dass ein neues Wirtschaftswunder machbar ist, wenn man die vier großen Aufgabengebiete Finanzen, Handel, die soziale sowie die ökologische Absicherung erfolgreich miteinander verbindet. Gleichzeitig fordert der Autor eine radikale Reform der Parteiendemokratie und des Lobbyismus. Die Marktwirtschaft hat nur dann eine Zukunft, wenn sie in ein System verwandelt wird, das nicht dazu da ist, einigen Wenigen Reichtum zu ermöglichen, sondern ganz im Gegenteil allen Bürgern eine systematische Chance auf die Verbesserung ihrer Lebensumstände gibt. Heiner Flassbeck arbeitet seit dem Jahr 2000 bei den Vereinten Nationen in Genf und ist dort als Direktor zuständig für die Division Entwicklung und Globalisierung.