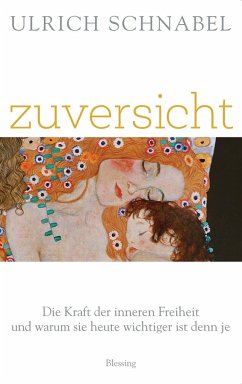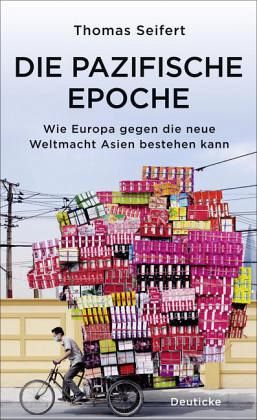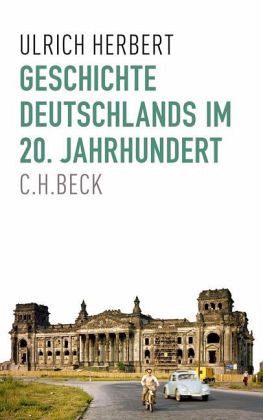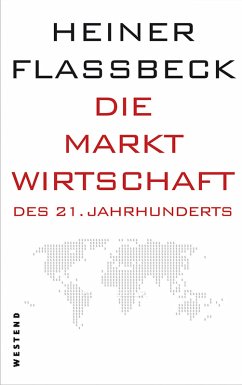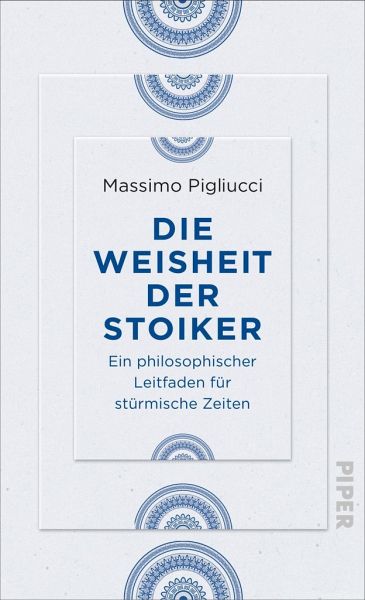Die sogenannte Resilienzforschung beschäftigt sich mit der Frage, was Menschen widerstandsfähig gegen Krisen macht. Ulrich Schnabel erläutert: „Der Begriff Resilienz bezeichnet eigentlich in der Materialkunde die Eigenschaft von Werkstoffen, nach starker Verformung wieder die ursprüngliche Gestalt anzunehmen. In der Psychologie werden heute Menschen als resilient bezeichnet, die Krisen gut verarbeiten und ohne Traumata überstehen.“ Üblicherweise werden dabei eine ganze Reihe von Faktoren genannt, welche diese seelische Widerstandskraft fördern: Wer etwa grundsätzlich optimistisch und kontaktfreudig ist, verarbeitet Krisensituationen leichter als depressive Eigenbrötler. Ebenso positiv ist es, eine Familie oder einen engen Freundeskreis um sich zu haben, in einem starken Glauben Halt finden zu können – sei der nun religiös, humanistisch oder politisch – oder in der Musik, Kunst oder Natur Trost zu erfahren, wenn alles andere finster erscheint. Ulrich Schnabel ist seit über 25 Jahren Wissenschaftsredakteur bei der ZEIT.
Krisen
Die Politik hat ihre Vorherrschaft an die Wirtschaft verloren
Die Welt erlebt nun seit einigen Jahren eine dreifache Krise. Thomas Seifert nennt sie beim Namen: „Eine Krise des Kapitalismus, die mit dem Beinahe-Kollaps der Weltwirtschaft nach dem Lehman-Pleite am 15. September 2008 offenbar geworden ist, eine Krise der westlichen (Parteien-) Demokratie, die die Probleme nicht lösen kann, und – durch die Verschiebung des Schwerpunkts des Globus von West nach Ost – eine Krise der Weltordnung, des Global Governance Systems.“ Die drei Krisen sind miteinander verwoben, bedingen und verstärken einander, und ein Ende ist nicht in Sicht. Die Wirtschaft hat die zentrale Funktion der Steuerung der Gesellschaft übernommen, die Vorherrschaft der Politik ist längst verloren. Die Wähler haben verstanden, dass die Politik das Gesetz des Handelns an die Ökonomie abgetreten hat, und strafen die politischen Akteure mit Ignoranz, Misstrauen, Totalverweigerung oder Anti-Politik. Thomas Seifert ist stellvertretender Chefredakteur und Leiter der Außenpolitik bei der Wiener Zeitung.
Ulrich Herbert beleuchtet die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg
In der europäischen Außenpolitik hatte sich seit der Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert ein Paradigmenwechsel ergebe. Durch den Bau der Flotte und der Propagierung der deutschen Weltpolitik hatte sich das Deutsche Reich in einen Gegensatz zu der einzigen tatsächlichen Weltmacht der Zeit, Großbritannien, gesetzt, ohne ein starkes Bündnis aus seiner Seite zu haben. Ulrich Herbert ergänzt: „Dieser Gegensatz dominierte in den folgenden Jahren die Entwicklung in Europa.“ In Reaktion auf die Herausforderung Deutschlands legte Großbritannien seine Konflikte mit Russland und Frankreich bei und baute die Verbindungen zu beiden Mächten in weniger als fünf Jahren zu einem so festen, wenngleich informellen Bündnis aus, dass Deutschland dadurch in jene Isolation geriet, die es zuvor selbst mit in Gang gebracht hatte und nun als Einkreisung wahrnahm. Ulrich Herbert zählt zu den renommiertesten Zeithistorikern der Gegenwart. Er lehrt als Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg.
Friedrich Nietzsche ruft das Ende der Verantwortung aus
In seinem Werk „Menschliches, Allzumenschliches“ schreibt Friedrich Nietzsche über die Geschichte der moralischen Empfindungen folgendes: „Zuerst nennt man einzelne Handlungen gut oder böse ohne alle Rücksicht auf die Motive, sondern allein der nützlichen oder schädlichen Folgen wegen. Bald aber vergisst man die Herkunft dieser Bezeichnungen und wähnt, dass den Handlungen an sich, ohne Rücksicht auf deren Folgen, die Eigenschaft gut oder böse innewohne. Sodann legt man das Gut- oder Böse-sein in die Motive hinein und betrachtet die Thaten an sich als moralisch zweideutig.“ Danach gibt man das Prädikat gut oder böse nicht mehr dem einzelnen Motiv, sondern dem ganzen Wesen eines Menschen. So macht man der Reihe nach den Menschen für seine Wirkungen, dann für seine Handlungen, dann für seine Motive und schließlich für sein Wesen verantwortlich.
Die Macht wandert von den Finanzzentren in die Politik
Der amerikanische Wissenschaftler und Publizist Ian Bremmer hat herausgefunden, dass der Einfluss staatlich gelenkter Konzerne weltweit wächst. Seiner Meinung nach provoziert der neue Staatskapitalismus politische Krisen und könnte sich sogar zu einem globalen Wachstumsrisiko entwickeln. Vor allem im Verlauf der vergangen zehn Jahre hat eine neue Art von Unternehmen die internationale Bühne betreten. Sie gehören entweder der heimischen Regierung oder sind zumindest eng mit ihr verflochten. Ian Bremmer nennt als Beispiele den mexikanischen Zementhersteller Cemex und die brasilianischen Minengesellschaft Vale. Die beiden Konzerne pflegen enge Kontakte zu ihren Regierungen, wodurch sie ihre marktbeherrschende Stellung durch die feindliche Übernahme kleinerer inländischer Konkurrenten festigen können. Ian Bremmer schreibt, dass beide Unternehmen im Grunde genommen nationale Champions in Privatbesitz sind.
Heiner Flassbeck fordert eine neue Marktwirtschaft
Heiner Flassbeck stellt in seinem neuen Buch „Die Marktwirtschaft des 21. Jahrhunderts“ die These auf, dass ein neues Wirtschaftswunder machbar ist, wenn man die vier großen Aufgabengebiete Finanzen, Handel, die soziale sowie die ökologische Absicherung erfolgreich miteinander verbindet. Gleichzeitig fordert der Autor eine radikale Reform der Parteiendemokratie und des Lobbyismus. Die Marktwirtschaft hat nur dann eine Zukunft, wenn sie in ein System verwandelt wird, das nicht dazu da ist, einigen Wenigen Reichtum zu ermöglichen, sondern ganz im Gegenteil allen Bürgern eine systematische Chance auf die Verbesserung ihrer Lebensumstände gibt. Heiner Flassbeck arbeitet seit dem Jahr 2000 bei den Vereinten Nationen in Genf und ist dort als Direktor zuständig für die Division Entwicklung und Globalisierung.
Die Stoiker wollen wunschlos glücklich sein
Ursprünglich bezeichnete die Stoa eine lang gestreckte, schmale Halle mit geschlossenen Rück- und Schmalseiten und einer offenen, durch Säulen unterbrochenen Vorderseite. Die Schule der Stoa erhielt von einer solchen Säulenhalle ihren Namen, da die ersten Vertreter in einem solchen Gebäude lehrten. Begründet wurde die Lehre von Zenon aus Kition auf Zypern (um 333-262 v. Chr.). Das stoische Gedankengebäude ist stark auf Fragen der Lebensführung ausgerichtet, enthält aber zugleich individualistische Elemente.