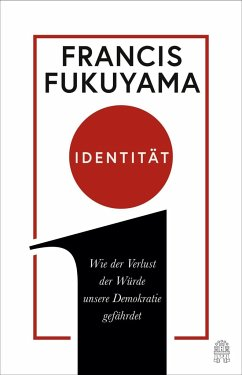Während des 19. Jahrhunderts ging das Verständnis der Würde auseinander. Einerseits in Richtung eines liberalen Individualismus, der in den politischen Rechten zeitgenössischer freiheitlicher Demokratien zum Ausdruck kommen sollte. Andererseits in Richtung kollektiver Identitäten, die sich entweder durch Nation oder Religion definieren ließen. In den neuzeitlichen liberalen Demokratien Nordamerikas und Europas hat sich eine besondere Identität herausgebildet. Francis Fukuyama erklärt: „In diesen Regionen haben die politischen Systeme nach und nach immer weiteren Personenkreisen Rechte gewährt, was zu einer Demokratisierung der Würde führte.“ Die Verfassung der Vereinigten Staaten wurde im Jahr 1788 ratifiziert. Zu dieser Zeit besaßen nur weiße Männer, die über Grundbesitz verfügten, volle politische Rechte. Francis Fukuyama ist einer der bedeutendsten politischen Theoretiker der Gegenwart. Sein Bestseller „Das Ende der Geschichte“ machte ihn international bekannt.
Das innere Selbst ist von Gefühlen erfüllt
Danach weitete sich die Zahl der Rechteinhaber allmählich auf weiße Männer ohne Grundbesitz aus, dann auf Afroamerikaner, amerikanische Ureinwohner und Frauen. In diesem Sinne erfüllte der liberale Individualismus sein Versprechen, zur Demokratie beizutragen. Gleichzeitig entwickelt sich jedoch auch eine kollektive Richtung. Dadurch konvergierten die beiden Stränge auf überraschende Weise. In Platons „Staat“ war die Würde ausschließlich der Wächter- oder Kriegsschicht vorbehalten.
Also Individuen, die wegen ihrer Bereitwilligkeit, ihr Leben für die gewaltsame Verteidigung der größeren Gemeinschaft zu riskieren, Anerkennung verdienten. Die christliche Tradition universalisierte dann die Würde, da man allen Menschen eine moralische Entscheidungsfähigkeit zuschrieb. Nach protestantischer Ansicht ist sie tief im Innern jedes Individuums verborgen. Diese Vorstellung von der universalen Würde wurde dann in Gestalt von Immanuel Kants rationalen moralischen Regeln säkularisiert. Jean-Jacques Rousseau fügte die Idee dazu, dass das innere Selbst auch von einer Vielzahl an Gefühlen und persönlichen Erfahrungen erfüllt sei.
Die Religion galt als Form des Götzendienstes
Die Gesellschaft unterdrückt diese allerdings. Der Zugang zu jenen Gefühlen anstelle ihrer Verdrängung entwickelte sich zum moralischen Imperativ. Damit konzentrierte sich der Begriff der Würde nun darauf, das authentische innere Selbst wiederherzustellen, sowie auf die gesellschaftliche Anerkennung des Potenzials, das jedem Bürger eigen ist. Man verstand eine liberale Ordnung zunehmend nicht bloß als politische Ordnung, die ein Minimum individueller Recht schützt.
Sondern man fasste es auch als System auf, das aktiv zur vollen Verwirklichung des inneren Selbst beiträgt. In der christlichen Tradition war das innere Selbst die Quelle der Erbsünde. Doch es war auch die Stätte der moralischen Wahl, welche die Sünde überwinden konnte. Würde war von der Fähigkeit des einzelnen Gläubigen abhängig – im Hinblick auf Sex, Familie, Beziehungen zu Nachbarn und Herrschern. Später dann galt die Religion als Form des Götzendienstes oder des falschen Bewusstseins. Und Anerkennung gebührte eher dem expressiven inneren Selbst, das zuweilen sogar die religiösen Vorschriften verletzen mochte. Quelle: „Identität“ von Francis Fukuyama
Von Hans Klumbies