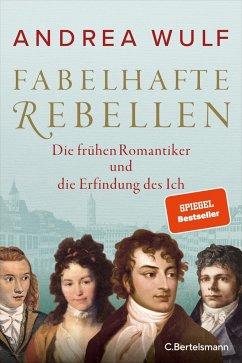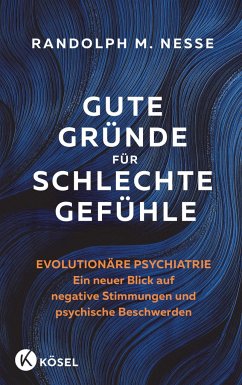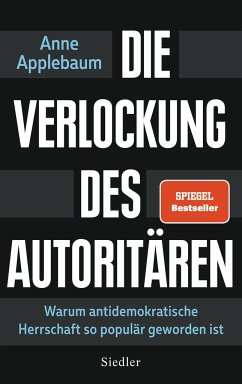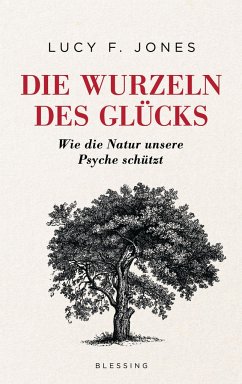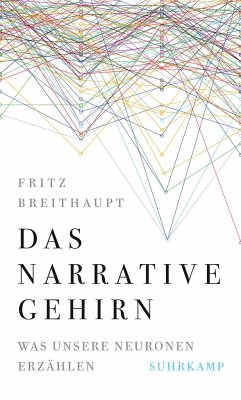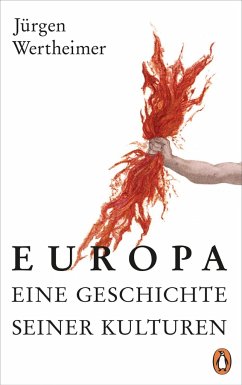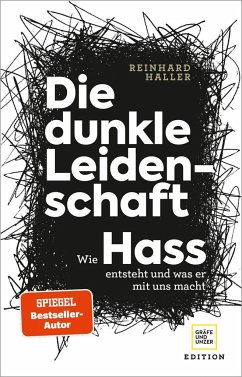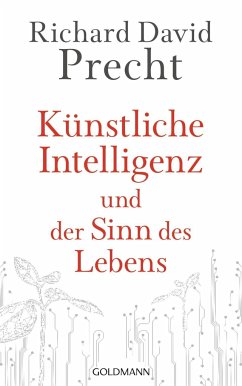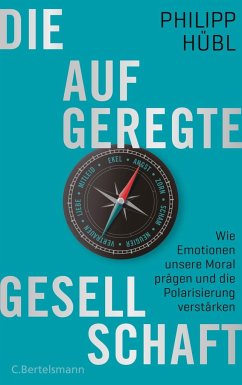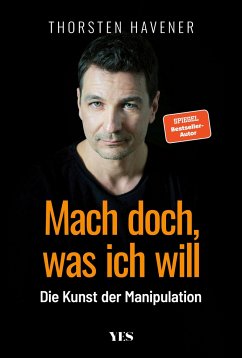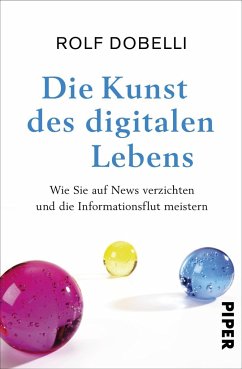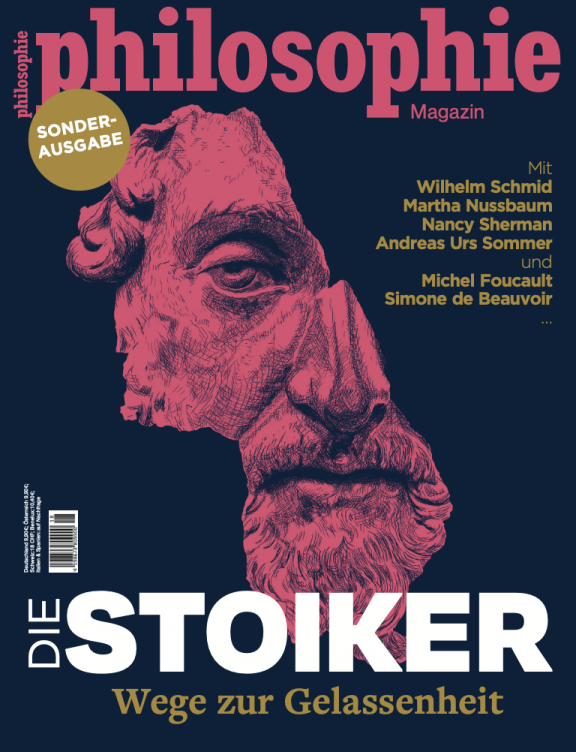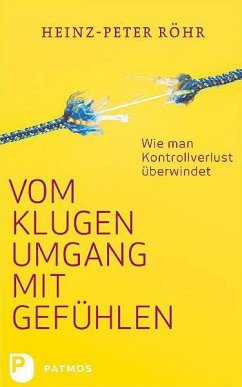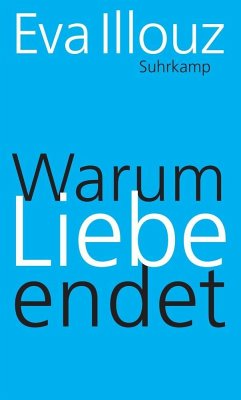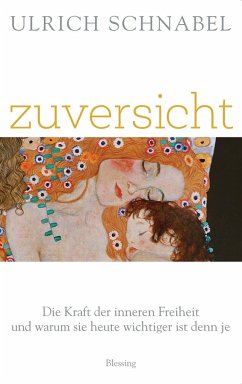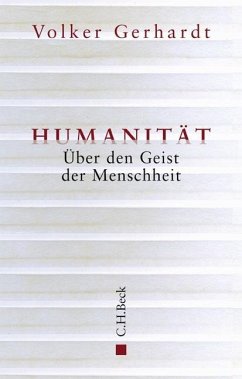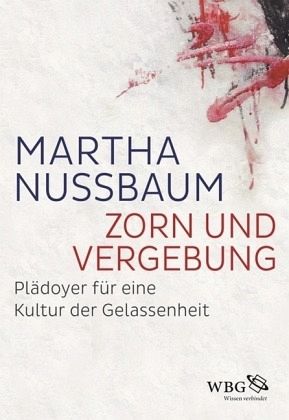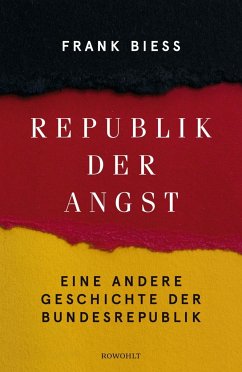Das Buch „Die Leiden des jungen Werthers“ waren Johann Wolfgang von Goethes bedeutendster Beitrag zum sogenannten Sturm und Drang. Dabei handelt es sich um eine literarische Bewegung, die sich gegen den Rationalismus der Aufklärung wandte. Die Schriftsteller des Sturm und Drang zelebrierten Emotionen in all ihren Extremen. Sie schrieben von leidenschaftlicher Liebe bis zur düsteren Melancholie, von selbstmörderischer Sehnsucht bis zu rasender Freude. Und Johann Wolfgang von Goethe wurde damit zum literarischen Superstar. Andrea Wulf weiß: „Der achtzehn Jahre alte Herzog Carl August war von dem Roman so angetan, dass er Goethe 1775 einlud, bei ihm im Herzogtum Sachsen-Weimar zu leben und zu arbeiten.“ Als Autorin zeichnete man Andrea Wulf mit einer Vielzahl von Preisen aus, vor allem für ihren Weltbestseller „Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur“ 2016, der in 27 Sprachen übersetzt wurde.
Emotionen
Politik ist immer emotional
In ihrem neuen Buch „Radikal emotional“ beschreibt die Neurowissenschaftlerin Maren Urner wie Gefühle Politik machen. Sie vertritt dabei unter anderem die These, dass nicht nur die großen Zusammenhänge, sondern auch vermeintlich „rein private“ Alltagsentscheidungen immer politisch sind. Gefühle sind für die Autorin nichts „Privates“, dass man von der professionellen und politischen Ebene trennen kann. Maren Urner schreibt: „Die Ansicht, Emotionen hätten in der Politik nichts zu suchen, ist sogar – Achtung! – irrational. Denn Politik ist nichts anderes als ein Aushandlungsprozess über unterschiedliche Gefühle und damit verbundene Werte und Ideen innerhalb einer Gruppe von Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt.“ In diesen Aushandlungsprozess sind alle Menschen involviert. Dr. Maren Urner ist Professorin für Medienpsychologie an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft (HMKW) in Köln.
Erfahrungen und Emotionen können die Quelle für Wissen sein
Michael Hampe erzählt in seinem neuen Buch „Wozu?“ die beispielhafte Biografie eines Menschen. Er schreibt: „Autobiografische Philosophie basiert auf der Idee, dass persönliche Erfahrungen und Emotionen eine legitime Quelle für Wissen und Einsichten sind.“ Einige Beispiele von Philosophinnen und Philosophen, die autobiografische Elemente in ihren Arbeiten verwendeten, sind Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir und Friedrich Nietzsche. Ihre Arbeiten offenbaren eine Menge über ihre eigene Lebenserfahrung, ihre persönlichen Gedanken und Gefühle und darüber, wie sie ihre philosophischen Ideen geformt haben. Es ist behauptet worden, dass man „das Selbst“ als eine Fiktion ansehen könnte, die, so wie ein Schwerpunkt als der Ort, an dem die Gravitationskraft auf einen Körper wirkt, innerhalb einer Erzählung entsteht als die Perspektive, aus der die Erzählung gesponnen wird und zu der sie immer wieder zurückkehrt. Michael Hampe ist seit 2003 Professor für Philosophie an der ETH Zürich.
Manchmal sind schmerzliche Gefühle normal
Randolph M. Nesse vertritt in seinem neuen Buch „Gute Gründe für schlechte Gefühle“ folgende These: „Gerade die evolutionären Entwicklungen, die uns zu sozialen Handeln und kognitiven Leistungen befähigen, sind auch dafür verantwortlich, dass wir mental leiden.“ Die Evolutionsmedizin bietet neue Erklärungsansätze, warum der menschliche Körper so krankheitsanfällig ist, die inzwischen auch bei psychischen Störungen systematisch zur Anwendung kommen. Randolph Nesses Buch ist ein breit gefächerter Bericht von der vordersten Front der Evolutionären Psychiatrie. Psychische Störungen sind eine so große Plage der Menschen, dass sich alle unverzüglich Lösungen wünschen. Die Evolutionäre Psychiatrie kann dazu hilfreiche philosophische Erkenntnisse bieten. Professor Randolph M. Nesse ist Mitbegründer der Evolutionären Medizin. Seit 2014 lehrt er and er University of Arizona, wo er als Gründungsmitglied und Direktor das Center for Evolution and Medicine leitet.
Lügen sind von Fakten schwer zu unterscheiden
Die alten Printmedien und Sendeanstalten öffneten den Raum für ein homogenes nationales Gespräch. Anne Applebaum kritisiert: „In vielen Demokratien gibt es heute keine gemeinsame Debatte mehr, von einer gemeinsamen Erzählung ganz zu schweigen.“ Menschen hatten immer unterschiedliche Ansichten. Heute haben sie unterschiedliche Tatsachen. In einer Informationssphäre ohne politische, kulturelle oder moralische Autorität ist es schwer, Verschwörungstheorien von Fakten zu unterscheiden. Falsche, parteiliche und oftmals bewusst irreführende Erzählungen verbreiten sich heute wie digitale Lauffeuer. Und die Lügenkaskaden sind zu schnell, als das Faktenchecker noch mithalten könnten. Und selbst wenn sie es könnten, spielt das keine Rolle mehr. Viele Menschen würden niemals eine Website von Faktenchecker besuchen, und wenn doch, dann würden sie ihnen keinen Glauben schenken. Anne Applebaum ist Historikerin und Journalistin. Sie arbeitet als Senior Fellow an der School of Advanced International Studies der Johns Hopkins University.
Menschen lernen Vertrautes
Es ist wahrscheinlich, dass die natürliche Selektion diejenigen Gene weiterverbreitete, die für das Erlernen überlebenswichtiger Fähigkeiten, für Nahrungsbeschaffung und Fortpflanzung entscheidend waren. Der Sozialbiologe Edward O. Wilson schreibt: „Ein bestimmter Genotyp macht ein gewisses Verhalten wahrscheinlicher, sodass es sich wiederum in der Population weiterverbreitet, bis sich das Verhalten schließlich durchsetzt.“ Anders gesagt: Menschen lernen, was ihnen vertraut ist, doch manche Dinge lernen sie schneller und einfacher als andere. Lucy F. Jones erklärt: „Und diese Dinge lassen sich mit großer Wahrscheinlichkeit auf den natürlichen Lebensraum zurückführen, in dem der Homo sapiens den mit Abstand größten Teil seiner Entwicklungsgeschichte verbracht hat.“ Lucy F. Jones ist Journalistin. Sie schreibt regelmäßig zu wissenschaftlichen Themen, Gesundheit, Umwelt und Natur für die BBC, The Guardian und The Sunday Times.
In Narrationen teilt man die Erfahrungen anderer
Warum verbringen Menschen so viel Zeit mit Narrationen? Damit meint Fritz Breithaupt nicht nur die Filme, die man sich reinzieht, und die Bücher, die man liest. Sondern er zählt auch die vielen Unterhaltungen dazu, die Menschen darüber führen, wer was mit wem gemacht hat, die Posts in den sozialen Medien sowie die eigenen Gedanken dazu. Die Antwort auf diese erste Frage ist für Fritz Breithaupt einfach: „In Narrationen erleben wir die Erlebnisse von anderen mit und teilen ihre Erfahrungen. Das ist möglich, weil wir uns in Narrationen ja an die Stelle von anderen versetzen können und dann tatsächlich „ihre“ Erfahrungen selbst machen.“ Und zugleich kommt man durch Narrationen in den Genuss, auch das Verbotene einmal zu erproben. Fritz Breithaupt ist Professor für Kognitionswissenschaften und Germanistik an der Indiana University in Bloomington.
Das Drama war ein Produkt der Stadtstaaten
Die Männer, die aus dem Trojanischen Krieg zurückkamen, waren Verändernde und Veränderte. Von den Erfahrungen auf dem Schlachtfeld gezeichnet, passten sie nicht mehr ins soziale Gefüge der Orte, von denen sie ausgezogen waren. Und doch blieben sie im Gedächtnis derer Leitfiguren. Jürgen Wertheimer stellt fest: „Mit der Erfindung des Dramas findet im 5. Jahrhundert vor unserer Zeit ein entscheidender Medienwechsel statt.“ Natürlich gab es Rituale und kultische Vorführungen schon früher und an anderen Orten. Aber es ist sicher nicht übertrieben zu sagen, dass das Drama ein Produkt der noch jungen Stadtstaaten war. Es diente als zentrale öffentliche Form der kulturellen Selbstdarstellung. Unterhalb des Burghügels der Akropolis, kann man seine Reste noch heute besichtigen. Jürgen Wertheimer ist seit 1991 Professor für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft und Komparatistik in Tübingen.
Das narrative Denken ist ein großartiges Medium
Fritz Breithaupt klärt in seinem neuen Buch „Das narrative Gehirn“ darüber auf, warum Menschen so viel Zeit mit Narrationen verbringen. Eine seiner Thesen lautet: „In den Narrationen erleben wir die Erlebnisse von anderen mit und teilen ihre Erfahrungen. Das ist möglich, weil wir uns in Narrationen ja an die Stelle von anderen versetzen können und dann tatsächlich „ihre“ Erfahrungen selbst machen.“ Man kann auch narrative und mentale Erfahrungen machen und zugleich die Handlungen nicht ausführen. Somit verdoppelt man sein Leben. Man kann auch bereits Getanes ein zweites Mal miterleben oder sich eine geplante Handlung vor Augen führen. Dies fängt bei minimalen Reaktionen an und endet bei den großen Lebensentscheidungen. Insofern ist narratives Denken ein großartiges Medium des Erlebens und Planens. Fritz Breithaupt ist Professor für Kognitionswissenschaften und Germanistik an der Indiana University in Bloomington.
Hass ist die primitivste aller Emotionen
Reinhard Haller definiert den Hass in seinem neuen Buch „Die dunkle Leidenschaft“ wie folgt: Es handelt sich dabei um eine „auf Zerstörung ausgerichtete Abneigung, die destruktivste Form der Verachtung“. Als intensives Empfinden von Feindseligkeit und Aggressivität äußert sich Hass beispielsweise in toxischem Schweigen oder verbalen Attacken. Er kann zu heftigen zwischenmenschlichen Auseinandersetzungen und Gesellschaftskonflikten führen. Weitere Formen des Hasses sind Diskriminierung und Mobbing, am schlimmsten Verbrechen und Krieg. Hass ist tatsächlich eine Leidenschaft, die nichts als Leiden schafft. Hass ist die primitivste aller Emotionen – ein Trieb zur Grausamkeit, wie ihn Sigmund Freud bezeichnet hat. Prof. Dr. med. Reinhard Haller war als Psychiater, Psychotherapeut und Neurologe über viele Jahre Chefarzt einer psychiatrisch-psychotherapeutischen Klinik. Heute führt er eine fachärztliche Praxis in Feldkirch (Österreich).
Platon verficht eine klare Ordnung des Diskurses
Das Theater setzt Gefühle frei und schafft sogar Momente der Empathie mit dem Abscheulichen. Es steuert, kommentiert, kontrolliert diese Gefühle, indem es mit ihnen artistisch jongliert. Jürgen Wertheimer stellt fest: „Wie alle wichtigen Spiele ist auch dieses ein sehr ernstes Spiel, wenngleich kein Spiel auf Leben und Tod. Stattdessen „nur“ eine Simulation – eine Simulation, in der es um Leben und Tod anderer geht.“ Aber genau deshalb konnte man in den Theatern Griechenlands gezielt Grenzen überschreiten. Schon damals nicht ohne den massiven Widerstand derer, die in einem solchen Spiel mit dem Feuer der Phantasie und der Emotionen Gefahren für die gesellschaftliche Ordnung sahen. Kein geringerer als Platon (428 – 348 v. u. Z.) war ein Verfechter einer klaren Ordnung des Diskurses. Jürgen Wertheimer ist seit 1991 Professor für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft und Komparatistik in Tübingen.
Willensimpulse bestimmen die Glücksdynamik
Die künstliche Intelligenz (KI), die einen Meister des „Go“ Spiels schlug, ist nicht emotional. Emotionalität ist kein irrationales Manko des Menschen, wie viele antike Griechen und manchen Philosophen der Aufklärung, wie beispielsweise Immanuel Kant, meinten. Richard David Precht erläutert: „Ohne unsere Gefühle wüsste unser Verstand überhaupt nicht, was er tun soll. Es sind unsere emotionalen Willensimpulse und ihre Erfüllung, die wesentlich unsere Glücksdynamik bestimmen.“ Künstliche Intelligenzen können Emotionen zwar mit Sensoren erspüren und mimisch und stimmlich imitieren. Aber das macht sie beileibe nicht zu emotionalen Wesen. „Affective Computing“ verhält sich zum Empfinden von Emotionen wie Donald Duck zu einer Stockente. Auch können künstliche Intelligenzen nicht alle menschlichen Gefühle lesen. Der Philosoph, Publizist und Autor Richard David Precht zählt zu den profiliertesten Intellektuellen im deutschsprachigen Raum.
Sprachliche Einrahmungen sind normal
Die Wortwahl der Alternative für Deutschland (AfD) erfüllt zwei Funktionen. Erstens sendet sie Signale an die rechtsradikalen Wähler. Zweitens verharmlost sie die Radikalität gegenüber der Mehrheitsgesellschaft. Die Horden auf den Straßen von Chemnitz richteten sich bewusst gegen die soziale Erwünschtheit. Rechtsradikale Politiker loten die Grenzen des Sagbaren immer wieder aufs Neue aus. Philipp Hübl ergänzt: „Politiker haben zu allen Zeiten ihre Programme in wirksame Worte verpackt. Vor allem in moralisch umstrittenen Fragen ist die sprachliche Fassung entscheidend.“ Deshalb nannte das US-Militär seinen Einsatz in Afghanistan „Operation dauerhafte Freiheit“ und nicht „Angriffskrieg“. Ein typisches Beispiel für eine sprachliche Einrahmung im Alltag ist der Euphemismus „Lebenskünstler“ für „Arbeitsloser“. Philipp Hübl ist Philosoph und Autor des Bestsellers „Folge dem weißen Kaninchen … in die Welt der Philosophie“ (2012).
Die Manipulation spielt sich im Verborgenen ab
In seinem Buch „Mach doch, was ich will“ enthüllt Thorsten Havener die Geheimnisse der Manipulation. Er beschreibt darin die psychologischen Strategien, mit denen man Meinungen und Entscheidungen sabotieren kann. Er erklärt, welche Schwachstellen eines Menschen ihn angreifbar machen und der unbewussten Einflussnahme anderer aussetzen. Vor allem aber verrät er, wie man sich gegen diese mächtigen Kräfte wehren und die Selbstbestimmung zurückgewinnen kann. Dies gelingt, indem man die häufigsten und wirksamsten Manipulationsmethoden durchschaut und die verborgenen Interessen seiner Mitmenschen erkennt. Thorsten Havener ist unter anderem deswegen so von der Manipulation fasziniert, weil sie sich im Verborgenen abspielt. Eines der wesentlichen Werkzeuge der Beeinflussung ist dabei die Sprache. Der Autor hat sein Buch aus der Sicht eines „Gedankenlesers“ geschrieben. Thorsten Havener ist Deutschlands bekanntester Mentalist.
Jeder Mensch braucht eine Lebensphilosophie
Was macht ein gutes Leben aus? Wie muss ein Leben geführt werden, damit es im Rückblick als gelungen und gut betrachtet werden kann? Solange ein Mensch auf diese Grundfrage keine Antwort hat, wird sein Leben nonstop mit der Bewältigung von Krisen beschäftigt sein. Anders ausgedrückt: Ohne klare Lebensphilosophie ist das Risiko groß, dass jemand sein Leben einfach nur „verlebt“. Für Rolf Dobelli steht fest: „Es ist nicht so wahninnig wichtig, für welche Lebensphilosophie Sie sich entscheiden. Hauptsache, Sie haben sich seriös Gedanken gemacht und Ihre Wahl getroffen.“ Vielleicht hat jemand ähnliche Ziele als der Autor selbst. Vielleicht auch ganz andere. Nicht so wichtig – Hauptsache man hat Ziele und ist sich im Klaren darüber. Der Bestsellerautor Rolf Dobelli ist durch seine Sachbücher „Die Kunst des klaren Denkens“ und „Die Kunst des klugen Handelns“ weltweit bekannt geworden.
Die Philosophie der Stoiker ist aktueller denn je
Die neue Sonderausgabe des Philosophie Magazins handelt von den Stoikern und ihren Wegen zur Gelassenheit. Bis heute geht von den Stoikern eine starke Faszination aus. Chefredakteurin Catherine Newmark meint: „Vielleicht auch, weil sie mehr als sonst in der westlichen Philosophie üblich über konkrete Techniken der Einübung von guten Gewohnheiten und über Lebenskunst nachgedacht haben.“ Zenon von Kiton gründete die Stoische Schule. Die sogenannte „Alte Stoa“ bestand etwa von 300 – 150 v. Chr. Die stoische Philosophie übt auch nach ihrer Hochphase auf zahlreiche Denker eine beträchtliche Wirkung aus. Angefangen beim Kirchenvater Augustinus über den Neustoizismus des 15. und 16. Jahrhunderts zum Existenzialismus des 20. Jahrhunderts. Der deutsche Philosoph Wilhelm Schmid erklärt im Gespräch mit dem Philosophie Magazin, was die Menschen heute von den Stoikern lernen können. Und warum es wichtig ist, die stoische Philosophie der heutigen Lebenswelt anzupassen.
Jeder sollte mit seinen Gefühlen klug umgehen
In seinem neuen Buch „Vom klugen Umgang mit Gefühlen“ stellt Heinz-Peter Röhr die These auf, dass der intelligente Umgang mit Gefühlen für das persönliche Lebensglück wichtiger ist als ein hoher Intelligenzquotient (IQ). Wer dagegen die Kontrolle über seine Emotionen und sein Verhalten verliert, belastet sich selbst und seine Beziehung. Gründe dafür können endloses Grübeln, unrealistische Ängste oder auch Wut und Ärger sein. Heinz-Peter Röhr erklärt, was Kontrollverlust ist, wie es dazu kommt und welche Strategien es dagegen gibt. Mit einfachen Übungen kann man die im Gehirn verankerten Fehlreaktionen erkennen und destruktive innere Muster auflösen. Denn die Kontrolle über das eigene Leben und über seine Gefühle zu haben gehört zu den Urbedürfnissen des Menschen. Nur so kann er sich sicher fühlen. Heinz-Peter Röhr ist Pädagoge und war über dreißig Jahre lang in der Fachklinik Fredeburg/Sauerland für Suchtmittelabhängige psychotherapeutisch tätig.
Die Zahl der Sexualpartner nimmt ständig zu
Ein von der sexuellen Revolution ausgelöste Wandel sieht Eva Illouz im enormen Anstieg der Zahl der Sexualpartner, die man im Laufe seines Lebens hat. Dabei ist das Sammeln sexueller Erfahrungen für viele Menschen aus unterschiedlichen sozioökonomischen Gruppen zu einem wichtigen und eigenständigen Aspekt des Sexuallebens geworden. Vorehelicher Sex wurde zunehmend legitim. Und je länger die Zeitspanne ist, die zwischen dem ersten Sexualpartner und der Wahl eines dauerhaften Lebenspartners liegt, desto wahrscheinlicher neigen Menschen dazu, sexuelle Erfahrungen anzuhäufen. Dies legt für Eva Illouz nahe, dass Sexualität inzwischen als ein Betätigungsfeld verstanden wird, in dem es darum geht, einen Erfahrungsschatz zu akkumulieren und eine große Zahl von Partnern kennenzulernen. Eva Illouz ist Professorin für Soziologie an der Hebräischen Universität von Jerusalem. Außerdem ist sie Studiendirektorin am Centre européen de sociologie et de science politique de la Sorbonne.
Sinnerleben ist immer etwas Individuelles
Für das Thema Zuversicht ist laut Ulrich Schnabel das Erleben von Sinn von zentraler Bedeutung. Die Frage ist nur: Wie findet man den persönlichen Lebenssinn? Anders als so vieles andere in der unerschöpflichen Warenwelt kann man sich einen Sinn ja nirgendwo kaufen. Man kann noch nicht einmal, im Unterschied zur käuflichen Liebe, sich einen Sinn borgen oder sich eine Art Pseudosinn zulegen. Ulrich Schnabel weiß: „Denn eine echte Sinnerfahrung ist vor allem eines: eine Erfahrung und kein Gedankenkonstrukt. Sinn wird erlebt, nicht intellektuell erfasst.“ Entweder ein bestimmtes Tun fühlt sich sinnvoll für einen Menschen an – oder eben nicht. Und dieses Gefühl lässt sich nicht betrügen. Das bedeutet auch, dass ein Sinnerleben immer etwas Individuelles ist. Ulrich Schnabel ist seit über 25 Jahren Wissenschaftsredakteur bei der ZEIT.
Die Vernunft ist die Matrix des Weltgeschehens
Die Leistung der Vernunft erschließt sich laut Volker Gerhardt nicht im rationalen Schließen. Um dies anschaulich zu machen, muss man ihre Tätigkeitsfelder in den Blick nehmen. Dann zeigt sich schnell, welchen Beitrag ihr allein die Organisation des Wissens verdankt. Denn Wissenschaft ist ohne methodische Anleitung, planvolle Heuristik und systematische Schlussfolgerungen nicht möglich. Vor allem im Maschinenwesen ist die Wirksamkeit einer planenden Hand, die eine rationale Überlegung steuert, unübersehbar. Selbst Riten, Zeremonien und Institutionen sind nicht mehr und nicht weniger als angewandte und sozial wirksame Vernunft. Die zentrale Leistung der Vernunft ist dabei das Begreifen von Ganzheiten. Es liegt sogar nahe, die Vernunft als Matrix des gesamten Weltgeschehens anzusehen. Volker Gerhardt war bis zu seiner Emeritierung 2014 Professor für Philosophie an der Humboldt-Universität in Berlin.
Alle Emotionen sind auf ein Objekt gerichtet
Martha Nussbaum vertritt die Auffassung, dass sämtliche Emotionen mit einem Denken oder Wahrnehmen verbunden sind, das intentional auf ein Objekt gerichtet ist – als Gegenstand, welchen die Person, die die Emotion wahrnimmt oder sich vorstellt. Zugleich sind sie mit einer wertenden Beurteilung dieses Objekts verbunden, die der jeweilige Akteur aus seiner eigenen Perspektive wahrnimmt. Dabei gibt er dem Objekt in Bezug auf seine Ziele und Zwecke eine Bedeutung. Martha Nussbaum nennt ein Beispiel: „Darum trauern wir nicht wegen jedem Todesfall auf der Welt, sondern nur wegen dem Tod der Menschen, die uns in unserem Leben wichtig erscheinen.“ Diese Beurteilung muss nicht mit fertigen Überzeugungen verbunden sein, auch wenn dies häufig der Fall ist. Martha Nussbaum ist Philosophin und Professorin für Rechtswissenschaften und Ethik an der University of Chicago. Sie ist eine der einflussreichsten Philosophinnen der Gegenwart.
Moralische Urteile drücken Wertungen aus
Bei moralischen Prinzipien geht es darum, Schaden zu vermeiden. Warum gilt: „Du sollst nicht töten“ und „Du sollst nicht stehlen“? Weil die Folge einen Schaden für jemanden darstellt: den Verlust des Lebens und des Besitzes. Philipp Hübl stellt fest: „Unsere moralischen Urteile drücken also Wertungen aus. Und unsere Emotionen in gewisser Weise auch.“ Eine Spielart der Angst ist die Hemmung, andere zu töten. Auf der Seite der Moral ist das Tötungsverbot für alle Menschen und Kulturen ein universelles Gesetz. Jedem ist klar, dass das Leben einen Wert darstellt und der Tod als Verkürzung des Lebens somit einen Schaden anrichtet. Die Stärke der Angst spielt also für die moralische Einschätzung eine nicht unbedeutende Rolle. Philipp Hübl ist Philosoph und Autor des Bestsellers „Folge dem weißen Kaninchen … in die Welt der Philosophie“ (2012).
Angst und Zorn zählen zu den Grundemotionen
Aus biologischer Sicht spricht viel dafür, dass Menschen weltweit nur etwa ein Dutzend Grundemotionen hegen. Philipp Hübl kennt sie: „Klare Kandidaten sein Angst, Zorn, Ekel, Traurigkeit und Freude; andere wie Staunen, Eifersucht und Peinlichkeit sind umstrittener.“ Die Nuancen der Grundemotionen fächert die Wissenschaft allerdings sehr fein auf, und zwar oft nach den oben genannten Dimensionen … Weiterlesen
Resiliente Menschen können Krisen gut überstehen
Die sogenannte Resilienzforschung beschäftigt sich mit der Frage, was Menschen widerstandsfähig gegen Krisen macht. Ulrich Schnabel erläutert: „Der Begriff Resilienz bezeichnet eigentlich in der Materialkunde die Eigenschaft von Werkstoffen, nach starker Verformung wieder die ursprüngliche Gestalt anzunehmen. In der Psychologie werden heute Menschen als resilient bezeichnet, die Krisen gut verarbeiten und ohne Traumata überstehen.“ Üblicherweise werden dabei eine ganze Reihe von Faktoren genannt, welche diese seelische Widerstandskraft fördern: Wer etwa grundsätzlich optimistisch und kontaktfreudig ist, verarbeitet Krisensituationen leichter als depressive Eigenbrötler. Ebenso positiv ist es, eine Familie oder einen engen Freundeskreis um sich zu haben, in einem starken Glauben Halt finden zu können – sei der nun religiös, humanistisch oder politisch – oder in der Musik, Kunst oder Natur Trost zu erfahren, wenn alles andere finster erscheint. Ulrich Schnabel ist seit über 25 Jahren Wissenschaftsredakteur bei der ZEIT.
Es gibt keine allgemein akzeptiere Definition von „Angst“
Die Analyse der historischen Bedeutung von Angst stützt sich auf einige grundlegende Einsichten einer neu konzipierten und neuerdings wieder zunehmend populären Geschichte der Emotionen. Dass Emotionen eine Geschichte haben, ist keineswegs neu und geht auf den programmatischen Aufsatz des französischen Historikers Lucien Febvre aus dem Jahr 1941 zurück, in dem er eine „Geschichte des Hasses, eine Geschichte der Angst, eine Geschichte der Grausamkeit, eine Geschichte der Liebe“, propagierte. Frank Biess erklärt: „Febvre Aufsatz war tief verwurzelt in dem zeitgenössischen Verständnis der Emotionen als „primitive, basale Kräfte in uns“, die er dann auch für den Aufstieg des Faschismus in Europa mitverantwortlich machte.“ Seit der Jahrtausendwende hat das Interesse an Emotionen in der internationalen geistes- und sozialwissenschaftlichen Forschung wieder deutlich zugenommen. Frank Biess ist Professor für Europäische Geschichte an der University of California, San Diego.