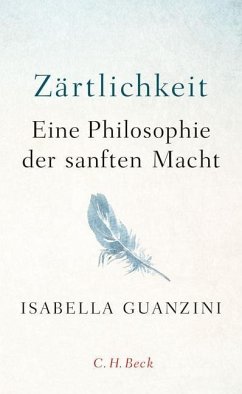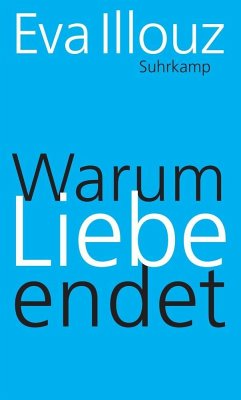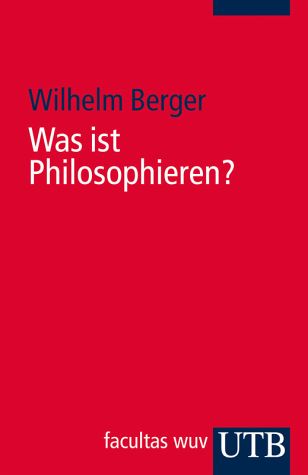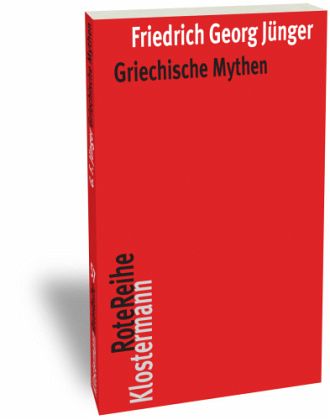Für den französischen Philosophen Gilles Deleuze sind die Affekte der Freude wie Sprungbretter, die einen Menschen mit Schwung über etwas hinwegtragen. Diese Hürde hätte er nie überwunden, wenn er nur traurig gewesen wäre. Es gibt sogar Leute, die werden besser in Latein, wenn sie verliebt sind. Womit hängt das zusammen? Wie macht man Fortschritte? Fortschritte verlaufen nie linear. Gilles Deleuze schreibt: „Eine kleine Freude katapultiert uns in eine Welt konkreter Ideen, die die traurigen Affekte weggefegt hat oder weiter bekämpft.“ Für Isabella Guanzini entsteht aus der Freude eine immer stärkere Intensität des Lebens, die ein immer dichteres Netz gesellschaftlicher Wirkungen entfaltet. Diese bringen Ideen in Fluss und können Ereignisse im vielfältigen Gewebe des Zusammenlebens anstoßen. Isabella Guanzini ist Professorin für Fundamentaltheologie an der Universität Graz.
Gilles Deleuze
Sex braucht weder Sünde noch Scham
Nur wenige kulturelle Projekte waren so total wie das der sexuellen Befreiung. Es befreite den Geschlechtsverkehr von Sünde und Scham. Und es verwandelte die Sexualität unter tätiger Mithilfe der Psychologen in ein Synonym für emotionale Gesundheit und Wohlbefinden. Eva Illouz ergänzt: „Zugleich war es ein Projekt, das darauf abzielte, Frauen und Männer, Heterosexuelle und Homosexuelle gleichzustellen. Damit war es auch ein wesentlich politisches Projekt.“ Die sexuelle Befreiung legitimierte darüber hinaus die sexuelle Lust als Selbstzweck. Zugleich nährte sie damit die Vorstellung von hedonistischen Rechten. Dabei handelt es sich um jenes diffuse kulturelle Gefühl, das Individuen einen Anspruch auf sexuelle Lust haben, um ein gutes Leben zu verwirklichen. Eva Illouz ist Professorin für Soziologie an der Hebräischen Universität von Jerusalem. Außerdem ist sie Studiendirektorin am Centre européen de sociologie et de science politique de la Sorbonne.
Keine menschliche Existenz verläuft ohne Sinnkrisen
Das aktuelle Philosophie Magazin 02/2015 beschäftigt sich in seinem Titelthema mit der Frage: „Machen uns Krisen stärker?“ Krisen sind immer Wendepunkte im Leben eines Menschen. Das Philosophie Magazin beantwortet die Frage, woran es sich entscheidet, ob ein Individuum an ihnen zerbricht oder wächst. Friedrich Nietzsche behauptet: „Was mich nicht umbringt, macht mich stärker.“ Seiner Meinung nach besteht jede existenzbedrohende Krise aus einem Konflikt zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart. Chefredakteur Wolfram Eilenberger erläutert, wie man existentielle Krisen nicht nur überleben, sondern sogar für sich nutzen kann. Ariadne von Schirach dagegen betrachtet den Menschen als ewiges Mangelwesen und meint: und das ist gut so. In einem Dialog suchen der Kulturtheoretiker Thomas Macho und der Autor und Fernsehmann Roger Willemsen nach dem Gleichgewicht zwischen einer beschädigten Existenz und der Liebe zur Welt.
Wilhelm Berger erklärt lustvoll die Grundlagen der Philosophie
Sein Buch „Was ist Philosophieren?“ versteht Wilhelm Berger als lustvolle Einführung in die mannigfaltigen Grundfertigkeiten des Philosophierens. Kurt Wuchterl leitet die Definition der Philosophie von großen Namen her: „Philosophie ist jeweils, was zum Beispiel Platon als „Erkenntnis des Seienden“ oder Hegel als „Wissenschaft der sich selbst begreifenden Vernunft“ konzipiert hat.“ Der polnische Logiker Joseph M. Bochenski stellt fast schon resignierend fest: „Ich kenne nur wenige Worte, die so viele Bedeutungen haben wie das Wort Philosophie.“ Für Arend Kulenkampff ist in der Philosophie nahezu alles strittig. Dieser Zustand ist allerdings kein Mangel, sondern Prinzip. Die Philosophie zeichnet sich auch dadurch aus, dass sie keinen Gegenstand besitzt. Wilhelm Berger, ao. Univ.-Prof. Dr., arbeitet am Institut für Technik- und Wissenschaftsforschung und ist Prodekan der Fakultät für Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung (IFF) an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt.
Mythen vermitteln tiefe Einblicke in die menschliche Seele
Die neue Sonderausgabe 02/2014 des Philosophie Magazins trägt den Titel „Die griechischen Mythen. Was sie über uns verraten“. Chefredakteur Thomas Lehmkuhl erklärt im Editorial den Unterschied zwischen Literatur und Mythen: „Mythen freilich sind etwas anderes als Literatur, denn Literatur ist im Wesentlichen durch ihre sprachliche Gestalt bestimmt, wohingegen Mythen so oder so erzählt werden können und sich über die Jahrhunderte auch immer wieder verändert haben.“ Das abendländische Denken stützt sich auf die beiden Säulen Mythos und Logos. Die Mythen handeln von Helden, Göttern und Halbgöttern, von Wesen, an die die Menschen einst glaubten. Der Ägyptologe und Kulturtheoretiker Jan Assmann glaubt, dass es in Einzelfällen schon möglich sein könnte, dass Mythen einen wahren Kern enthalten. Die Wahrheit der Mythen ereignet sich seiner Meinung nach allerdings im Erzählen, in der rituellen Aufführung und im Akt der Identifikation.