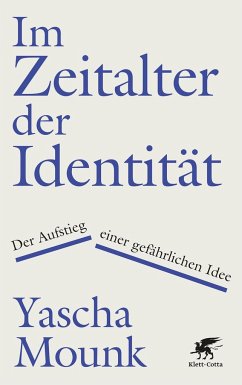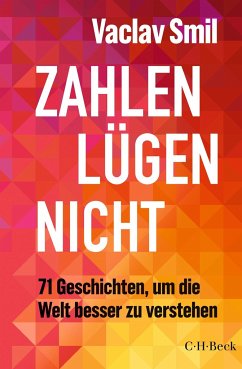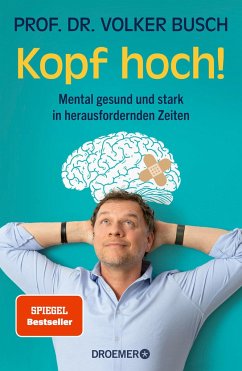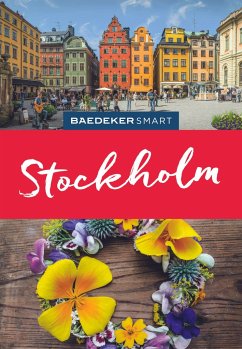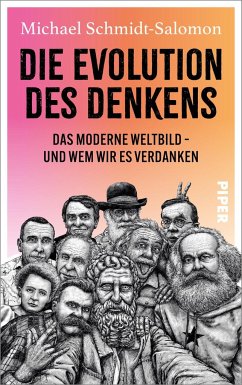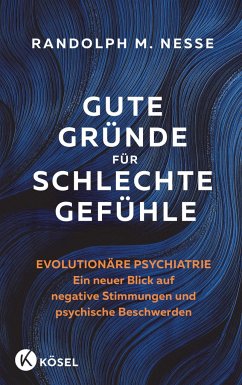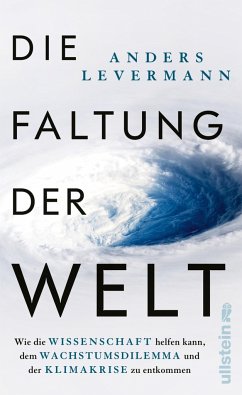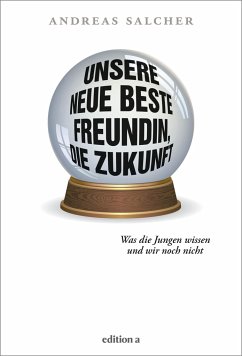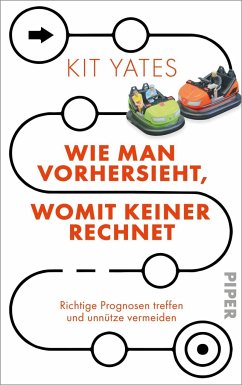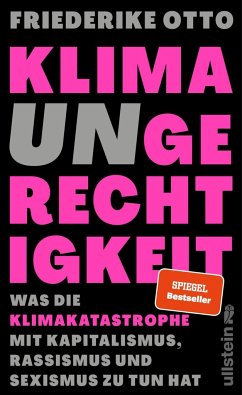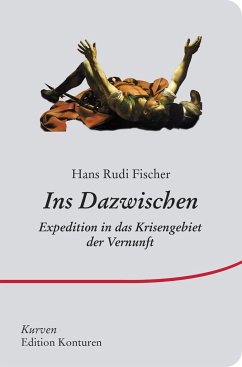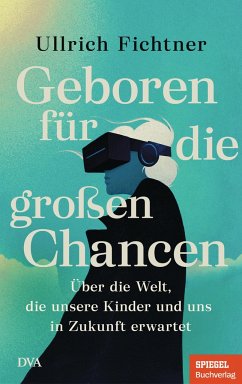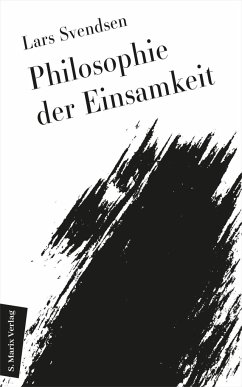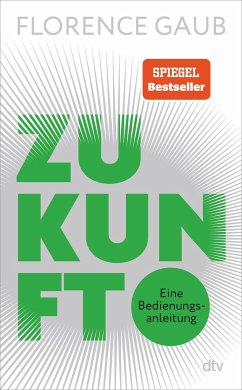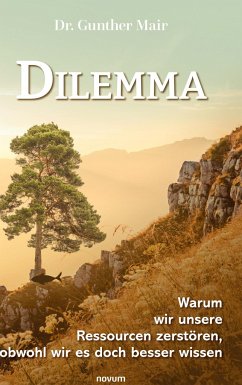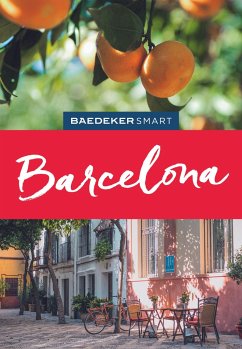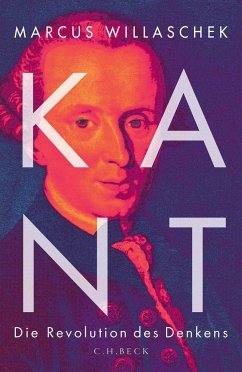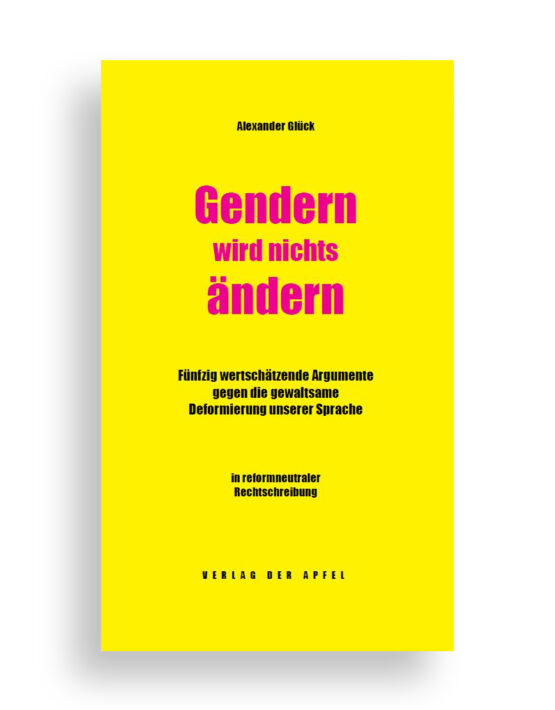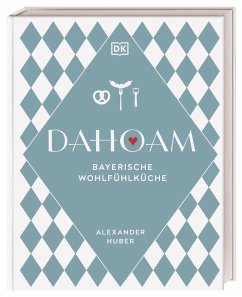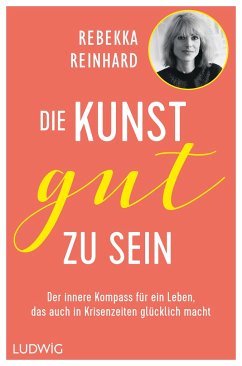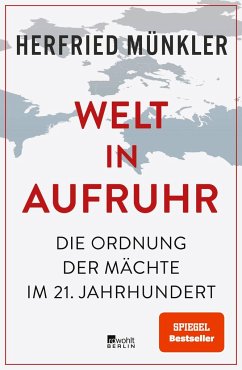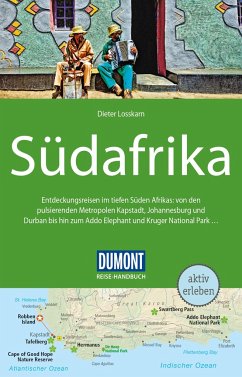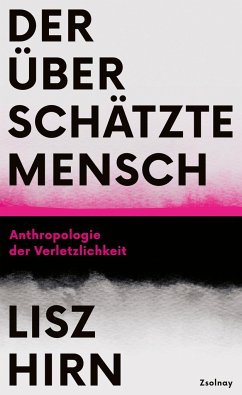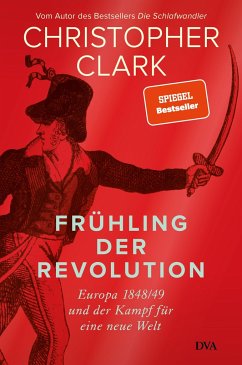In seinem neuen Buch „Im Zeitalter der Identität“ setzt sich Yascha Mounk mit dem wachsenden Einfluss neuer Ideen von der Rolle der Identität kritisch auseinander. Yascha Mounk schreibt: „Wie ich es darstelle, haben wir in den letzten Jahren nichts weniger als die Geburt einer neuen Ideologie erlebt – einer Ideologie, die weithin als „woke“ bekannt ist, obwohl ich den Begriff der „Identitätssynthese“ für trefflicher halte.“ Die Identitätssynthese wendete sich von Anfang an ausdrücklich gegen die Werte der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Sie peilt eine Gesellschaft an, in der Kategorien wie das Geschlecht, die Hautfarbe und die sexuelle Orientierung nicht etwa an Bedeutung verlieren – sondern stets bestimmen, wie sich Menschen einander wahrnehmen und behandeln. Yascha Mounk ist Politikwissenschaftler und lehrt an der Johns Hopkins Universität in Baltimore.
Buchrezensionen
Fakten führen zu einem besseren Verständnis der Welt
In seinem Buch „Zahlen lügen nicht“ hat Vaclav Smil alle Themen versammelt, die er seit den 1970er Jahren in vielen seinen Büchern behandelt hat. Dazu zählen Menschen, Bevölkerungen und Länder, Energieverbrauch und technische Innovationen, Maschinen und Geräte, welche die moderne Zivilisation definieren. Obendrein liefert „Zahlen lügen nicht“ am Ende noch einen faktenbasierten Ausblick auf die Nahrungsversorgung und Essgewohnheiten der Menschheit sowie auf den Zustand und Niedergang der Umwelt. Zuerst und vor allem ist es ein Anliegen dieses Buches, die Fakten zu klären. Alle genannten Zahlen stammen aus Primärquellen. Vaclav Smil betont: „Um verstehen zu können, was in unserer Welt wirklich vor sich geht, müssen wir im nächsten Schritt die Zahlen in den jeweils zughörigen historischen und internationalen Kontext einbetten.“ Vaclav Smil ist Professor für Umweltwissenschaften an der University of Manitoba.
Ein offener Geist fördert die mentale Stärke und Gesundheit
„Kopf hoch!“ ist ein Sachbuch mit Ratgeberfunktion, in dem Volker Busch versucht, ausgehend von einer knappen gesellschaftlichen „Zeitdiagnose“ Möglichkeiten für einen besseren Umgang mit den psychischen Belastungen des Alltags zu beschreiben. Dabei konzentriert er sich auf die mentale Stärkung und die Stabilisierung. Hauptbestandteile dieses Buches sind Geist und Gehirn. „Kopf hoch!“ umfasst unter anderem einfach aufbereitete neurowissenschaftliche Fakten und therapeutisches Erfahrungswissen. Dieses Buch hat Volker Busch für Leser geschrieben, die angesichts ihrer aktuellen Lebensumstände in irgendeiner Weise belastet sind, ohne psychisch manifest krank zu sein. Er spricht diejenigen an, die im Laufe der letzten Zeit empfindsamer und weniger belastbar geworden sind, am Abend angespannt und gestresst sind, dünnhäutiger und reizbarer reagieren und schneller aus der Haut fahren als früher, nachdenklich geworden sind und viel grübeln oder ihre Leichtigkeit und Lockerheit im Leben vermissen. Prof. Dr. Volker Busch ist seit circa zwanzig Jahren als Arzt, Wissenschaftler, Autor und mehrfach ausgezeichneter Vortragsredner tätig.
Stockholms Wahrzeichen ist das prunkvolle Rathaus
Der Baedeker Smart Reiseführer Stockholm führt mit anregenden und erlebnisreichen Tagestouren durch die einzelnen Stadtteile der schwedischen Hauptstadt. Dabei gibt es viel zu entdecken, was ein Reisender nicht verpassen sollte und einige ganz besondere Ziele, die noch nicht jeder kennt. Dabei fehlen natürlich keine exklusiven Tipps für entspannte Pausen in Cafés, Restaurants oder Bars. Das Autorenduo schreibt: „Die Lage von Stockholm zwischen Mälarsee und Ostsee ist einmalig. Umso mehr lohnt es sich, einmal einen Blick über die Stadt zu werfen. Dazu gibt es unzählige Möglichkeiten. Am bekanntesten ist die Aussicht vom Rathausturm, aber auch der Blick auf die Altstadt von der Fjällgata oder dem Monteliusvägen ist nicht zu verachten.“ Die Stockholmer lieben das Wasser und die Schären. Viele Hauptstädter besitzen ein Wochenendhaus draußen auf einer Insel. Wer länger in Stockholm Urlaub machen möchte, kann sich auf den Schären selbst ein Ferienhaus mieten.
Die Flut der Informationen zerstört relevantes Wissen
Michael Schmidt-Salomon hat sein neues Buch „Die Evolution des Denkens“ unter anderem deshalb geschrieben, weil er in den letzten Jahren den Eindruck gewonnen hat, dass in der Flut der Informationen, die uns tagtäglich überschwemmt, relevantes Wissen verloren geht. Selbst in akademischen Kreisen scheint man die Grundlagen des modernen Weltbildes kaum noch zu kennen. Michael Schmidt-Salomon schreibt: „Diese kulturelle Demenz ist gefährlich, weil sie unsere Perspektive verengt. Wir verlieren die Orientierung und sind dazu verdammt, die gleichen Fragen immer und immer wieder neu zu diskutieren, obwohl die maßgeblichen Antworten schon vor Jahrzehnten, wenn nicht schon vor Jahrhunderten gefunden wurden.“ Deshalb stehen im Zentrum seines Buchs die Lebensgeschichten jener Menschen, die seines Erachtens besonders relevante Einsichten für die heutige Zeit hervorgebracht haben. Michael Schmidt-Salomon ist freischaffender Philosoph und Schriftsteller sowie Vorstandssprecher der Giordano-Bruno-Stiftung.
Manchmal sind schmerzliche Gefühle normal
Randolph M. Nesse vertritt in seinem neuen Buch „Gute Gründe für schlechte Gefühle“ folgende These: „Gerade die evolutionären Entwicklungen, die uns zu sozialen Handeln und kognitiven Leistungen befähigen, sind auch dafür verantwortlich, dass wir mental leiden.“ Die Evolutionsmedizin bietet neue Erklärungsansätze, warum der menschliche Körper so krankheitsanfällig ist, die inzwischen auch bei psychischen Störungen systematisch zur Anwendung kommen. Randolph Nesses Buch ist ein breit gefächerter Bericht von der vordersten Front der Evolutionären Psychiatrie. Psychische Störungen sind eine so große Plage der Menschen, dass sich alle unverzüglich Lösungen wünschen. Die Evolutionäre Psychiatrie kann dazu hilfreiche philosophische Erkenntnisse bieten. Professor Randolph M. Nesse ist Mitbegründer der Evolutionären Medizin. Seit 2014 lehrt er and er University of Arizona, wo er als Gründungsmitglied und Direktor das Center for Evolution and Medicine leitet.
Ein Ausweg aus de Wachstumsdilemma und der Klimakrise ist möglich
Anders Levermann beschäftigt sich in seinem Buch „Die Faltung der Welt“ unter anderem mit folgender Frage: „Wie ist unendliches Wachstum auf einem begrenzten Planeten möglich?“ In seinem Buch verbindet er Überlegungen aus zwei Welten – den Natur- und den Wirtschaftswissenschaften. Die Begrenztheit der Erde und seiner Ressourcen ist offensichtlich. Ein Dilemma entsteht dann, wenn man davon überzeugt ist, dass eine fortwährende Weiterentwicklung unausweichlich ist. Diese Weiterentwicklung muss darüber hinaus frei von Beschränkungen erfolgen, um tatsächlich effektive Lösungen für neue Herausforderungen zu finden. Dazu möchte Anders Levermann das Narrativ der Faltung anbieten, von dem er glaubt, dass es das Paradigma von unbegrenztem und stetigem Wachstum ersetzen kann. Der Physiker Anders Levermann arbeitet seit mehr als 20 Jahren am Potsdam-Institut für Klimaforschung. Zudem ist er Professor am physikalischen Institut der Universität Potsdam.
Es gibt eine Brücke zwischen dem Wissen und dem Vertrauen ins Leben
Die wichtigste Botschaft auf der das neue Buch von Andreas Salcher „Unsere neue beste Freundin, die Zukunft“ aufbaut, lautet: „Es existiert eine Brücke zwischen dem Wissen über unsere eigenen Fähigkeiten und dem Vertrauen ins Leben.“ Menschen, die mit diesem Grundvertrauen ausgestattet sind, können sich selbstbewusst an immer neue Aufgaben heranwagen. Dabei können sie herausfinden, wo ihre tatsächlichen Begabungen liegen. In seinem Ratgeber erklärt Andreas Salcher seinen Lesern, welche neuen Denkweisen und Talente sie brauchen, um in einer sich schnell verändernden Welt erfolgreich zu sein. Schon immer birgt die Jugend aus der Sicht der Erwachsenen ein Geheimnis. Dr. Andreas Salcher ist Mitgebegründer der „Sir Karl-Popper-Schule“ für besonders begabte Kinder. Mit mehr als 250.000 verkauften Büchern gilt er als einer der erfolgreichsten Sachbuchautoren Österreichs.
Für Kit Yates kommt Unerwartetes wenig überraschend
Kit Yates beschreibt in seinem neuen Buch „Wie man vorhersieht, womit keiner rechnet“, wie man richtige Prognosen trifft und unnütze vermeidet. Die Zukunft vorherzusagen birgt Gefahren. Dennoch kommt man um solche Vorhersagen nicht herum. Kit Yates schreibt: „Gesellschaftlich gedacht, sollten wir zum Wohle aller in der Lage sein, wirtschaftliche Talstrecken vorherzusagen und darauf zu reagieren; wir sollten Terroranschläge vorhersagen und abwehren können, und wir sollten die aktuelle und potenzielle Bedrohung durch den Klimawandel verstehen, um etwas dagegen unternehmen zu können.“ Liegt man bei derart weitreichenden Vorhersagen falsch, können Existenzen, Menschenleben und sogar das Schicksal des Homo sapiens auf dem Spiel stehen. Kit Yates lehr an der Fakultät für mathematische Wissenschaften und is Co-Direktor des Zentrums für mathematische Biologie der University of Bath.
Der Klimawandel verschärft die gesellschaftlichen Ungleichheiten
Friederike Otto beschreibt in ihrem Buch „Klimaungerechtigkeit“ wie der Klimawandel gesellschaftliche Ungleichheiten verschärft. Denn die Wohlhabenden sind nicht diejenigen, die am heftigsten von den Folgen ihres Verhaltens betroffen sind. Die Auswirkungen von Extremereignissen wie Hitzewellen in Kanada und Afrika oder Überschwemmungen in Pakistan haben die unterschiedlichsten Auswirkungen. Jedes Zehntel Grad globaler Erwärmung führt zu immer größeren Schäden und Verlusten. Aber wer diese spürt und wie, hängt nur zu einem ganz geringen Teil vom Wetter und Klima ab. Die Autorin weiß, was getan werden muss, um die Welt unter diesen neuen Vorzeichen zu einer gerechten zu machen. Friederike Otto forscht am Grantham Institute for Climate Chance zu Extremwetter und dessen Auswirkungen auf die Gesellschaft. Sie hat das neue Feld der Zuordnungswissenschaft – Attribution Science – mitentwickelt.
Hans Rudi Fischer reist ins Dazwischen
Die Fragen, denen Hans Rudi Fischer in seinem Buch „Ins Dazwischen“ nachgeht, führen in das Krisengebiet der Vernunft. Dabei handelt es sich um eine Gebiet, in dem man die Orientierung verliert. Denn dort reichen die klassischen Kategorien und die übliche Logik nicht mehr, um die Welt zu begreifen. Hans Rudi Fischer schreibt: „Wir geraten in ein Dazwischen, in dem die alten kognitiven Muster nicht mehr greifen und die neue noch nicht vorhanden sind. Dieser Raum des Dazwischen soll hier erkundet werden.“ Als Beispiel für dieses Dazwischen nennt Hans Rudi Fischer die Metapher. Denn sie ist weder logisch richtiges Denken noch ein Denkfehler. Sie markiert ein Dazwischen, eine Metamorphose des Zeichensystems der Menschen, mit dem sie die Welt repräsentieren. Hans Rudi Fischer ist Philosoph und Psychologe. Seit 30 Jahren arbeitet er als Lehrender Therapeut, Coach und Organisationsberater.
Die Welt bietet den Menschen unendliche Möglichkeiten
Ullrich Fichtner stellt in seinem neuen Buch „Geboren für die großen Chancen“ dem allgegenwertigen Pessimismus eine positivere Sicht der Dinge gegenüber. Dennoch ist der Autor weit entfernt, die Gegenwart durch eine rosarote Brille zu betrachten. Ullrich Fichtner schreibt im Vorwort: „Die Welt wird genommen, so gebrechlich, wie sie eben ist, Gefahren werden nicht ausgespart, aber ein guter Verlauf für alle und alles wird trotzdem für möglich gehalten.“ Anders als offen ist die Zukunft nicht zu haben. Mit Umbrüchen ist jederzeit zu rechnen, mit schrecklichen und glücklichen Zufällen auch. Die Geschichte ist voll von ihnen. Ullrich Fichtner will in seinem Buch Gegenwart und Zukunft anders erzählen. Nicht als Verhängnisse, sondern als Möglichkeiten. Ullrich Fichtner ist Reporter des „Spiegel“ und gehört zu den renommiertesten Journalisten Deutschlands.
Einsamkeit kann für die Betroffenen ein ernstes Problem sein
Das Buch „Philosophie der Einsamkeit“ ist der Versuch von Lars Svendsen herauszufinden, was Einsamkeit eigentlich ist, wer davon betroffen ist und warum das Gefühl von Einsamkeit entsteht, andauert und verschwindet. Die Behauptung, dass Einsamkeit für die Betroffenen ein erster Problem sein kann, ist ungefähr das Einzige, was stimmt. Das hat Lars Svendsen bei den Recherchen zu seinem Buch herausgefunden. Einsamkeit hat enorme Konsequenzen für die Lebensqualität vieler Menschen, für ihre physische sowie psychische Gesundheit. Allerdings ist es schwer darüber zu sprechen, weil das Thema so mit Scham belegt ist. Aber gleichzeitig gilt auch, dass Menschen ihre besten Stunden dann haben, wenn sie allein sind. Lars Frederik Händler Svendsen ist Philosoph und Professor für Philosophie an der Universität Bergen. Seine Werke wurden in mehr als 20 Sprachen übersetzt und mehrfach ausgezeichnet.
Die Zukunft ist so real wie die Gegenwart
Florence Gaub vertritt in ihrem Buch „Zukunft“ die These, dass die Zukunft in den Gehirnen der Menschen so real ist wie die Gegenwart. Die Autorin schreibt: „Sie ist also nicht eine Zeit, die noch kommt, sondern ein individueller, kreativer, imaginärer und sinnlicher Prozess, bei dem eine zukünftige Realität erzeugt wird.“ Diese Fähigkeit bildet die Basis für Erwartungen, Entscheidungen und den freien Willen. Daher sind Menschen nicht nur Wesen, die durch ihre Fähigkeit zur Vernunft definiert sind. Sondern sie können gedanklich auch in die Zukunft reisen. Für Florence Gaub ist die Zukunft keine ferne Zeit, sondern etwas, das alle Menschen ständig erzeugen. Obwohl man das Wort Zukunft in der Regel in der Einzahl benutzt, ist sie eigentlich immer eine Vielzahl. Die Zukunft ist zudem alles, was sich Menschen über sie vorstellen können. Dr. Florence Gaub ist Politikwissenschaftlerin, Militärstrategin und Zukunftsforscherin. Sie leitet als Direktorin den Forschungsbereich NATO Defense College in Rom.
Der Klimawandel und das Artensterben bedrohen die Menschheit
In seinem Buch „Dilemma“ beschreibt Gunther Mair zwei große Probleme, welche die Erde als Ganzes betreffen. Erstens ist das der Klimawandel, der die Menschheit in kurzer Zeit von einer geologischen Kaltphase in eine geologische Warmphase katapultieren könnte. Das zweite große Problem ist das Artensterben. Beide Arten der Veränderung, die des Klimas und die des Artenreichtums, sind bereits in der Vergangenheit mehrfach aufgetreten. Gunther Mair weiß: „Neu und damit bedrohlich sind das für geologische Verhältnisse ungeheure Tempo, in dem sich die Veränderungen vollziehen.“ Hinzu kommt die Tatsache, dass die Menschheit als Verursacher die katastrophalen Folgen der Zerstörung der Lebensgrundlagen vorhersieht und teilweise bereits spüren kann. Dr. Gunther Mair arbeitete als promovierter Chemiker in der chemischen Großindustrie und entdeckte dort sein Interesse für die Klimagasproblematik.
La Sagrada Familia ist das weltbekannte Wahrzeichen Barcelonas
Im handlichem Taschenformat präsentiert der Baedeker SMART-Reiseführer alle wichtigen Sehenswürdigkeiten Barcelonas in fünf Kapiteln. Alle touristischen Highlights der spanischen Metropole jedes Abschnitts sind in drei Rubriken gegliedert. Einzigartige Touristenattraktionen sind in der Liste der Top 10 zusammengefasst und zusätzlich mit zwei Baedeker-Sternen gekennzeichnet. Zu den Topzielen zählen die La Sagrada Familia. Die Kathedrale, deren Bau bis heute noch nicht abgeschlossen ist, zählt zu den weltbekannten Wahrzeichen Barcelonas. Ebenso berühmt ist La Rambla, die Flaniermeile, auf der sich Touristen aus aller Welt tummeln. Ebenso lohnenswert ist ein Besuch des gotischen Viertels, Barri Gòtic, dessen prachtvolle Architektur von der Blütezeit Kataloniens als Mittelmeermacht zeugt. Vom Park Güell hat man einen Traumblick über Barcelona. Gaudís Märchenpark begeistert mit dorischen Säulen, schrägen Arkaden und Drachenfiguren.
Immanuel Kant ist der bedeutendste Philosoph der Neuzeit
Marcus Willascheks Buch „Kant“ vermittelt einen umfassenden Einblick in die Philosophie Immanuel Kants. In dreißig kurzen Kapiteln stellt der Autor die verschiedenen Themen und Aspekte von Kants Denken vor. Marcus Willascheks Darstellungen sind jeweils verflochten mit biographischen und historischen Miniaturen. Dadurch entsteht ein Bild von Immanuel Kant als Mensch und Philosoph seiner Zeit. Zugleich verdeutlicht Marcus Willaschek die aktuelle Relevanz – und gelegentlich auch die Problematik – seines revolutionären Denkens. Im Vorwort schreibt Marcus Willaschek: „Immanuel Kant ist der bedeutendste Philosoph der Neuzeit, die „Kritik der reinen Vernunft“ ein Meilenstein der Geistesgeschichte. Seit Platon und Aristoteles hat niemand über so viele und unterschiedliche Themen tiefer und innovativer nachgedacht als Kant.“ Marcus Willaschek ist ein international führender Kant-Experte und Professor für Philosophie der Neuzeit an der Goethe-Universität Frankfurt am Main.
Alexander Glück kritisiert die Gendersprache scharf
In seiner Streitschrift „Gendern wird nichts ändern“ stellt der deutsch-österreichische Publizist Alexander Glück fünfzig Argumente gegen das Gendern vor. Dabei setzt er sich sachlich und fundiert mit der Gendersprache auseinander, kritisiert sie aber teilweise dennoch scharf: „Die gewaltsame Durchsetzung von „geschlechtergerechten“ Schreibweisen als Erfolg zu feiern, ist an Dümmlichkeit kaum zu überbieten. Die durch sie angerichteten Schäden überwiegend den angeblichen Nutzen bei weitem.“ Die Gendersprache nimmt den Menschen die Freiheit des Ausdrucks und unterstellt ihnen, etwas anderes zu meinen, als sie es selbst beabsichtigen. Emanzipation bedeutet für Alexander Glück ja gerade, frei zu werden von der Herrschaft des Patriarchen, aber auch von Anweisungen schmallippiger Gouvernanten. Alexander Glück machte seinen Magisterabschluss 1996 mit einer buchwissenschaftlichen Arbeit über die deutsche Jugendbewegung.
Sternekoch Alexander Huber liebt die bayerische Küche
In dem bayerischen Kochbuch „Dahoam“ vom Sternekoch Alexander Huber warten 90 Rezepte für jede Gelegenheit darauf, nachgekocht zu werden. „Dahoam“ heißt Heimat, und diese verbindet der Autor nicht nur mit der ländlichen Schönheit, sondere insbesondere mit der bayerischen Kulinarik. Ganz egal, ob es sich dabei um einen Sonntagsbraten, eine Brotzeit im Biergarten oder Omas Gerichte handelt. All sein Wissen hat Alexander Huber in sein Kochbuch „Dahoam“ hineingepackt. Seine Rezepte gehen weit über die traditionellen Bratengerichte hinaus. Ihm waren speziell auch die vegetarischen und leichten Gerichte ein Anliegen, an die man beim Stichwort „Bayerische Küche“ nicht sofort denkt. Bei jedem Rezept hat Alexander Huber eine Zutat, einen besonderen Kniff oder ein bisserl extra Küchenwissen mit dazu gepackt. Der Sternekoch Alexander Huber kocht in seinem beliebten Wirtshaus Huberwirt im oberbayerischen Pleiskirchen in der 11. Generation.
Die globale Digitalisierung ist die wahre Zeitenwende
In ihrem neuen Buch „Alles und nichts sagen“ geht Eva Menasse der Frage nach, was die digitale Massenkommunikation zwischenmenschlich angerichtet hat. Denn die Digitalisierung aller Lebensbereiche ist mit einer Wucht und Geschwindigkeit über die Menschheit hereingebrochen wie keine andere Erfindung zuvor. Eva Menasse schreibt: „Sie verändert sich und uns immer weiter, beständig nur in ihrem lawinenhaften Charakter.“ In eineinhalb Jahrzehnten sind die Bedingungen des Menschseins grundlegend andere geworden. Die globale Digitalisierung ist daher die einzige und wahre Zeitenwende. Die Grundlagen des Zusammenlebens haben sich fundamental verändert. Die Ansprüche, die Ungeduld und der Hass auf die Anderen sind gewachsen. Die Romane der österreichischen Schriftstellerin Eva Menasse sind vielfach ausgezeichnet worden.
Gut zu sein macht unter allen Umständen glücklich
Rebekka glaubt nicht, dass es schwer ist, gut zu sein. Und zu bleiben. Wie das funktioniert beschreibt sie in ihrem neuen Buch „Die Kunst gut zu sein“. Gut zu sein ist ihrer Meinung nach eine Haltung, eine Entscheidung, die immer und unter allen Umständen glücklich macht. Nämlich erstens diejenigen, die das Gute empfangen und zweitens jene, die es geben. Rebekka Reinhard schreibt: „Es beginnt mit einem Lächeln, das anderen signalisiert: Da ist jemand, der mich sieht. Als Mensch sieht.“ Ihr Buch soll Mut und Lust aufs Gutsein machen. „Die Kunst gut zu sein“ ist eine Einladung zur simplen Menschlichkeit, die man zu oft vergisst, weil ständig ein Termin, ein Konflikt, eine Zerstreuung dazwischenkommt. Rebekka Reinhard ist Chefredakteurin des Magazins „human“ über Mensch und KI. Unter anderem ist sie bekannt durch den Podcast „Was sagen Sie dazu?“ der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft wbg.
Die neue Weltordnung wird aus fünf Großmächten bestehen
Herfried Münkler analysiert in seinem neuen Buch „Welt in Aufruhr“ die aktuelle Geopolitik und zeigt, wo in Zukunft die Konfliktlinien verlaufen. Viel spricht seiner Meinung dafür, dass ein neues System regionaler Einflusszonen entsteht, dominiert von fünf Großmächten. Die letzten Jahrzehnte sind von tiefgreifenden und folgenreichen Veränderungen der weltpolitischen Konstellationen geprägt. Im globalen Süden hat es sogar eine Reihe disruptiver Entwicklungen gegeben, wie etwa das Ende der europäischen Kolonialreiche. Die jüngsten Veränderungen bezeichnet man daher gerne als „Weltunordnung“. Mit dem Ende des Ost-West-Konflikts zerfiel die Sowjetunion. Im Rückblick ist es immer noch frappierend, wie unspektakulär sich das Ende dieses vormals zentralen Akteurs der Weltpolitik vollzog. Herfried Münkler ist emeritierter Professor für Politikwissenschaft an der Berliner Humboldt-Universität. Viele seiner Bücher gelten als Standardwerke, etwa „Imperien“ oder „Die Deutschen und ihre Mythen“.
Für Südafrika gilt der Slogan: „Die Welt in einem Land“
Für Dieter Losskarn ist es fast unmöglich, eine bessere Beschreibung für das Reiseland Südafrika zu finden als den Slogan: „Die Welt in einem Land“. Der Schwarze Kontinent präsentiert sich hier seinen Besuchern in kontrastreicher Vielfalt. Es gibt weite Savannen, Wüstengebiete, Hochplateaus, Buschland und Regenwälder, aber auch pulsierende Metropolen und endlose Küsten mit Traumstränden. Natur- und Aktivurlaubern sind in Südafrika fast keine Grenze gesetzt. Allein auf den berühmten Tafelberg führen über 300 verschiedene Wanderwege, von anstrengend bis sehr anstrengend. Bei einem Besuch in Südafrika ohne Safari würde etwas fehlen. Im weltberühmten Kruger National Park kann man Elefanten, Nashörner, Löwen, Leoparden, Büffel und viele andere Wildtiere beobachten. Der Autor Dieter Losskarn ist Journalist und Fotograf und lebt seit 1994 in Kapstadt.
Die Spezies Mensch droht die Vernichtung
Die Abgrenzung zwischen „Tier“ und „Mensch“ war eine der wichtigsten Aufgaben der Philosophie. Sie nahm eine exklusive Vernunftbegabung an, um die außerordentliche Stellung des Menschen nicht nur auf der Erde, sondern sogar im Kosmos zu legitimieren. Als unspezifischer Gegenbegriff zum Menschen geistert „das Tier“ in einem verallgemeinerten Singular durch die Philosophiegeschichte. Lisz Hirn fordert: „Gerade wir, die wir durch die uns drohende Vernichtung Fragile geworden sind, erleben diese Kluft zwischen Fleisch und Geist, bedürfen einer neuen Anthropologie, die sich nicht jenseits, sondern in unserer Verletzlichkeit verortet.“ Laut Giorgio Agamben ist der Mensch in der westlichen Kultur immer als Trennung und Vereinigung eines Körpers und einer Seele gedacht worden. Lisz Hirn arbeitet als Publizistin und Philosophin in der Jugend- und Erwachsenenbildung, unter anderem am Universitätslehrgang „Philosophische Praxis“.
Die Revolutionen von 1848 sind in Wirklichkeit nicht gescheitert
In seinem neuen Buch „Frühling der Revolution“ stellt Christopher Clark die These auf, dass die Revolutionen von 1848 in Wirklichkeit nicht gescheitert sind. In vielen Ländern bewirkten sie einen zügigen und dauerhaften konstitutionellen Wandel. Außerdem sorgten die Revolutionen für tiefgreifende Veränderungen in politischen und administrativen Verfahren auf dem ganzen Kontinent. Dabei handelte es sich gewissermaßen um eine europäische „Revolution in der Regierung“. Christopher Clark fügt hinzu: „In ihrer Intensität und geographischen Reichweite waren die Revolutionen von 1848 einzigartig – zumindest in der europäischen Geschichte.“ Denn im Jahr 1848 brachen politische Unruhen zeitgleich auf dem ganzen Kontinent aus. In gewisser Weise handelte es sich jedoch auch um einen globalen Aufstand, oder anders gesagt, einen europäischen Aufstand mit globaler Dimension. Christopher Clark lehrt als Professor für Neuere Europäische Geschichte am St. Catharine’s College in Cambridge. Sein Forschungsschwerpunkt ist die Geschichte Preußens.