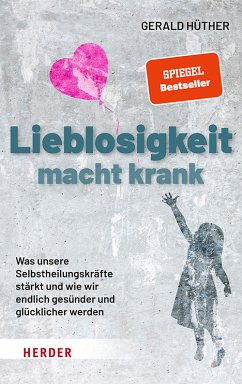Die Kennzeichnung von Menschen als vulnerable dient dazu, deren Anliegen und Interessen als besonders bedeutsam zu markieren und die Gesellschaft darauf aufmerksam zu machen. Was allerdings eher neu zu sein scheint, ist der Umfang, in dem Vulnerabilitäten ernstgenommen werden. Frauke Rostalski schreibt in ihrem neuen Buch „Die vulnerable Gesellschaft“: „Aktuelle Debatten über Vulnerabilität lassen sich deshalb zugleich für ein Zeichen dafür deuten, dass eine Wertediskussion ansteht und ein Wertewandel im Gang ist – ein Wandel, der nicht zuletzt mit rechtlichen Mitteln vollzogen werden soll.“ Damit tritt aber eine weitere Kategorie auf den Plan, die für das gesellschaftliche Miteinander von besonderer Bedeutung ist: die Freiheit. Frauke Rostalski ist Professorin für Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechtsphilosophie, Wirtschaftsrecht, Medizinstrafrecht und Rechtsvergleichung an der Universität zu Köln.
Vulnerabilität
Krankmachende Vorstellungen behindern die Selbstheilungskräfte
Am Beispiel des Nocebo-Effektes lässt sich die krankmachende Wirkung krankmachender Vorstellungen am leichtesten verstehbar machen. Gerald Hüther weiß: „Der menschliche Organismus verfügt über Selbstheilungskräfte, die ihre Wirkung insbesondere über die im gesamten Organismus ausgebreiteten integrativen Systeme entfalten: das autonome Nervensystem, das Hormonsystem, das kardiovaskuläre System und das Immunsystem.“ Gesteuert und koordiniert wird deren Aktivität im Gehirn nicht von der Hirnrinde, sondern von neuronalen Netzwerken, die in entwicklungsgeschichtlich älteren und tiefer im Hirn gelegenen Bereiche lokalisiert sind. Diese Netzwerke dienen der Regulation der im Körper ablaufenden Prozesse. Sie sind nicht daran beteiligt, wenn sich ein Mensch etwas vorstellt oder ausdenkt. Deshalb gibt es diese Netzwerke auch schon bei den Krokodilen. Solange sie in ihren Aktivitäten und ihrem Zusammenwirken durch nichts gestört werden, ist alles gut. Gerald Hüther ist Neurobiologe und Verfasser zahlreicher Sachbücher und Fachpublikationen.
Die Bürger sind für eine stabile Demokratie verantwortlich
Das neue Philosophie Magazin 04/2024 geht im Titelthema der Frage nach: Ist die Demokratie auf Sand gebaut? Chefredakteurin Svenja Flaßpöhler schreibt dazu: „Tatsächlich erlebt wohl jeder Mensch diese Momente, in denen man am Fundament unserer Staatsform, die alle Macht dem Volk verleiht, schier verzweifelt.“ Auch wenn alle Macht beim Volk liegt, gibt es kein Prüfsiegel für Mündigkeit und moralische Integrität. Niemand muss vor dem Wahlgang beweisen, dass er urteilsfähig ist. Der Rechtsphilosoph und Verfassungsrichter Ernst-Wolfgang Böckenförde sagt: „Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das ist das große Wagnis, das er, um der Freiheit willen, eingegangen ist. Demokratien sind nur so lange stabil, wie die Bürger bestimmte, freiheitliche Werte teilen. Etwa, dass die Würde eines jeden Menschen unantastbar ist.