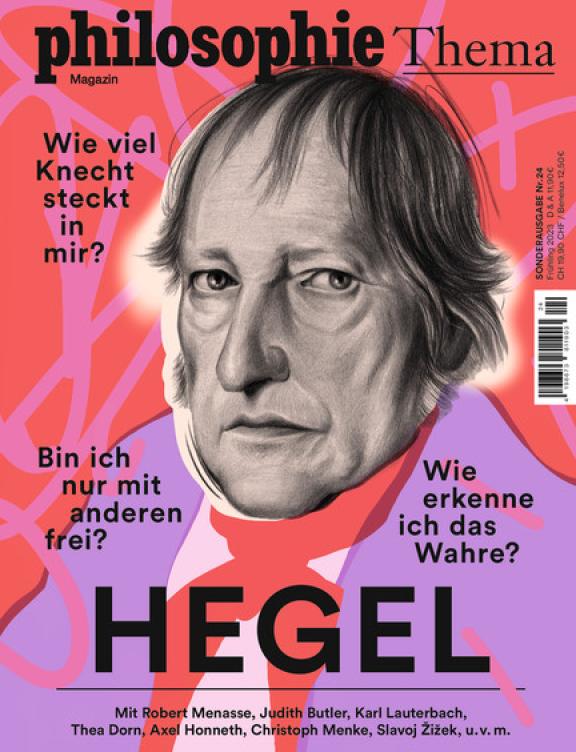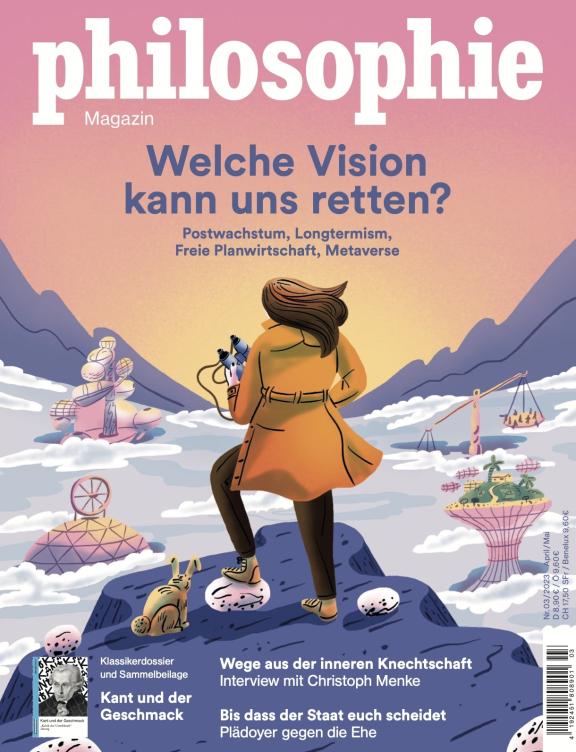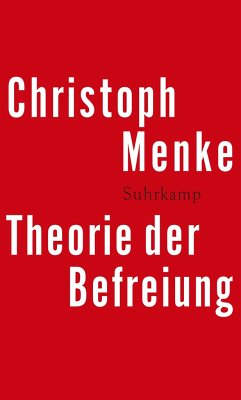Die Sonderausgabe des Philosophie Magazins steht diesmal ganz im Zeichen von Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Denn er zählt zu den wirkmächtigsten Philosophen der Geschichte. Seine Überlegungen zu Fortschritt, Staat und Freiheit sind von ungebrochener Aktualität. Seine Werke gelten zwar als schwer verständlich, doch sie werden dennoch weiter gelesen. So zum Beispiel von dem österreichischen Schriftsteller und Essayisten Robert Menasse: „Als ich die ersten Seiten der „Phänomenologie des Geistes“ las, wusste ich sofort, dass ich „meinen“ Philosophen gefunden hatte. Keinen Mann mit klugen Gedanken, sondern den Geist von Selbst- und Weltverständnis.“ Was viele Menschen an der Philosophie Hegels fasziniert, ist das Versprechen der Vernunft. Nichts, weder Natur noch Geschichte noch die soziale Wirklichkeit kann seiner Meinung nach der Vernunft widerstehen. Er beharrt sogar darauf, dass selbst das Unvernünftigste noch einen Keim der Vernunft in sich trägt.
Christoph Menke
Neue Visionen braucht das Land
Das neue Philosophie Magazin 03/2023 stellt in seinem Titelthema die Frage: „Welche Vision kann uns retten?“ Die vier möglichen, teilweise utopischen Antworten lauten: Postwachstum, Longtermism, Freie Planwirtschaft und Metaverse. Chefredakteurin Svenja Flaßpöhler schreibt in ihrem Editorial: „Gewiss Visionen wohnen Gefahren inne; wenn sie zur Ideologie gerinnen, können sie tödlich sein. Doch wenn sie die Verbindung zum Leben nicht verraten, sondern aus ihr erwachsen, bergen sie größtes Potenzial.“ Um den Problemen, die nicht nur die Menschheit, sondern den Planeten Erde als solchen bedrohen, angemessen zu begegnen, ist ein einfaches „weiter so!“ keine Option. Umso dringender benötigen die Menschen positive Zukunftsentwürfe, die ihrem Handeln ein Ziel geben und sie motivieren, im Hier und Jetzt den richtigen Weg einzuschlagen. Kurz: Sie brauchen neue Visionen.
Die Befreiung dient der Rechtfertigung von Herrschaft
Christoph Menke vertritt in seinem Buch „Theorie der Befreiung“, dass sich die Menschheit in einer Zeit der gescheiterten Befreiungen befindet. Denn die Befreiung von äußerer Herrschaft und Bevormundung hat zu Regimen der Selbstkontrolle und Selbstdisziplin geführt. Die Befreiung der menschlichen Bedürfnisse und Interessen aus den Grenzen, die ihnen durch Tradition und Sittlichkeit gezogen waren, hat sie der Verwertungslogik der kapitalistischen Ökonomie unterworfen. Alle Befreiungsversuche, ob politisch, ökonomisch, rechtlich, ethische, kulturell oder künstlerisch, haben sich in Paradoxien und Widersprüche verfangen. Sie haben neue Gestalten und Strategien der Herrschaft hervorgebracht. Christoph Menke betont: „Mehr noch ist offensichtlich geworden, dass die Befreiung in Wahrheit immer schon der Rechtfertigung von Herrschaft diente.“ Christoph Menke ist Professor für Philosophie an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main.
Jeder sollte die Kunst des Verstehens erlernen
Das Titelthema des neuen Philosophie Magazins 01/2023 kreist um die Frage: „Kannst du mich verstehen?“ Denn verstanden zu werden, ist existenziell. Wenn auf Dauer keine Verbindung zwischen Innen und Außen besteht, ist Gefahr im Verzug. Auch auf der gesellschaftlichen Ebene erleben die Deutschen gerade, wie tief der Spalt sein kann, den wechselseitiges Unverständnis erzeugt. Auf kein Verständnis zu stoßen, führt im persönlichen Bereich zu Frustrationen, auf der gesellschaftlichen Ebene gar zu Hass. Umso dringender ist es, die Kunst des Verstehens zu erlernen, die Voraussetzungen ihres Gelingens zu kennen. Theresa Schouwink schreibt: „Generell fällt es leicht, in der sogenannten polarisierten Gesellschaft eine Krise des Verstehens zu diagnostizieren.“ Auch das Verstehen über Generationen hinweg, zwischen rücksichtslosen „Boomern“ und übersensiblen „Schneeflocken“, scheint zunehmen schwierig.