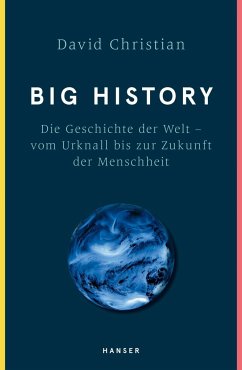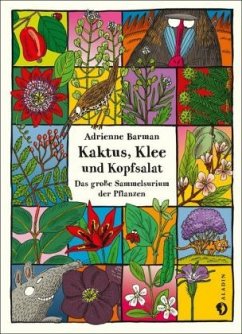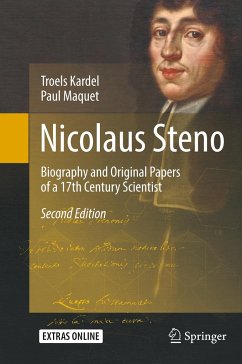David Christian erzählt in seinem neuen Buch „Big History“ die Geschichte der Welt anhand von verschiedenen Schwellenmomenten, in denen die Komplexität zunahm: von der Entstehung des Lebens bis zur Fotosynthese, von der Sprache bis zum menschengemachten Klimawandel. Sein Buch ist eine Synthese der Erkenntnisse aus Physik, Chemie, Biologie, Geologie und Archäologie. Es endet mit einem Ausblick in die Zukunft, in der die Menschheit endlich die Verantwortung für den Planeten Erde übernehmen muss. Um die Geschichte der Menschheit zu verstehen, muss man begreifen, wie sich so eine seltsame Art entwickelte. Das heißt, man muss etwas über die Entwicklung der Erde, der Sterne und der anderen Planeten erfahren, und das bedeutet letztlich, sich die Geschichte des Universums anzueignen. David Christian ist Gründer und wichtigster Vertreter der Big History, die zeigen will, dass Geschichte und Naturgeschichte zusammengehören.
Geologie
John Ray beschreibt 18.000 Pflanzen
Die Gelehrsamkeit aus Büchern überzeugte den Naturkundler John Ray nicht. Er wollte die Dinge der Natur selbst untersuchen. Sein besonderes Interesse galt dabei den Pflanzen. Er war davon überzeugt, dass die Vielfalt der Natur kein bloßes Ergebnis des Zufalls sein kann. John Ray wirkte als Lehrer am Trinity College, wobei er nebenbei naturwissenschaftliche Studien treiben konnte und einen kleinen botanischen Garten einrichtete. 1660 veröffentlichte er das Buch „The Catalogue of Cambridge Plants“, in dem er 670 Arten der heimischen Pflanzenwelt beschrieb.
Nicolaus Steno entwickelt die Grundlagen der Geologie
Nicolaus Steno entwickelte die wissenschaftlichen Grundlagen, um die Erdgeschichte durch Untersuchungen ihrer Gesteinsschichten zu ergründen. Aber nicht nur als Geologe machte sich Nicolaus Steno einen Namen, sondern war vorher auch als Anatom sehr angesehen, der die Kunst des Sezierens meisterhaft beherrschte. Seine Untersuchungen deckten manchen Aberglauben über die Muskeln, das Herz und das Hirn auf. Beispielsweise fand Nikolaus Steno heraus, nachdem er die Muskeln in ihre feinsten Teile zerlegt hatte, dass es sich bei ihnen um ein Bündel kontraktiler Fasern handelt. Außerdem stellte er bei seinen Untersuchungen fest, dass das Herz auch nur ein Muskel ist.