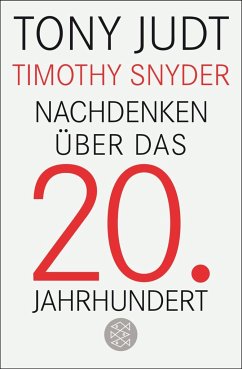In Amerika beteiligen sich laut Tony Judt immer weniger Menschen an politischen Wahlen. Auch in England wird bei Parlamentswahlen seit den siebziger Jahren eine sinkende Wahlbeteiligung registriert. Die Wahlen zum Europäischen Parlament, die erstmals 1979 stattfanden, sind für extrem niedrige Wahlbeteiligung bekannt. Für Tony Judt handelt es sich dabei um ein schwerwiegendes, negatives Phänomen. Er schreibt: „Weil man, wie die alten Griechen schon wussten, durch Beteiligung an den öffentlichen Angelegenheiten nicht nur unterstreicht, dass man für die Verfassung des Staatswesens mit verantwortlich ist. Dieses Engagement zwingt die Regierenden auch zu transparentem Handeln und beugt autoritären Tendenzen vor.“ Tony Judt, der von 1948 bis 2010 lebte, lehrte nach Stationen in Cambridge, Oxford und Berkeley seit 1995 als Erich-Maria-Remarque-Professor für Europäische Studien in New York.
Die Gefahr eines Demokratiedefizits in einer repräsentativen Demokratie
Tony Judt ist sich ganz sicher, dass politisches Desinteresse gefährlich ist, wenn es mehr als die gesunde Abkehr von jenen ideologischen Grabenkämpfen ist, mit denen die Stabilisierung Westeuropas nach dem Zweiten Weltkrieg einherging. Tony Judt schreibt: „Wenn wir den Eindruck haben, politisch nichts bewirken zu können, werden wir unsere Stimme nicht mehr erheben, dürfen uns dann aber auch nicht wundern, wenn uns niemand mehr hört.“ Die Gefahr eines Demokratiedefizits ist gemäß Tony Judt in einer repräsentativen Demokratie immer gegeben.
Direkte Demokratie dagegen, die in kleinen politischen Einheiten praktiziert wird, fördert die aktive Beteiligung der Bevölkerung an der Politik, wenn auch mit dem Risiko von Konformität und Mehrheitstyrannei. Es gibt für Tony Judt zum Beispiel kaum etwas Schwierigeres als in eine Stadtratssitzung eine abweichende Meinung zu vertreten. Tony Judt schreibt: „Vertreter zu benennen, die in einer Versammlung für uns sprechen, ist in großen, komplexen Gemeinschaften ein vernünftiger Weg, einen Ausgleich zwischen den verschiedenen Interessen zu finden.“
Die Politiker von heute haben keine klaren Standpunkte mehr
Solange die Menschen ihre politischen Repräsentanten nicht auf ein imperatives Mandat verpflichten, müssen sie ihnen die Freiheit lassen, ihrem eigenen Urteil zu folgen. Die meisten Politiker die heute Machtpositionen besetzen sind laut Tony Judt Produkte der sechziger Jahre. Er schreibt über sie: „Diese Politiker haben nicht das Zeug, irgendjemanden außer sich selbst zu begeistern. Sie glauben an nichts und haben keine klaren Standpunkte, und wenn keinem von ihnen so viel Verachtung entgegenschlägt wie George W. Bush, so unterscheiden sie sich doch deutlich von den Staatsmännern der Nachkriegszeit. Sie strahlen keine Autorität aus.
Sie alle, Nutznießer des Wohlfahrtsstaats, dessen Einrichtungen sie in Frage stellen, haben sich laut Tony Judt von den politischen Idealen ihrer Vorgänger abgewendet. Zwar hat keiner, bis auf George W. Bush und Tony Blair, das Vertrauen der Wähler gezielt missbraucht, aber wenn es eine Politikergeneration gibt, die mit verantwortlich ist für die heutige Politikverdrossenheit, dann sind sie ihre wahren Vertreter. Tony Judt klagt: „Sie sind überzeugt, wenig tun zu können, also tun sie wenig. Sie stehen für nichts Konkretes, sind politische Leichtgewichte. Wenn wir solchen Leuten nicht mehr vertrauen, verlieren wir den Glauben an die parlamentarische Demokratie.“
Von Hans Klumbies