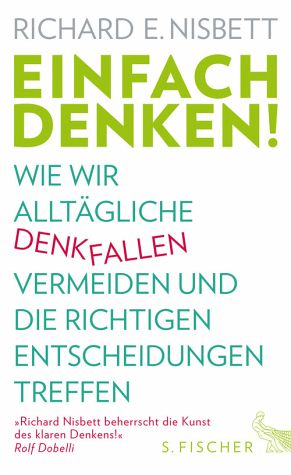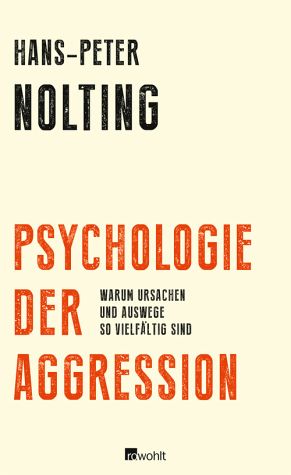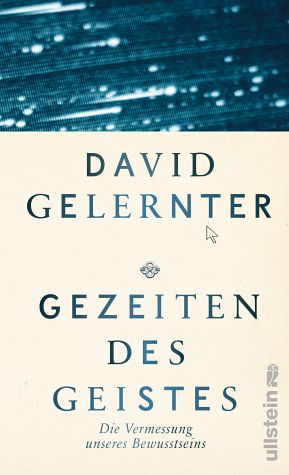François Jullien kennt den Unterschied zwischen dem Universellen, dem Gleichförmigen und dem Gemeinsamen. Das Universelle hat dabei für den französischen Philosophen zwei Bedeutungen. Da ist einerseits eine konstative, man könnte sagen schwache Bedeutung, die sich auf die Erfahrung beschränkt: „Soweit wir bisher beobachten konnten, stellen wir fest, das etwas immer so gewesen ist.“ In diesem Sinne bezieht sich der Begriff auf das Allgemeine. Das Universelle besitzt jedoch auch eine starke Bedeutung, nämlich die der universellen Gültigkeit im genauen oder strengen Sinn – sie ist es, woraus man in Europa eine Forderung des Denkens gemacht hat. François Jullien erläutert: „Wir behaupten von vornherein, noch vor aller Bestätigung durch die Erfahrung, dass eine bestimmte Sache so sein muss.“ François Jullien, geboren 1951 in Embrun, ist ein französischer Philosoph und Sinologe.
Stereotyp
Ohne Schemata würde Chaos herrschen
Ohne Schemata wäre das Leben der Menschen, in William James` berühmten Worten, ein „blühendes, brummendes Durcheinander“. Verfügten sie nicht über Schemata für Hochzeiten, Beerdigungen oder Arztbesuche, würden sie ständig ein Chaos anrichten. Dazu gehören implizite Regeln, wie man sich in solchen Situationen zu verhalten hat. Richard E. Nisbett fügt hinzu: „Diese Generalisierung betrifft auch unsere Stereotype oder Schemata in Bezug auf bestimmte Typen oder Personen. Dazu gehören „Introvertierte“, „Feierbiest“, „Polizeibeamter“, „Elitestudentin“, „Arzt“, „Cowboy“, „Pfarrerin.“ Solche Stereotype beinhalten Regeln über die übliche Art und Weise, wie man sich gegenüber Personen, die den Stereotyp verkörpern, verhält oder verhalten sollte. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird das Wort „Stereotyp“ oft abwertend verwendet. Richard E. Nisbett ist Professor für Psychologie an der University of Michigan.
In einem akuten Konflikt fügen sich die Partner wechselseitig Gewalt zu
Körperliche Gewalt von Männern gegenüber ihren Partnerinnen ist seit Jahrzehnten ein Thema in der Öffentlichkeit, und seit dem gleichen Zeitraum gibt es Bemühungen, die Opfer besser zu schützen; unter anderem entstanden in vielen Städten Frauenhäuser als Zufluchtsort. Es scheint klar: Gewalt in Paarbeziehungen ist Gewalt gegen Frauen. Hans-Peter Nolting stellt fest: „Nach der Polizeistatistik, die auf Anzeigen beruht, also im sogenannten Hellfeld, wird diese Asymmetrie durchaus bestätigt.“ Ganz anders sieht es hingegen aus, wenn Wissenschaftler das Dunkelfeld erforschen. Diese Studien kommen gleichweg zu demselben Ergebnis: Gewalt von Frauen gegen Männer kommt nicht nur gelegentlich vor, sondern ist insgesamt etwa genauso häufig wie Gewalt von Männern. Dr. Hans-Peter Nolting beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dem Themenkreis Aggression und Gewalt, viele Jahre davon als Dozent für Psychologie an der Universität Göttingen.
Das mentale Leben ist von Subjektivität geprägt
Häufig wissen andere Menschen, was eine Person denkt und fühlt, weil sie es ihnen sagt. Manchmal tut man das absichtlich, bei anderen Gelegenheiten aber auch mit Minenspiel und Körpersprache. Ludwig Wittgenstein schreibt: „Der menschliche Körper ist das beste Bild der menschlichen Seele.“ David Gelernter fügt hinzu: „Manchmal wissen andere Menschen besser, was wir fühlen, als wir selbst.“ Mit dem Verstand weiß man, wie andere Menschen sich fühlen. Was aber noch wichtiger ist: Man empfindet die Gefühle des anderen, man sympathisiert mit ihm, man hat Mitgefühl. Das Menschen die Gefühle ihrer Mitmenschen spüren können, liegt daran, dass sie selbst fühlende Wesen sind und wissen, wie sie sich fühlen, wenn sie bestimmte Dinge sagen oder auf eine bestimmte Weise blicken. David Gelernter ist Professor für Computerwissenschaften an der Yale University.
Cordelia Fine greift populäre Geschlechtermärchen frontal an
Viele bekannte Bestseller aus der Populärwissenschaft behaupten, dass Frauen und Männer unterschiedliche Gehirne hätten und deshalb unterschiedliche Begabungen entwickeln würden. Cordelia Fine entlarvt in ihrem neuen Buch „Die Geschlechterlüge“ wissenschaftliche Untersuchungen, die vor Fehlern nur so strotzen, oberflächlich falsch analysierte Forschungsergebnisse und vage Beweise zu angeblichen Tatsachen. Sie offenbart dem Leser, wie stark das Leben von Frauen und Männern von der tückischen Macht der Stereotypen beeinflusst wird. Denn Vorurteile können menschliche Handlungen bestimmen, auch wenn der Betroffene dies nicht möchte. Doch das Gehirn des Menschen entwickelt sich laut Cordelia Fine vor allem durch psychologische Einflüsse, Erlebnissen und der Arbeit mit Kopf und Hand. Deshalb gilt ihrer Meinung nach sowohl für Frau als auch für Mann: Alles ist möglich!