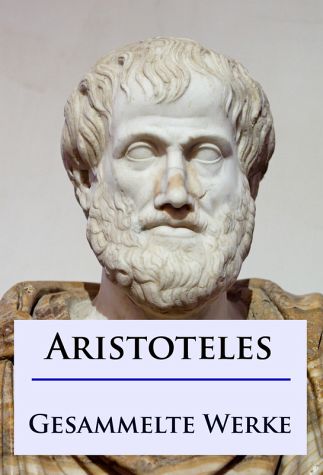Aristoteles versteht die Sprache als den Inbegriff von Zeichen für Vorstellungen, die in der Seele hervorgerufen werden. Dabei kann es sich nur um natürliche Zeichen handeln, denn sonst wäre die faktische Verschiedenheit der Sprachen nicht zu erklären. Als die natürliche Basis der menschlichen Verständigung gilt, dass sich bei allen Menschen bei denselben realen Umständen die gleichen Vorstellungen einstellen. Aristoteles fasste die Sprache als konventionelles Zeichensystem auf. Die Sprache ist seiner Meinung nach dazu da, sich das Nützliche, aber auch das Schädliche, das Gerechte, aber auch das Ungerechte, anzueignen. Denn nur der Mensch allein kann zwischen dem Guten und dem Schlechtem unterscheiden. Herbert Schnädelbach erklärt wie Sprache und die Einsicht bei Aristoteles zusammenhängen: „Die Verbindung von Sprache und Vernunft, die zu den anthropologischen Grundüberzeugungen unserer philosophischen Tradition gehört, ist bei Aristoteles als ein Relation von Mittel und Zweck zu denken.“
Das gute Leben ist der menschliche Lebenszweck
Aristoteles vertritt die These, dass die Menschen von Natur aus dazu bestimmt sind, in staatlichen Gemeinschaften zu leben, wobei ein gutes Leben nur dann möglich ist, wenn sie erkennen, was für sie das Gute und Gerechte ist. Herbert Schnädelbach ergänzt: „Also nicht Leben überhaupt, sondern das gute Leben ist der menschliche Lebenszweck. Dazu bedarf es aber neben der Erkenntnis des Guten und Gerechten auch der gemeinsamen Verständigung darüber, und die Sprache ist dabei das unentbehrliche Mittel.“
Wenn Aristoteles also annimmt, dass die Sprache auf Übereinkunft beruht, steht er allerdings vor einem unlösbaren Problem. Herbert Schnädelbach erklärt: „Die Möglichkeit, im Hinblick auf irgendetwas Bestimmtes zu einem Übereinkommen zu gelangen, setzt bereits Sprache voraus.“ Johann Peter Süßmilch, der von 1707 bis 1767 lebte, vertrat die Ansicht, dass Vernunft Sprache erfordert und umgekehrt Sprache Vernunft voraussetzt, wodurch die Sprache keinen natürlich Ursprung im Sinne des klassischen Empirismus haben kann.
Wilhelm von Humboldt erkennt in der Sprache das bildende Organ des Gedankens
Wilhelm von Humboldt, der von 1767 bis 1835 lebte, hat den Gedanken einer ursprünglichen und untrennbaren Produktivität von Sprechen und Denken in seine Sprachphilosophie aufgenommen. Er geht dabei von der Sprache als bildendes Organ des Gedankens aus. Seiner Meinung nach kann man die Sprache nicht auf ein sekundäres Instrument der Konservierung und Kommunikation von Begriffen und Gedanken reduzieren, die zunächst unabhängig von der Sprache waren. Herbert Schnädelbach ergänzt: „Umgekehrt erweist sich damit die Basis angeblich vorsprachlicher Bewusstseinstatsachen, auf die die naturalistischen Bedeutungstheorien in sprachkritischer Absicht zurückgreifen wollen, als leere Fiktion.“
Die Erfahrungswelt ist den Menschen laut Herbert Schnädelbach ursprünglich durch die Sprache und analoge Symbolsystem erschlossen. Damit ist seiner Meinung nach auch die herkömmliche Voraussetzung erschüttert, alle Menschen hätten angesichts derselben Dinge und Ereignisse dieselben Erfahrungsdaten, die sie dann in konventionell verschiedener Weise bezeichneten. Herbert Schnädelbach fügt hinzu: „Abgesehen von dem Problem, wie Konventionen möglich seien ohne Sprachvermögen, vermag man angesichts der ursprünglichen produktiven Einheit von Vernunft und Sprache nichts Sprachunabhängiges mehr zu identifizieren, auf das man sich sekundär einigen könnte.“
Von Hans Klumbies