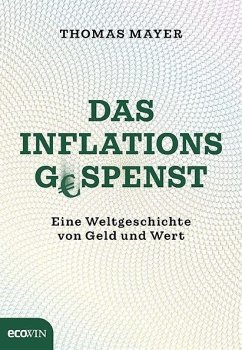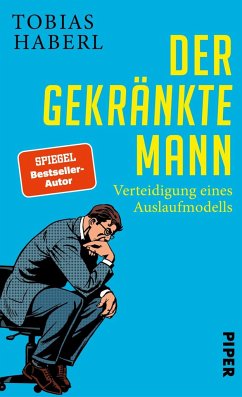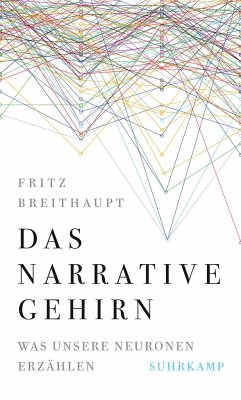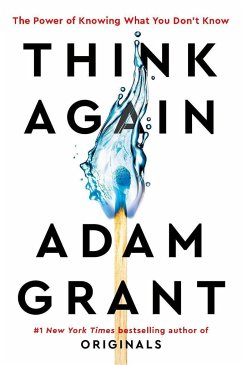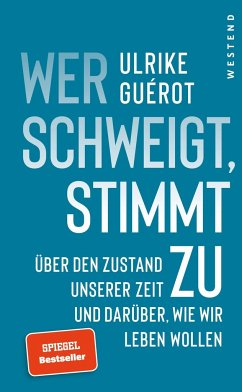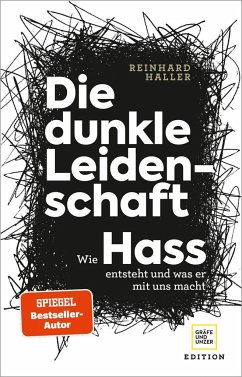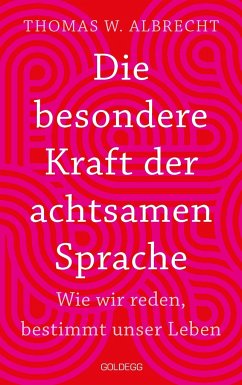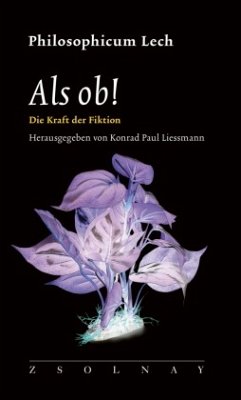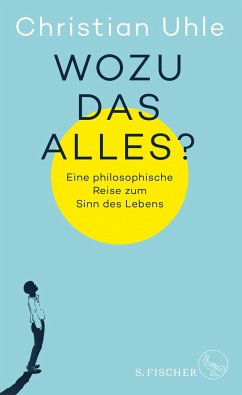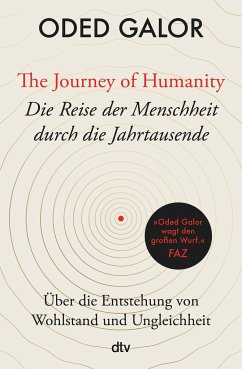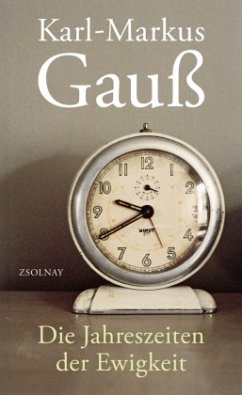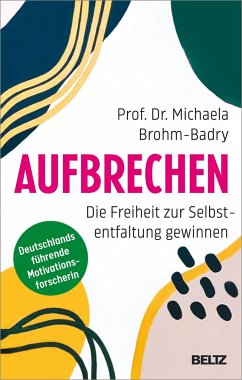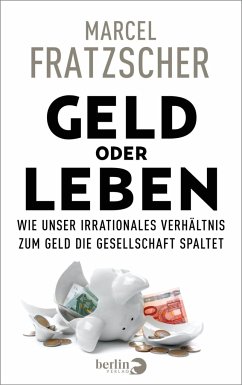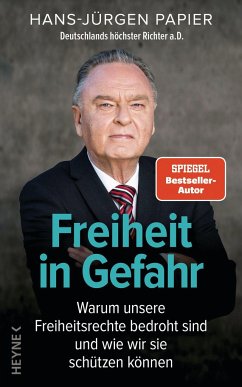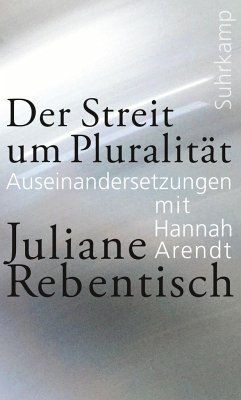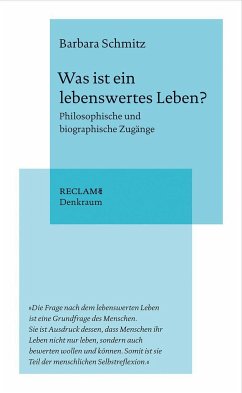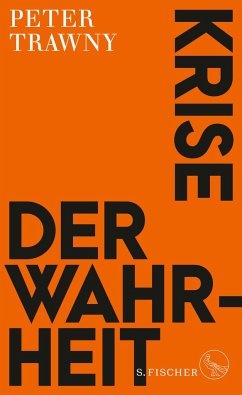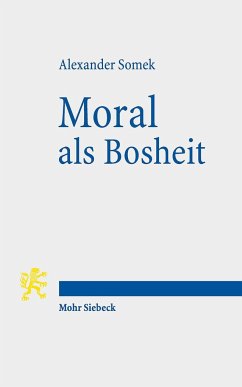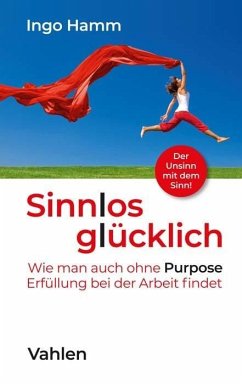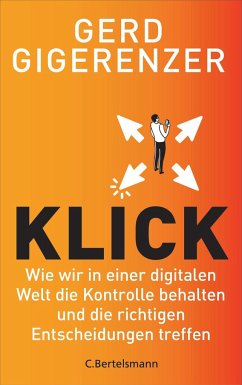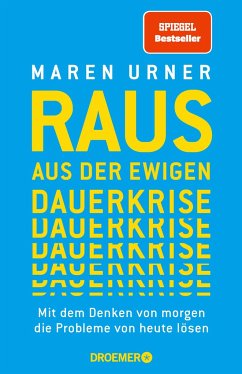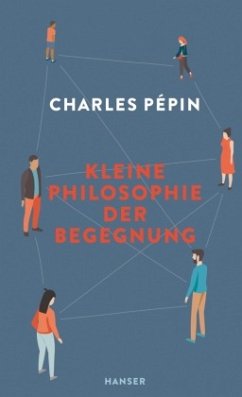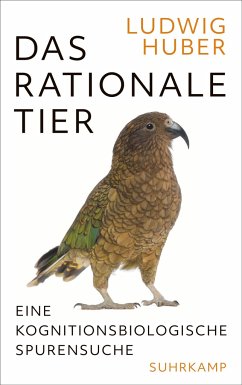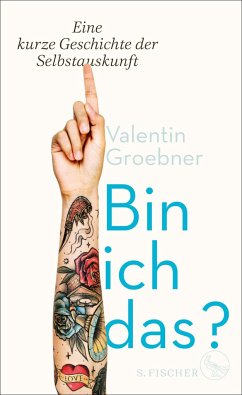In einer Reise durch die Geldgeschichte zeigt der der renommierte Ökonom Thomas Mayer in seinem neuen Buch „Die Inflationsfalle“, wie ein Übermaß neuen Geldes immer wieder zu Krisen, Umbrüchen und Neuordnungen geführt hat. Im ersten Teil erklärt er, wo das Geld eigentlich herkommt und wie es sich über die Zeit gewandelt hat. Dabei verfolgt er auch die Globalisierung des Geldes. Im zweiten Teil betont Thomas Mayer, dass die Geldschöpfung immer wieder für Geld- und Finanzkrisen verantwortlich war. Außerdem vollzieht er nach, welche Rolle das Geld bei der Integration der europäischen Nationalstaaten unter einem europäischen Dach und bei der Errichtung eines modernen Versicherungsstaats gespielt hat. Thomas Mayer ist promovierter Ökonom und ausgewiesener Finanzexperte. Seit 2014 ist er Leiter der Denkfabrik Flossbach von Storch Research Institute.
Buchrezensionen
Der weiße Mann ist toxisch
Im Titel seines neuen Buches „Der gekränkte Mann“ steckt für Tobias Haberl eine tiefe Wahrheit. Denn vieles, was in den modernen Gesellschaften des Westens gerade beschwerlich und bedrohlich ist, lässt sich damit erklären, dass sich die Vorstellung vieler Menschen von Männlichkeit gewandelt hat. Ja man attackiert die Männlichkeit sogar immer öfter und verurteilt sie. In den letzten Jahren standen die mittelalten weißen Männer ganz schön unter Druck. Sie mussten sich anhören wie toxisch sie sind und es sich bei ihnen im Grunde um ein Auslaufmodell handelt. Zudem stellte man sie als Zivilisationsirrtum dar, der für jede Menge Unheil auf der Welt verantwortlich sei. Der Literaturwissenschaftler Tobias Haberl schreibt für das „Süddeutsche Zeitung Magazin“. Sein letztes Buch „Die große Entzauberung – Vom trügerischen Glück des heutigen Menschen“ wurde ein Bestseller.
Das narrative Denken ist ein großartiges Medium
Fritz Breithaupt klärt in seinem neuen Buch „Das narrative Gehirn“ darüber auf, warum Menschen so viel Zeit mit Narrationen verbringen. Eine seiner Thesen lautet: „In den Narrationen erleben wir die Erlebnisse von anderen mit und teilen ihre Erfahrungen. Das ist möglich, weil wir uns in Narrationen ja an die Stelle von anderen versetzen können und dann tatsächlich „ihre“ Erfahrungen selbst machen.“ Man kann auch narrative und mentale Erfahrungen machen und zugleich die Handlungen nicht ausführen. Somit verdoppelt man sein Leben. Man kann auch bereits Getanes ein zweites Mal miterleben oder sich eine geplante Handlung vor Augen führen. Dies fängt bei minimalen Reaktionen an und endet bei den großen Lebensentscheidungen. Insofern ist narratives Denken ein großartiges Medium des Erlebens und Planens. Fritz Breithaupt ist Professor für Kognitionswissenschaften und Germanistik an der Indiana University in Bloomington.
Geistige Offenheit kann man lernen
In seinem neuen Buch „Think Again“ fordert Adam Grant seine Leser dazu auf, die Komfortzone fester Überzeugungen zu verlassen. Denn nur wer Zweifel und unterschiedliche Ansichten zulässt, ohne sich in seinem Ego bedroht zu fühlen, eröffnet sich die großartige Chance, wirklich neue Erkenntnisse zu gewinnen. In einer Welt, die sich rasant verändert, brauchen die Menschen dringend die Fähigkeit, Gedachtes zu überdenken und sich von Erlerntem wieder zu lösen. Adam Grant vertritt in „Think Again“ die These, dass man geistige Offenheit lernen kann. Dazu muss man seine kognitive Trägheit überwinden. Viele Menschen ziehen jedoch oft die Bequemlichkeit, an alten Ansichten festzuhalten, der Schwierigkeit vor, sich mit neuen Sichtweisen auseinanderzusetzen. Adam Grant ist Professor für Organisationspsychologie an der Wharton Business School. Er ist Autor mehrerer internationaler Bestseller, die in 35 Sprachen übersetzt wurden.
Die Grundrechte stehen an erster Stelle
Zwei Jahre, in denen eine essenzielle Krise auf die nächste folgte, habe das gesellschaftliche und politische Leben in Deutschland substanziell verformt. Dabei ist es zu einer schier unglaublichen Machtkonzentration der Exekutive gekommen. Ulrike Guérot fordert in ihrem neuen Buch „Wer schweigt, stimmt zu“, dass der Wert von Grundrechten dringend neu im Bewusstsein der Deutschen verankert werden muss. Die Gesellschaft darf niemanden von der Teilhabe am Diskurs ausgrenzen, den mit Ausgrenzung beginnt laut Ulrike Guérot die Erosion der Demokratie. Gewinner sind ihrer Meinung nach vor allem Tech-Giganten wie Facebook, Twitter sowie YouTube und Finanzgiganten, die schlussendlich digitale Überwachungssystem installieren. Sie haben den Körper als letzte Ware im Visier und Heilsversprechen im Gepäck. Seit Herbst 2021 ist Ulrike Guérot Professorin für Europapolitik der Rheinischen-Friedrichs-Wilhelms Universität Bonn.
Hass ist die primitivste aller Emotionen
Reinhard Haller definiert den Hass in seinem neuen Buch „Die dunkle Leidenschaft“ wie folgt: Es handelt sich dabei um eine „auf Zerstörung ausgerichtete Abneigung, die destruktivste Form der Verachtung“. Als intensives Empfinden von Feindseligkeit und Aggressivität äußert sich Hass beispielsweise in toxischem Schweigen oder verbalen Attacken. Er kann zu heftigen zwischenmenschlichen Auseinandersetzungen und Gesellschaftskonflikten führen. Weitere Formen des Hasses sind Diskriminierung und Mobbing, am schlimmsten Verbrechen und Krieg. Hass ist tatsächlich eine Leidenschaft, die nichts als Leiden schafft. Hass ist die primitivste aller Emotionen – ein Trieb zur Grausamkeit, wie ihn Sigmund Freud bezeichnet hat. Prof. Dr. med. Reinhard Haller war als Psychiater, Psychotherapeut und Neurologe über viele Jahre Chefarzt einer psychiatrisch-psychotherapeutischen Klinik. Heute führt er eine fachärztliche Praxis in Feldkirch (Österreich).
Die Sprache bestimmt das Leben
Vielen Menschen fällt der Spagat schwer, in der Sache klar und bestimmt zu formulieren, aber anderen trotzdem freundlich zu begegnen. Thomas W. Albrecht weiß: „So kommt es zu Konflikten oder mangels klarer Botschaften bleiben eigene Bedürfnisse und Wünsche auf der Strecke.“ Den meisten Menschen ist nicht bewusst, dass es oft einfach daran liegt, wie sie etwas sagen. Wie man redet, bestimmt das gesamte Leben. Und das beginnt bereits bei den eigenen Gedanken. Thomas W. Albrecht vertritt die These, dass es ganz leicht ist, die besondere Kraft der Sprache zu erkennen und zu nutzen. Man muss nur wissen, worauf es dabei ankommt. Es gilt, wie beim Reden mit anderen: Der Ton macht die Musik. Thomas W. Albrecht ist Experte für Kommunikation und Rhetorik.
Das „Als ob“ ist im praktischen Leben unentbehrlich
Das 24. Philosophicum Lech widmete sich der Kraft der Fiktionen. So beruhen zum Beispiel alle Formen der Höflichkeit auf solch einer Fiktion, auf einem „So tun als ob“. Sogar der gesamte Bereich der sozialen Kommunikation lebt von solch einem „Als ob“. Der Philosoph Hans Vaihinger schreibt im späten 19. Jahrhundert: „Das „Als ob“ ist also auch im praktischen Leben unentbehrlich: ohne solche Fiktionen ist kein feineres Leben möglich.“ Konrad Paul Liessmann weist in seinem Beitrag „Als ob“ darauf hin, dass jeder Begriff den Reichtum des Seienden aufs Äußerste verknappen muss, um seine Funktion erfüllen zu können. Dass die Fiktion eine Lebensnotwendigkeit darstellt, hat schon vor Friedrich Nietzsche niemand Geringerer als Immanuel Kant vermutet. Sogar die Freiheit ist für den Philosophen aus Königsberg vorab nichts anderes als eine Idee, eine Fiktion eine Unterstellung.
Eine gute Philosophie ist immer auch lebensnah
Christian Uhle vertritt in seinem neuen Buch „Wozu das alles?“ die These, dass die individuellen Sinnsuchen der Menschen mehr Gemeinsamkeiten haben, als der erste Blick vermuten lässt. Daneben bietet er eine neue Perspektive auf das eigene Leben sowie Ansätze für einen sinnvollen gesellschaftlichen Wandel. Was ist der Sinn des Lebens? Diese Frage bewegt Menschen seit Jahrtausenden. Die Grundfragen sind dabei immer die gleichen geblieben: „Wozu sind wir auf der Welt? Was ist wirklich wertvoll und wichtig im Leben?“ Der Autor entfaltet in „Wozu das alles?“ eine inhaltlich überzeugende Theorie des sinnvollen Lebens. Er möchte seine Leser auf eine philosophische Reise mitnehmen und auf diesem Weg eine Sprache für die Philosophie finden, die ihren Platz mitten im persönlichen Leben einnehmen kann. Das Anliegen des Philosophen Christian Uhle ist es, Philosophie in das persönliche Leben einzubinden.
Oded Galor erzählt die Geschichte der Menschheit neu
Der renommierte Ökonom Oded Galor untersucht in seinem neuen Buch „The Journey of Humanity“ die Entwicklungen die zu Wohlstand und Ungleichheit führten. Er verschmilzt dabei Erkenntnisse aus unterschiedlichsten Wissenschaftsdisziplinen. Dabei entsteht eine große welt- und zeitumspannende Theorie, welche die Geschichte der Menschheit neu erzählt. Verhältnis zur langen Geschichte des Homo sapiens hat die Menschheit praktisch über Nacht eine dramatische und beispiellose Verbesserung der Lebensqualität erfahren. Wie der englische Philosoph Thomas Hobbes im 17. Jahrhundert konstatierte, war das menschliche Leben damals „ekelhaft, tierisch und kurz“. Das meiste, was die Menschen heute plagt, ist nichts im Vergleich zu dem Elend und den Tragödien, die sich vor rund 400 Jahren abspielten. Heute genießen viele Nation beispielslosen Wohlstand. Aber es gibt immer noch andere, die den Sprung aus der wirtschaftlichen Stagnation noch nicht geschafft haben.
Erinnerungen muss man mit Skepsis begegnen
In seinem neuen Buch „Die Jahreszeiten der Ewigkeiten“ gibt es das Kapitel „Intermezzo I“. Dort setzt sich der Karl-Markus Gauß mit Sprache und Identität auseinander. Der Autor schreibt: „In der Sprache erfahren wir als Erstes die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe, und in der Sprache wird diese später täglich erlebt. Aber das Sprechen selbst ist nicht er wichtigste Akt, mit dem sich uns diese Zugehörigkeit erweist.“ Wichtiger als das tatsächliche Sprachvermögen ist seiner Meinung nach allerdings die soziale Spracherinnerung: an das Leid, den Mut, die Arbeit, die Hoffnungen der Vorfahren. Solche Erinnerung ist wichtig, aber man muss ihr wie jeder Erinnerung mit Skepsis begegnen. Karl-Markus Gauß lebt als Autor und Herausgeber der Zeitschrift „Literatur und Kritik“ in Salzburg. Seine Bücher wurden in viele Sprachen übersetzt und oftmals ausgezeichnet.
Ein authentisches Leben führt zur Zufriedenheit
Im Mittelpunkt ihres neunen Buches „Aufbrechen“ steht für Michaela Brohm-Badry die Frage, wie Menschen die Freiheit und Vitalität für neue Möglichkeiten des Denkens, Fühlens und Handelns zu gewinnen. Mitten im Leben nehmen sich manche Menschen einfach die Freiheit, aufzubrechen und ihren inneren Impulsen zu folgen. Sie lernen ein Instrument, segeln über Meere und leben ihren Traum. Michaela Brohm-Badry erklärt, wovon es abhängt, ob ein Mensch verborgene Fähigkeiten entdecken und ungelebte Seiten seiner Persönlichkeit entfalten kann. Das Buch „Aufbrechen“ handelt unter anderem davon, was lebendiges Menschsein sein kann. Michaela Brohm-Badry betont: „Wer ein authentisches Leben führt, lebt ein volles Leben, und diese Zufriedenheit überträgt sich auf alles, was im Umfeld lebt.“ Prof. Dr. Michaela Brohm-Badry ist Professorin für Lernforschung. Sie war langjährige Dekanin des Fachbereichs Erziehungs- und Bildungswissenschaften, Philosophie und Psychologie an der Universität Trier.
Deutsche lehnen Schulden vehement ab
In seinem neuen Buch „Geld oder Leben“ weist Marcel Fratzscher darauf hin, dass es in Deutschland kaum ein emotionaleres Thema gibt als Geld und Schulden. Die Deutschen unterscheiden sich dabei stark von anderen Nationen. Sie sparen nicht nur mehr, sondern auch anders. Sie nehmen häufiger Gefahren für ihr Geld wahr und lehnen Schulden so vehement ab wie kaum jemand anders auf der Welt. Marcel Fratzscher schreibt in der Einleitung: „Die Vorstellung, Schulden seien schlecht und moralisch verwerflich und Sparen etwas Gutes, ist zu einer Grundüberzeugung und Teil unserer Identität geworden.“ Staat und Gesellschaft fördern das Sparen und schützen Vermögen. Sie wollen den Bürgern eine maximale Sicherheit und Schutz ihres Ersparten ermöglichen. Marcel Fratzscher ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) und Professor für Makroökonomie an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Freiheitsrechte sind keine Selbstverständlichkeit mehr
In seinem neuen Buch „Freiheit in Gefahr“ untersucht Hans-Jürgen Papier die verschiedenen gesellschaftlichen und politischen Facetten der Freiheit. Dabei bezieht er sich stets auf die Verfassung Deutschlands, deren oberster Zweck die Freiheit ist. Mit Sorge beobachtet der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts die fortschreitenden Erosionserscheinung in Deutschland. Denn die einst hart erkämpften Freiheitsrechte sind keine Selbstverständlichkeit mehr. Sie sind zunehmend in Gefahr, nicht zuletzt seit der Coronapandemie. Der Autor beobachtet besorgniserregende Verschiebungen auf das, was viele Deutsche politisch als verhältnismäßig empfinden. Hans-Jürgen Papier deckt auf, was die Grundrechte bedroht, und macht deutlich, warum es jetzt gelingen muss, die bürgerlichen Freiheiten zu sichern und zu wahren. Prof. em. Dr. Dres. h.c. Hans-Jürgen Papier war von 2002 bis 2014 Präsident des Bundesverfassungsgerichts.
Hannah Arendts Denken ist aktueller denn je
In ihrem neunen Buch „Der Streit um Pluralität setzt sich Juliane Rebentisch mit der politischen Philosophie Hannah Arendts auseinander. Es besteht für die Autorin kein Zweifel, dass die Schriften von Hannah Arendt heute nicht zuletzt aufgrund ihrer Aktualität ihrer Themen wieder mit großem Interesse liest. Schonungslos beschreibt sie die Unzumutbarkeiten von Flucht und Staatenlosigkeit. Ihre eindrücklichen Überlegungen zum Verhältnis von Politik und Wahrheit haben Eingang in die öffentlichen Debatten der Gegenwart gefunden. Hannah Arendt Leben war bekanntlich geprägt durch die Erfahrungen von Antisemitismus, Staatsterror, Flucht und Staatenlosigkeit. Juliane Rebentisch betont: „Die geistesgeschichtliche Bedeutung Hannah Arendts bemisst sich nicht zuletzt an den zum Teil heftigen Kontroversen, die ihre Publikationen in der Öffentlichkeit auslösten.“ Juliane Rebentisch ist Professorin für Philosophie und Ästhetik an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach am Main.
Barbara Schmitz erforscht das lebenswerte Leben
In ihrem Essay „Was ist ein lebenswertes Leben?“ stellt Barbara Schmitz fest, dass die Frage sich nicht systematisch und linear behandeln lässt. Denn es gibt darauf keine eindeutige Antwort. Es handelt sich hier vielmehr um eine Frage, die eine subjektive Antwort eines Individuums verlangt: „Eine Antwort, die immer auch die Erfahrungen des jeweiligen Menschen spiegelt.“ Deshalb nimmt Barbara Schmitz in ihrem Essay immer wieder Bezug auf biographische Erfahrungen. Die mündlichen und biographischen Berichte bilden die Anstöße zur philosophischen Reflexion, die das Anliegen dieses Essays ist. Individuelle Erfahrungen sind ihr Ausgangspunkt, die mit philosophischen Begriffen, Theorien, Positionen und Debatten verbunden werden. Barbara Schmitz ist habilitierte Philosophin. Sie lehrte und forschte an den Universitäten in Basel, Oxford, Freiburg i. Br., Tromsø und Princeton. Sie lebt als Privatdozentin, Lehrbeauftragte und Gymnasiallehrerin in Basel.
In der Differenz verbirgt sich Schönheit
Hadija Haruna-Oelker erzählt in ihrem Buch „Die Schönheit der Differenz“ ihre persönliche Geschichte. Diese verbindet sie mit hochaktuellen gesellschaftspolitischen Fragen. Sie entwickelt dabei eine Vision davon, wie man ein gelungenes Miteinander in einer Gesellschaft denken kann. Hadija Haruna-Oelker schlägt vor: „Indem wir einander Räume schaffen, Sprache finden, uns mit Offenheit und Neugier begegnen.“ Sie erzählt auch von der Wahrnehmung von Differenzen, von Verbündetsein, Perspektivwechseln und von der Schönheit, die sich aus den Unterschieden der Menschen ergibt. Im Endeffekt ist das Buch eine Einladung an Alle, die über die Zustände in der deutschen Gesellschaft nachdenken möchten. Hadija Haruna-Oelker schreibt für eine diverse Gesellschaft und ihre Schönheit und für alle, die einen Weg dorthin suchen. Hadija Haruna-Oelker lebt als Autorin, Redakteurin und Moderatorin in Frankfurt am Main. Hauptsächlich arbeitet sie für den Hessischen Rundfunk.
Die Wahrheit ist in großer Gefahr
Es tobt eine Riesenschlacht um die Wahrheit. Es gibt Fake News, alternative Fakten, Verschwörungstheorien, die Lügenpresse und ein postfaktisches Zeitalter. Die Öffentlichkeit wird erschüttert von Schlagworten und Diskussionen um alles oder nichts. Peter Trawny warnt in seinem neuen Buch „Krise der Wahrheit“: „Die Situation ist unübersichtlich. Es droht ein allgemeiner Orientierungsverlust. Alles weist darauf hin, dass es einen gefährlichen Anschlag auf die Wirklichkeit gibt, eine Krise der Wahrheit.“ Aus unsichtbaren Informationskanälen bricht ein Virus hervor und vergiftet die Gesellschaft. Ein Streit um die Deutungshoheit der Wahrheit ist unvermeidbar. Der Naturwissenschaft liegen Regeln zugrunde, die alle kennen können und wenig Anlass zu Misstrauen bieten. Die Frage wäre also, warum man diese Regeln zu ignorieren versucht. Peter Trawny gründete 2012 das Matin-Heidegger-Institut an der Bergischen Universität in Wuppertal, dessen Leitung er seitdem innehat.
Die Moral fügt Schmerzen zu
In seinem neuen Buch „Moral als Bosheit“ beschreibt Alexander Sobek seine Auffassung über das Verhältnis von Recht und Moral. Dazu verwendet er als Instrument eine rechtsphilosophische Analyse. Dabei beschäftigt es sich auch mit der Figur des alten weißen Mannes. Denn für manche, und das sind nicht wenige, ist er das Wahrzeichen aller Übel. Und er eignet sich wunderbar dazu, gehasst zu werden. Obwohl er stereotypisch festgelegt ist, bleibt dieser Ungeliebte dennoch eine Rätselgestalt. Könnte es sich bei ihm nicht sogar um einen Wiedergänger von Vernunft und Aufklärung handeln? Immerhin tritt er so auf. Der Autor weiß, dass er für diesen inopportunen Gedanken mit allerlei Angriffen rechnen muss. Er nimmt sich jedoch vor, sie demütig zu ertragen. Alexander Somek ist seit 2015 Professor für Rechtsphilosophie und juristische Methodenlehre an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien.
Der Sinn in der Arbeit ergibt keinen Sinn
Ingo Hamm zeigt in seinem neuen Buch „Sinnlos glücklich“ neue Wege der Psychologie und Philosophie, um dem Unsinn mit dem Sinn zu entkommen. Er erklärt dabei, wie man im Arbeitsleben ohne Sinn auskommt. Denn es ist die Tätigkeit an sich, die glücklich macht, wenn man das tut, was man gerne macht und immer schon gut konnte. Laut Ingo Hamm ist nun die Zeit für einen „Existenzialismus der Arbeit“ gekommen. Dort bestimmen pures Erleben, Freiheit und Selbstbestimmung den Beruf. Wie eine Umfrage des Job-Netzwerks Xing ergab, legen Menschen großen Wert darauf, dass ihr Job sinnstiftend ist. Gehalt und Status liegen bei vielen nicht mehr an erster Stelle. Der Purpose ist der neue Heilige Gral des westlichen Arbeitslebens. Dr. Ingo Hamm ist Professor für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Darmstadt.
Die digitale Welt bietet Chancen und Risiken
In seinem neuen Buch „Klick“ beschreibt der Psychologe und Risikoforscher Gerd Gigerenzer anhand vieler konkreter Beispiele, wie Menschen die Chancen und Risiken der digitalen Welt für ihr Leben richtig einschätzen können. Dabei geht es auch um die Frage, wie man sich am besten vor den Verlockungen sozialer Medien schützen kann. In den letzten Jahren hat Gerd Gigerenzer bei vielen populärwissenschaftlichen Veranstaltungen über Künstliche Intelligenz (KI) gesprochen. Dabei war er immer wieder überrascht, wie verbreitet das bedingungslose Vertrauen in komplexe Algorithmen zu sein scheint. Wenn man Menschen durch Software ersetze, könne man die Welt besser und angenehmer machen, versicherten die Tech-Vertreter den Zuhörern. Gerd Gigerenzer ist ein weltweit renommierter Psychologe. Das Gottlieb Duttweiler Institut hat Gigerenzer als einen der hundert einflussreichsten Denker der Welt bezeichnet.
Maren Urner: „Alles beginnt in unserem Kopf!“
Wie können sich Menschen aus der Endlosschleife von Krisen befreien? Antworten auf diese Frage gibt Maren Urner in ihrem neuen Buch „Raus aus der ewigen Dauerkrise“. Dabei muss man lernen, die gewohnten Denkmuster hinter sich zu lassen. Die Autorin stellt dazu die neuesten Erkenntnisse der neurowissenschaftlichen und psychologischen Forschung vor. Maren Urner zeigt, wie man sein Gehirn besser verstehen und nutzen kann, um den Krisenmodus zu überwinden. Ihr Credo lautet: „Alles beginnt in unserem Kopf!“ Außerdem beschreibt sie die Denkfallen, die Menschen gerade in Krisenzeiten das Leben schwer machen und sie von einem Missverständnis zum nächsten stolpern lässt. Deshalb stellt Maren Urner das Konzept eines neuen, dynamischen Denkens vor, das den Weg aus der Endlosschleife des vermeintlich alternativlosen Denkens weist. Dr. Maren Urner ist Professorin für Medienpsychologie an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft (HMKW) in Köln.
Charles Pépin entwirft eine Philosophie der Begegnung
Charles Pépin hat sein neues Buch „Kleine Philosophie der Begegnung“ vor allem deshalb geschrieben, um zu zeigen, dass man den Zufall zu seinem Verbündeten machen kann. Er schreibt: „Er entscheidet nicht über unser Schicksal, sondern wir führen ihn vielmehr herbei.“ Man muss nur den Mut haben, sich auf Unvorhergesehenes einzulassen. Das setzt allerdings voraus, dass man sich über den Mechanismus und die Kraft der Begegnung im Klaren sein muss. Dazu befragt Charles Pépin die großen Denker des 20. Jahrhunderts. Und zwar diejenigen, die in der Nachfolge Hegels die Beziehung zum Anderen und die fundamentalen Bindungen, die sich zwischen zwei Wesen knüpfen können, untersucht haben. Sigmund Freud, Martin Buber, Emmanuel Lévinas, Jean-Paul Sartre, Simone Weil und Alain Badiou stehen bei der Skizzierung einer Philosophie der Begegnung Pate. Charles Pépin ist Schriftsteller und unterrichtet Philosophie. Seine Bücher wurden in mehr als zwanzig Sprachen übersetzt.
Das rationale Tier ist allgegenwärtig
Ludwig Huber will in seinem Buch „Das rationale Tier“ nicht nur zeigen, was die Forschung heute über den Geist der Tiere weiß und wie sie es herausgefunden hat, sondern auch, wozu das gut ist. Neben der zweckfreien Befriedigung der Neugierde treibt ihn auch ein moralischer Imperativ. Ludwig Huber schreibt: „Um sie zu retten, müssen wir uns kümmern, und kümmern können wir uns nur, wenn wir sie verstehen.“ Dazu stellt er die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse vor. Diese verlangen eine entschiedene Revision der irrationalen und ethisch fragwürdigen Einstellungen der Menschen gegenüber Tieren. Intelligenzbestien in der Tierwelt findet man an Land, in der Luft und auch unter Wasser. Ludwig Huber ist Professor und Leiter des interdisziplinären Messerli Forschungsinstituts für Mensch-Tier-Beziehungen an der Veterinärmedizinischen Universität Wien.
Viele sehnen sich nach Einzigartigkeit
Valentin Groebners neues Buch „Bin ich das?“ ist ein Blick in den historischen Spiegel. Er beantwortet darin unter anderem die Frage, woher der Wunsch vieler Menschen nach demonstrativer Einzigartigkeit kommt. Dabei recherchiert er leichtfüßig über den großen Wunsch, jemand ganz Besonderes zu sein – und das allen anderen auch zu zeigen. Valentin Groebner schreibt: „Reden über sich selbst als öffentliche Intimität ist im 21. Jahrhundert nicht nur Merkmal von Teilhabe und Offenheit, sondern gilt als unverzichtbar für privaten und beruflichen Erfolg.“ Geht das? Um welchen Preis? Davon handelt sein Buch. Valentin Groebner lehrt als Professor für Geschichte des Mittelalters und der Renaissance an der Universität Luzern. Seit 2017 ist er Mitglied in der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung.