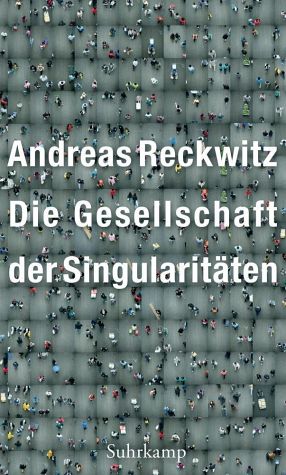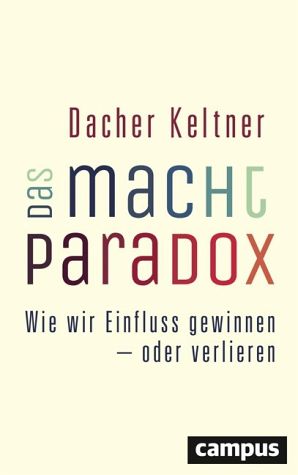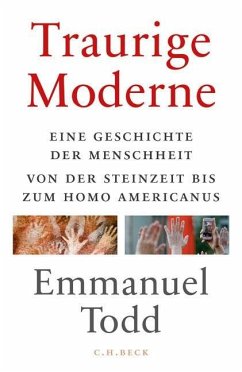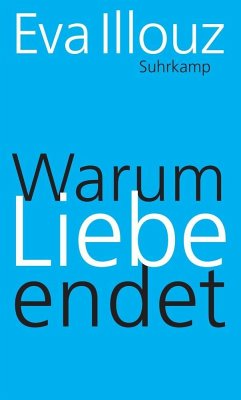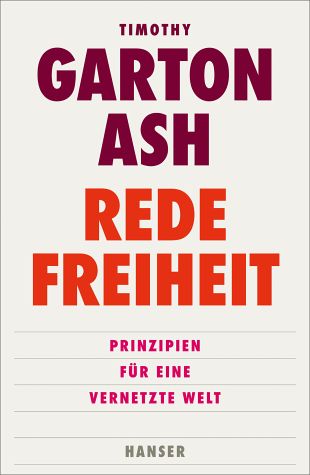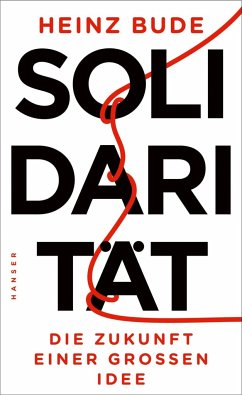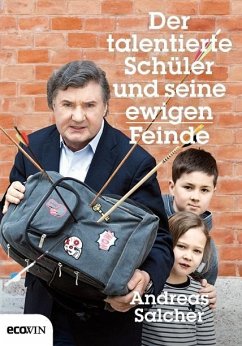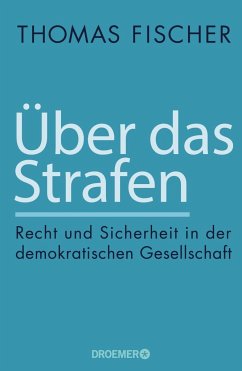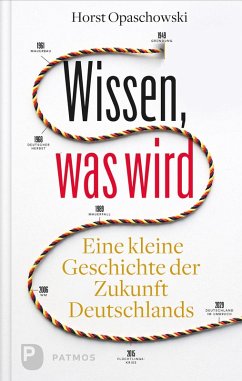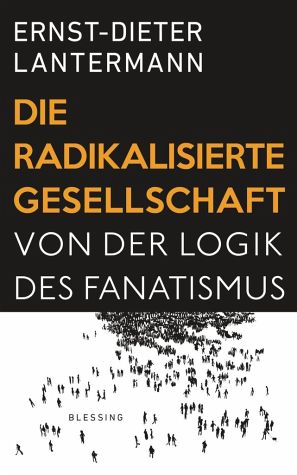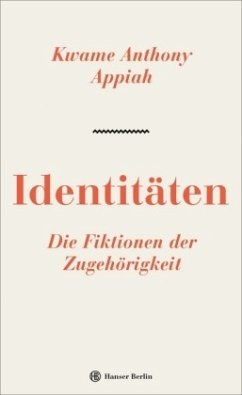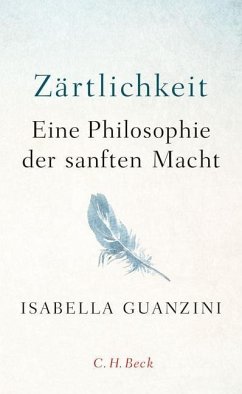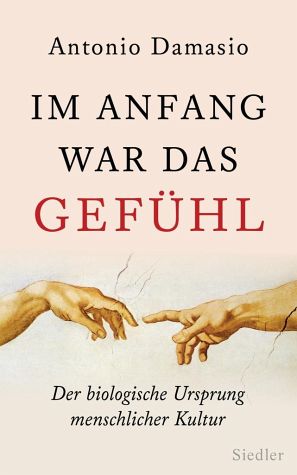Die Welt des Konsums entwickelt sich seit den 1920er Jahren zur neuen Kultursphäre. Es findet sozusagen eine Konsumrevolution statt. Andreas Reckwitz erläutert: „Güter, die bisher primär instrumentellen Zwecken dienten, kulturalisiert man nun mehr und mehr. Und sie erhalten einen narrativen, ästhetischen, expressiven oder ludischen Selbstzweck.“ Mit dem Konsum weitet sich jenseits von bürgerlicher Kunst und Kultur das Feld dessen, was Kultur sein kann, deutlich aus. Zentral ist: Die Güter in einer kommerziellen Marktkonstellation buhlen um die Gunst des Konsumenten. Daher koppelt man Kultur nun nicht mehr an den Staat, sondern an die Ökonomie. In einzelnen Segmenten lassen sich hier bereits Mechanismen von kultureller Innovation und Differenzierung nach Art eines „Modezyklus“ beobachten. Andreas Reckwitz ist Professor für Kultursoziologie an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt / Oder.
Soziologie
Machtmissbrauch gehört nicht zur menschlichen Natur
Von der Liebe abgesehen, gibt es keinen anderen Bereich des sozialen Lebens, der so gründlich erforscht ist wie der Erwerb von Macht, ihr Missbrauch und schließlich ihr Verlust. Die großen Geschichten vom Missbrauch der Macht und dem darauffolgendem Verlust derselben, faszinieren Menschen seit jeher. Die Fixierung auf den Machtverlust könnte einen Menschen zu dem Glauben verleiten, der Missbrauch von Macht sei unvermeidlich. Aber das Macht-Paradox ist viel komplexer. Dacher Keltner erklärt: „Machtmissbrauch ist nicht Teil der menschlichen Natur.“ Macht bedeutet nicht nur die Möglichkeit, andere beeinflussen zu können, sie prägt auch das Selbstbewusstsein. Das Gefühl, über Macht zu verfügen, löst einen Rausch an Erwartungen aus. Dacher Keltner ist Professor für Psychologie an der University of California in Berkeley und Fakultätsdirektor des UC Berkeley Greater Good Science Center.
Dacher Keltner definiert einen neuen Begriff der Macht
Seit Niccolò Machiavelli und der Renaissance hat sich die Gesellschaft dramatisch verändert, und zwar in einer Weise, die es erforderlich macht, die ausgediente Definition von Macht fallenzulassen. Dacher Keltner erklärt: „Es wird uns eher gelingen, das Macht-Paradox zu überlisten, wenn wir unser Denken erweitern und Macht als die Fähigkeit definieren, etwas in der Welt zu verändern, insbesondere, indem wir mit Hilfe der Macht andere in unseren sozialen Netzen aufrütteln.“ Nach dieser neuen Definition ist Macht nicht auf ganz besondere Menschen beschränkt, also weder auf grausame Diktatoren noch hochrangige Politiker oder die Reichen und Berühmten des Jet-Sets, die in der Öffentlichkeit stehen. Dacher Keltner ist Professor für Psychologie an der University of California in Berkeley und Fakultätsdirektor des UC Berkeley Greater Good Science Center.
An der Oberfläche der Geschichte herrscht das Bewusste
Ein einfaches Modell ermöglicht eine geschichtliche Darstellung der menschlichen Gesellschaften und ihrer Veränderungen. Emmanuel Todd erläutert: „An der Oberfläche der Geschichte entdecken wir das Bewusste, die Wirtschaft der Ökonomen, die täglich in den Medien präsent ist und deren neoliberale Ideologie in einer merkwürdigen Rückbesinnung auf den Marxismus verkündet, dass sie das Ausschlaggebende sei. Zu diesem Bewussten, dem Schrillen, wie man sagen könnte, gehört natürlich auch die Politik.“ Etwas tiefer stößt man auf ein Unterbewusstes der Gesellschaft, auf die Bildung, eine Schicht, deren Bedeutung die Bürger und Kommentatoren erkennen, wenn sie an ihr reales Leben denken, während sich die orthodoxe Sicht weigert, vollauf anzuerkennen, wie entscheidend sie ist und wie stark sie auf die darüberliegende bewusste Schicht einwirkt. Emmanuel Todd ist einer der prominentesten Soziologen Frankreichs.
So entwickelt sich eine Gesellschaft
Die Entwicklung einer Gesellschaft ist häufig als unilinearer Prozess der formalen Rationalisierung beschrieben worden. Demzufolge schreitet sie in Richtung einer immer umfassenderen Logik des Allgemeinen fort. Das geschient in Form von Technisierung, Verwissenschaftlichung und Universalisierung. Wohingegen Singularitäten, Valorisierungen und Affekte das sind, was die Menschheit hinter sich lässt. Andreas Reckwitz vertritt folgende Annahme: „Die Gesellschaftstheorie muss von einer Doppelstruktur der Vergesellschaftung ausgehen. Vergesellschaftung heißt formale Rationalisierung und Kulturalisierung.“ Das bedeutet, das Rationalisierungsprozesse nicht isoliert, das heißt ohne die sie stets begleitenden Kulturalisierungen betrachtet werden können. Und genauso wenig lässt sich die Kultursphäre künstlich von den Prozessen der Rationalisierung trennen. Damit sind soziale Logiken des Allgemeinen und solche des Besonderen in ihrer Parallelität und Relation zueinander zu betrachten. Andreas Reckwitz ist Professor für Kultursoziologie an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt / Oder.
Sex braucht weder Sünde noch Scham
Nur wenige kulturelle Projekte waren so total wie das der sexuellen Befreiung. Es befreite den Geschlechtsverkehr von Sünde und Scham. Und es verwandelte die Sexualität unter tätiger Mithilfe der Psychologen in ein Synonym für emotionale Gesundheit und Wohlbefinden. Eva Illouz ergänzt: „Zugleich war es ein Projekt, das darauf abzielte, Frauen und Männer, Heterosexuelle und Homosexuelle gleichzustellen. Damit war es auch ein wesentlich politisches Projekt.“ Die sexuelle Befreiung legitimierte darüber hinaus die sexuelle Lust als Selbstzweck. Zugleich nährte sie damit die Vorstellung von hedonistischen Rechten. Dabei handelt es sich um jenes diffuse kulturelle Gefühl, das Individuen einen Anspruch auf sexuelle Lust haben, um ein gutes Leben zu verwirklichen. Eva Illouz ist Professorin für Soziologie an der Hebräischen Universität von Jerusalem. Außerdem ist sie Studiendirektorin am Centre européen de sociologie et de science politique de la Sorbonne.
Um Werte finden Kulturkämpfe statt
Andreas Reckwitz ist der festen Überzeugung, dass nicht nur der Begriff der Kultur renoviert gehört. Sondern auch der Begriff des Wertes ist zu entstauben. Nur dann ist er für die zeitgenössische Soziologie und Kulturtheorie interessant: „Unter Werten versteht man nicht neukantianisch ein Wertesystem, das der Praxis vorausgeht und sie motivational anleitet. Es geht nicht darum, dass einzelne Menschen oder ein Geschlecht bestimmte Werte haben.“ Werte muss man als Teil von gesellschaftlichen Zirkulationsdynamiken interpretieren. Diese sind ergebnisoffen und häufig konflikthaft – hier finden Kulturkämpfe statt. In der Sphäre der Kultur zirkulieren nicht nur Kunstwerke, attraktive Städte und bewundernswerte Individuen. Sie bringt auch Müll hervor. Die meisten Einheiten des Sozialen, denen die Singularisierung nicht gelingt – den Dingen, die nicht einzigartig erscheinen, oder den Menschen, denen Originalität fehlt, zum Beispiel –, bleiben in der Kultursphäre unsichtbar. Andreas Reckwitz ist Professor für Kultursoziologie an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt / Oder.
Das Recht kann sich in Normen verwandeln
Das Recht ist eine Sammlung von Verhaltensregeln, die durch eine Kombination von Statuten und Gerichtsurteilen sorgfältig und detailreich formuliert ist. Die Rechtsprechung setzt es in einem Geltungsbereich durch, der sich gewöhnlich auf einen Staat oder den klar definierten Teil eines Staates erstreckt. Damit ist jedoch die gesamte Bandbreite der Möglichkeiten noch nicht erfasst. Timothy Garton Ash erklärt: „Wenn wir „das Recht“ sagen, denen wir in der Regel an das „Strafrecht“: Wenn du dies oder jenes sagst oder tust, wirst du eingesperrt. Doch es gibt noch andere zunehmend weichere Formen des Rechts. Diese gehen schleichend in den Bereich bloßer Normen über.“ Es gibt das Zivilrecht, und es gibt das sogenannte „expressive Funktion“ des Rechts und Formulierungen, die eine allgemeine Botschaft verkünden, wie etwas in einer gegebenen Gesellschaft sein sollte. Timothy Garton Ash lehrt in Oxford europäische Geschichte und ist einer der angesehensten politischen Kommentatoren aus Großbritannien.
Trittbrettfahrer kennen keine Solidarität
Der Gegentyp zum solidarischen Menschen ist der Trittbrettfahrer. Heinz Bude erläutert: „Trittbrettfahrer nehmen für sich ohne Bedenken die Vorteile und Vergünstigungen in Anspruch, die andere für ihn und für Menschen in ihrer oder seiner Lage erstritten haben.“ Sie denken keinen Moment daran, dass sich daraus für sie solidarische Verpflichtungen gegenüber der Gruppe ergeben. Deren Repräsentanten haben in Tarifverhandlungen, in politischen Auseinandersetzungen oder in der Arena der Öffentlichkeit höhere Löhne, längere Ferien, breitere Fahrradwege oder das Recht auf eine bezahlte Elternzeit erstritten. Im Gegenteil: Man brandmarkt gesellschaftliches Funktionärswesen und die Selbstbedienungsmentalität der politischen Klasse. Zudem kritisiert man die moralische Überheblichkeit von stehen gebliebenen Ökoaktivisten. Heinz Bude studierte Soziologie, Philosophie und Psychologie. Seit dem Jahr 2000 ist er Inhaber des Lehrstuhls für Makrosoziologie an der Universität Kassel.
Lehrer sind heute auch Sozialarbeiter
Der öffentliche Stellenwert, den man dem wahrscheinlich wichtigsten Zukunftsberuf in der Gesellschaft gibt, ist bedauerlich. Andras Salcher kann die Gefühle vieler engagierter Lehrer gut nachvollziehen, wenn Politiker und Interessenvertreter Kampagnen zur Aufwertung des Lehrerberufs fordern. Der „Mut zum aufrechten Gang“ ist verdammt schwer in einem Umfeld, das einem jede Freude an der Aufgabe nimmt. Lehrer sind heute auch – an manchen Schulen sogar primär – Sozialarbeiter. Zudem ist die Schule ein System, das hohe Krankenstandraten durch Burn-out und Frühpensionierungen durch die ständig steigenden psychischen Belastungen produziert. Die wenigen Aufstiegsmöglichkeiten hängen in Österreich stark vom richtigen Parteibuch und nicht von hervorragender Leistung ab. Vor allem die Freude an der Arbeit mit Kindern wird durch eine bürokratische fremdbestimmte Kultur verhindert. Dr. Andreas Salcher ist Unternehmensberater, Bestseller-Autor und kritischer Vordenker in Bildungsthemen.
Die Medien kommunizieren über das Strafen
Die Kommunikation über das Strafen findet ganz überwiegend durch die Vermittlung von technischen Medien statt: Presse, Film, Fernsehen und Internet. Thomas Fischer fügt hinzu: „Jedes dieser Medien hat spezifische Bedingungen und Wirkmechanismen. Jedes konstruiert Sinn anders.“ Zwischen Kunst-Medien wie insbesondere dem Film und einer Berichterstattung in Presse und Fernsehen bestehen für jeden sichtbare Unterschiede. Der symbolische Charakter der Kommunikation ist im Film nicht mehr so offenkundig wie im Theater, aber noch weithin rekonstruierbar. Im Fernsehen verschwimmen die Grenzen zwischen symbolisierender Fiktion und scheinbar authentischem Sprechen mit dem „lieben Zuschauer“ zusehends. Teilweise sucht man diese Grenzauflösung ausdrücklich. Etwa wenn Talkshows im Anschluss und mit unmittelbarem Bezug zu Kriminalfilmen gesendet werden. Thomas Fischer war bis 2017 Vorsitzender des Zweiten Senats des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe.
Die Zahl der Sexualpartner nimmt ständig zu
Ein von der sexuellen Revolution ausgelöste Wandel sieht Eva Illouz im enormen Anstieg der Zahl der Sexualpartner, die man im Laufe seines Lebens hat. Dabei ist das Sammeln sexueller Erfahrungen für viele Menschen aus unterschiedlichen sozioökonomischen Gruppen zu einem wichtigen und eigenständigen Aspekt des Sexuallebens geworden. Vorehelicher Sex wurde zunehmend legitim. Und je länger die Zeitspanne ist, die zwischen dem ersten Sexualpartner und der Wahl eines dauerhaften Lebenspartners liegt, desto wahrscheinlicher neigen Menschen dazu, sexuelle Erfahrungen anzuhäufen. Dies legt für Eva Illouz nahe, dass Sexualität inzwischen als ein Betätigungsfeld verstanden wird, in dem es darum geht, einen Erfahrungsschatz zu akkumulieren und eine große Zahl von Partnern kennenzulernen. Eva Illouz ist Professorin für Soziologie an der Hebräischen Universität von Jerusalem. Außerdem ist sie Studiendirektorin am Centre européen de sociologie et de science politique de la Sorbonne.
Gute Lehrer werden oft als Störfaktor betrachtet
Was sind die Eigenschaften eines guten Lehrers? Andreas Salcher antwortet: „Wohl sich möglichst um das individuelle Talent jedes Schülers zu kümmern. Sich auch in der Freizeit ständig fortzubilden. Eltern zur Verfügung zu stehen, sich mit anderen Kollegen über Verbesserungen an der Schule auszutauschen und dann dem Direktor Vorschläge zu machen.“ Solche Lehrer, vor allem am Beginn ihrer Schullaufbahn, gibt es zahlreich und sie sind bei Schülern und Eltern schnell beliebt. Wie reagiert das österreichische Schulsystem auf solche Musterlehrer? Sie werden von weniger leistungsbereiten Direktoren eher als Störfaktor betrachtet, der Unruhe ins System bringt. Andere Lehrer empfinden sie als unkollegial und isoliert sie. Manch erfahrener Kollege unter vier Augen den wohlmeinenden Tipp, dass sie sich nicht selbst ausbeuten sollen. Dr. Andreas Salcher ist Unternehmensberater, Bestseller-Autor und kritischer Vordenker in Bildungsthemen.
Die Logik des Allgemeinen dominiert die Moderne
Was ist die Moderne? Was sind die zentralen Merkmale der modernen Gesellschaft in ihrer klassischen Gestalt? Aus der Sicht von Andreas Reckwitz ist die Antwort eindeutig: „Der strukturelle Kern der klassischen Moderne, wie sie sich seit dem 18. Jahrhundert zunächst in Westeuropa ausgebildet hat, ist zunächst eine soziale Logik des Allgemeinen. Diese drängt auf eine Standardisierung, Formalisierung und Generalisierung sämtlicher Einheiten des Sozialen.“ Die Moderne formatiert die Welt der bis dahin traditionellen Gesellschaften grundlegend um. Sie prägt ihr in ihren Praktiken, Diskursen und institutionellen Komplexen durchgängig und immer wieder aufs Neue Formen des Allgemeinen auf. Als großflächige Praxis betreibt sie ein, wie Andreas Reckwitz es nennen möchte, umfassendes „doing generality“ der Welt. Andreas Reckwitz ist Professor für Kultursoziologie an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt / Oder.
Die sexuelle Revolution richtet sich gegen das Patriarchat
Die Soziologin Véronique Mottier schreibt: „Der Aufruf der freudschen Linken zur sexuellen Revolution hatte große Auswirkungen auf die linken und feministischen Bewegungen.“ Er war gegen die Unterdrückung des Kapitalismus und Patriarchat gerichtet. Es entstanden auch verschiedene Formen der Sexualtherapie, die eine Freisetzung der sexuellen Energien versprachen. Das alles geschah zwischen 1960 und 1980. In der Folge wurde die Sexualität als biologische Kraft verstanden, die von der bürgerlichen Gesellschaft unterdrückt wird. Laut Eva Illouz hatte dieses revolutionäre Verständnis der Sexualität einen tiefen und weitreichenden Einfluss auf die Gesellschaft. Dieser war sowohl für die Organisation der Wirtschaft als auch für die Familie sehr bedeutsam. Eva Illouz ist Professorin für Soziologie an der Hebräischen Universität von Jerusalem sowie Studiendirektorin am Centre européen de sociologie et de science politique de la Sorbonne.
Die Sexualität wird als Praxis der Freiheit gelebt
In ihrem Buch „Sexualität. Eine sehr kurze Einführung“ fragt die Soziologin Véronique Mottier: „Wie kommt es, dass die Sexualität für unser Selbstverständnis derart zentral geworden ist?“ Eva Illouz glaubt, die Antwort auf diese Frage lautet im Kern: „Unsere Sexualität wird als der Wert und die Praxis der Freiheit gelebt. Einer Freiheit, die umso mächtiger und allgegenwärtiger ist, als sie an den unterschiedlichsten Schauplätzen institutionalisiert wurde.“ Wenn Eva Illouz von Freiheit im Allgemeinen und emotionaler beziehungsweise sexueller Freiheit im Besonderen spricht, bezieht sie sich nicht auf das glanzvolle moralische Ideal, das den Leitstern der demokratischen Revolutionen bildete. Eva Illouz ist Professorin für Soziologie an der Hebräischen Universität von Jerusalem sowie Studiendirektorin am Centre européen de sociologie et de science politique de la Sorbonne.
Die Familie ist den Deutschen heilig
Der irische Managementpsychologe Charles Handy empfahl seinem Sohn, als er von dessen Heiratsplänen erfuhr: „Sei auf der Hut. Du wirst nicht nur die Liebe deines Lebens, sondern eine ganze Familie heiraten. Du solltest besser herausfinden, worauf du dich einlässt. Familien sind wichtig.“ Mittlerweile wird die „ganze Familie“ in einer Gesellschaft des langen Lebens immer unverzichtbarer. Horst Opaschowski erklärt: „Ob es uns gefällt oder nicht: Wir brauchen die Familie – für eine gemeinsame Zukunft. Unternehmen können uns kündigen. Nachbarn und Freunde ziehen weg, aber die Familie ist immer da, wenn man sie braucht.“ Horst Opaschowski gründete 2014 mit der Bildungsforscherin Irina Pilawa das Opaschowski Institut für Zukunftsforschung. Bis 2006 lehrte er als Professor für Erziehungswissenschaften an der Universität Hamburg. Ab 2007 leitete er die Stiftung für Zukunftsfragen.
Vorhersehbarkeit ist eine fundamentale Dimension sozialer Interaktionen
Für den Soziologen und Gesellschaftstheoretiker Niklas Luhmann ist die Reduktion von Komplexität und Ungewissheit ein grundlegender Bestandteil sozialer Prozesse. Eva Illouz erläutert: „Liebe ist – wie Wahrheit, Geld oder Macht – ein Kommunikationsmedium, das dabei hilft, Erwartungen zu erzeugen, eine Entscheidung unter vielen möglichen anderen auszuwählen, Motivationen mit Handlungen zu verbinden sowie Gleichheit und Vorhersehbarkeit in Beziehungen zu schaffen.“ Ein solches Medium der Kommunikation bringt Rollen hervor, die wiederum erwartete Ergebnisse produzieren. Vorhersehbarkeit ist eine fundamentale Dimension sozialer Interaktionen, die beispielsweise in Riten besonders deutlich zum Ausdruck kommt. Wenn Interaktionen ritualisiert werden, erzeugen sie Gewissheit über die Beziehungsdefinition der Akteure, über ihre Position in einer solchen Beziehung und über die dazugehörigen Verhaltensregeln. Eva Illouz ist Professorin für Soziologie an der Hebräischen Universität von Jerusalem sowie Studiendirektorin am Centre européen de sociologie et de science politique de la Sorbonne.
Ungewissheit zählt zur Grunderfahrung des Menschen
Sehr viele Menschen leben heute in Gesellschaften, in denen sich Veränderung mit einer so hohen Geschwindigkeit vollziehen, dass sie den Überblick zu verlieren drohen. Frühere Gesellschaften boten ihren Mitgliedern bei allen stürmischen Entwicklungen und Zumutungen immer noch einen relativ stabilen Orientierungs- und Entfaltungsrahmen, der für Überblick, Strukturierung, Klarheit, Abschätzbar- und Überschaubarkeit der individuellen Lebensführung einigermaßen Sorge trug. Ernst-Dieter Lantermann erklärt: „Diese Lebensgewissheiten kann eine moderne Gesellschaft nicht mehr leisten. Ungewissheit und Unsicherheit sind zu Grunderfahrungen von uns allen geworden, ob wir dies nun gutheißen oder nicht.“ Der Historiker Heinrich August Winkler spricht von einem „Zeitalter der allgemeinen Verunsicherung“, der Philosoph Zygmunt Baumann von einer „fluiden“ Gesellschaft, in der alles im Fluss sei und keine Stabilitäten mehr Geltung hätten. Ernst-Dieter Lantermann war von 1979 bis 2013 Professor für Persönlichkeits- und Sozialpsychologie an der Universität Kassel.
Die modernen Identitäten sind von sozialer Natur
Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts hätte niemand, der nach der Identität eines Menschen fragte, die Kategorien race, Gender, Nationalität, Region oder Religion erwähnt. Früher war die Identität etwas ganz Besonderes und Persönliches. Kwame Anthony Appiah vergleicht dies mit der Gegenwart: „Die Identitäten, an die wir heute denken, haben wir dagegen meist mit Millionen oder Milliarden anderen Menschen gemeinsam. Sie sind von sozialer Natur.“ In den sozialwissenschaftlichen Theorien des frühen 20. Jahrhunderts sucht man nach solchen Identitäten vergebens. In seinem 1934 veröffentlichten Buch „Mind, Self, and Society“ skizzierte George Herbert Mead eine einflussreiche Theorie des Selbst als Produkt eines „Ich“, das auf die sozialen Anforderungen der anderen reagiert und durch deren Verinnerlichung das „Mich“, wie er dies nannte, herausbildet. Professor Kwame Anthony Appiah lehrt Philosophie und Jura an der New York University.
Die Moderne scheint von negativen Beziehungen bestimmt zu sein
Für die Zeit vom 16. bis zum 20. Jahrhundert konstatieren die Soziologen der Moderne die Ausbreitung der Kultivierung neuer Beziehungsformen auf alle gesellschaftlichen Gruppen. Dazu zählen, Eva Illouz nennt nur einige, die Liebesheirat, die selbstlose oder uneigennützige Freundschaft, das mitfühlende Verhältnis zum Fremden und die nationale Solidarität. Alle diese Formen können ihrer Meinung nach gleichermaßen als neue soziale Verhältnisse, neue Institutionen und neue Gefühle bezeichnet werden. Gemeinsam ist ihnen, dass sie durchweg auf einer Wahl beruhen. In der frühen Neuzeit wurde somit die Freiheit zu wählen institutionalisiert, wobei die Individuen ihre Freiheit in der Verfeinerung der Praxis des Wählens erfuhren, die als eine emotionale erlebt wurde. Eva Illouz ist Professorin für Soziologie an der Hebräischen Universität von Jerusalem sowie Studiendirektorin am Centre européen de sociologie et de science politique de la Sorbonne.
Gated Communities sind auch in Deutschland auf dem Vormarsch
Nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland werden Gated Communities oder geschlossene Wohnkomplexe immer beliebter. Bis vor wenigen Jahren war diese Wohnform hierzulande noch weitgehend unbekannt. Wohnsoziologen und Kulturgeografen, die sich mit diesem Phänomen beschäftigen, sind sich sicher, dass die Entwicklung hin zu abgeschlossenen Wohnen auch in Deutschland kaum aufzuhalten sein wird. Ernst-Dieter Lantermann erklärt: „ Geschlossene Wohnkomplexe sind abgeschirmte und bewachte Wohnkomplexe mit Zugangsbeschränkungen, die in zwei Varianten gebaut werden – als Apartmentanlagen oder als Ensembles von Häusern und Eigentumswohnungen auf einem von der näheren Umgebung abgesonderten Territorium.“ „Arcadia“, die deutschlandweit erste Gated Community wurde in Potsdam errichtet, 45 Wohnungen und sieben Villen stehen auf einem parkähnlichen Grundstück in bester Lage. Ernst-Dieter Lantermann war von 1979 bis 2013 Professor für Persönlichkeits- und Sozialpsychologie an der Universität Kassel.
Gesellschaften funktionieren nicht nach „natürlichen“ Gesetzen
Normativität und Moral entstehen aus der Wirklichkeit des Lebens, weil und indem sie sie strukturieren. Die meisten Menschen handeln fast stets mit „Sinn“, und menschliches Handeln hat daher nicht nur eine Wirkung in der physischen Außenwelt, sondern auch immer „Sinn“ in der Kommunikation. Thomas Fischer fügt hinzu: „Die schönste Moral nutzt nichts, wenn sie sich im Appell erschöpft, die Umwelt und die anderen mögen sich bitte der Moral des Sprechers gemäß verhalten.“ Um die Moralen herum sind daher von Anfang an Strukturen und Mechanismen gebaut, die eine „herrschende“ Moral hervorbringen und stabilisieren können. „Herrschaft soll heißen die Chance, für einen Befehl bestimmten Inhalts bei angebbaren Personen Gehorsam zu finden“, definierte Max Weber. Thomas Fischer war bis 2017 Vorsitzender des Zweiten Senats des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe.
Georg Simmel analysiert das Großstadtleben
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts analysierte der Soziologe und Philosoph Georg Simmel das Großstadtleben und erkannte darin die spezifischen Anzeichen der Moderne. Isabella Guanzini erläutert: „In seinem kleinen Text „Die Großstädte und das Geistesleben“ von 1903 analysiert Georg Simmel die radikalen Veränderungen von Empfindung und Wahrnehmung der Individuen, die in der Großstadt leben, um zu verstehen, was die Seele der Stadt auf individueller und überindividueller Ebene ausmacht.“ Die charakteristische psychische Veränderung des modernen Individuums sieht Georg Simmel in der „Steigerung des Nervenlebens“, die aus raschen und ununterbrochenen Wechsel äußerer und innerer Eindrücke hervorgeht. Das Großstadtleben ist eine Zusammenballung emotionaler Reize, die Aufmerksamkeit fordern und ständig auf die subjektive Seele einstürmen, die sie verarbeiten und auf sie reagieren muss. Isabella Guanzini ist Professorin für Fundamentaltheologie an der Universität Graz.
Kultur ist die Summe intellektueller Errungenschaften
Dass das Wort „Kultur“ auf das Universum der Ideen angewandt wird, hat die Menschheit Cicero und dem alten Rom zu verdanken. Cicero beschrieb mit dem Wort das Heranziehen der Seele – „cultura animi“; dabei dachte er offensichtlich an den Ackerbau und sein Ergebnis, die Vervollkommnung und Verbesserung des Pflanzenwachstums. Was für das Land gilt, kann demnach genauso auch für den Geist gelten. Antonio Damasio schreibt: „An der heutigen Hauptbedeutung des Wortes „Kultur“ gibt es kaum Zweifel. Aus Wörterbüchern erfahren wir, dass Kultur eine Sammelbezeichnung für Ausdrucksformen intellektueller Errungenschaften ist, und wenn nichts anderes gesagt wird, meinen wir damit die die Kultur der Menschen.“ Antonio Damasio ist Professor für Neurowissenschaften, Neurologie und Psychologie an der University of Southern California und Direktor des dortigen Brain and Creative Institute.