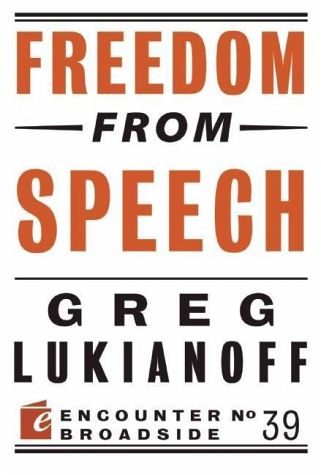Die Studenten der Columbia University in New York wollen seit einiger Zeit von Ovids „Metamorphosen“ gewarnt werden. Denn die Geschichten von den liebestollen Göttern und ihren Nachstellungen laufen in der Regel auf den Tatbestand der sexuellen Nötigung hinaus. Inzwischen gibt es vieles, was bei anfälligen Studenten ungute Gefühle hervorrufen kann. Psychologen nennen das triggern. Professoren müssen das in Zukunft berücksichtigen. Die Forderungen von Studenten nach „Trigger Warnings“ sind während der letzten zwei Jahre im amerikanischen Hochschulbetrieb zu einem beherrschenden Thema geworden. Viele Universitäten haben dem Druck nachgegeben. Es gibt jetzt wieder indizierte Bücher, eigentlich sogar ganze Themenbereiche. Das Beharren darauf, dass schon die Benennung einer Verletzung wie eine semiotische Voodoopuppe selbst eine Verletzung hervorruft, führt in der Konsequenz natürlich dazu, dass im Prinzip schon Trigger-Warnungen selbst zu Triggern werden und am besten jedes Thema, bei dem sich jemand verletzt fühlen könnte, gleich ganz vermieden wird.
Scheinbar harmlose Äußerungen sind nicht mehr politisch korrekt
Neben Sexualität, Gewalt, Klassenunterschieden und so weiter betrifft das in Amerika immer auch das Verhältnis der weißen Mehrheit zu den ethnischen Minderheiten und Immigranten. Nach dem „New Yorker“ hat nun auch das ebenfalls eher liberale Magazin „Atlantic Monthly“ gefunden, dass das Thema an die Öffentlichkeit gehöre und einen ganzen Schwerpunkt dazu gebracht. Jonathan Haidt, ein New Yorker Sozialpsychologe, und Greg Lukianoff, Leiter der Stiftung „Individual Rights in Education“ stellen sich im „Atlantic Monthly“ die Frage, woher diese radikale Sprach-Tabus kommen und wohin sie führen.
Die beiden Forscher kommen zu folgendem Ergebnis: „Das Drängen auf eine politisch korrekte Ausdrucksweise, das ab den Achtzigern dazu führen sollte, Minderheiten vor Diskriminierung zu schützen, habe sich fortentwickelt zu einem Aufspüren immer feinerer Microaggressions selbst in den scheinbar harmlosesten Äußerungen.“ Das andere ist eine Wendung der Fürsorge von den sozialen und ethnischen Minderheiten in die Innenwelten der Mehrheit. Auch der weiße Mitteklassenstudent kann sich so als Opfer fühlen, und auch wer nicht sexuell missbraucht wurde, darf den Schmerz zurückweisen, den drastische Schilderungen auslösen können.
Amerikanische Hinterwäldler sind stolz auf ihre Primitivität
Jonathan Haidt und Greg Lukianoff schreiben, dass jetzt die Jahrgänge in den Hörsälen sitzen, die von ihren Eltern keine Sekunde mehr aus den Augen gelassen wurden. Noch nie seien seelische Probleme unter Studenten so verbreitet gewesen wie heute – diagnostizierte wie nur behauptete. Diese Studentengeneration verlange, dass die Universität ein „safe space“ sei, worunter man sich offenbar eine Mischung aus verlängertem Elternhaus und psychiatrischem Sanatorium vorzustellen hat. Jonathan Haidt und Greg Lukianoff finden diesen Hang zur Schmerzvermeidung in psychologischer Hinsicht als fatal.
Die Wissenschaftler vertreten die Ansicht, dass die Universität die Studenten vor allem auf das Leben danach vorbereiten sollte, wo es dann leider auch mal ein bisschen weniger nett zugehen könne. Wenn es in Deutschland eine Entsprechung zu den amerikanischen Hinterwäldlern gibt, die aggressiv stolz sind auf ihre Primitivität, dann sind das manche Menschen in Freital und Heidenau. Das höhnische, sich der eigenen Hässlichkeit offensichtlich vollständig bewusste Grölen vor den deutschen Flüchtlingsheimen ist so ziemlich der größte denkbare Gegensatz zu einer Sprachpolitik, die, wie an den amerikanischen Universitäten, schon das schiere Benennen von Problematischem ächten und einem die Welt zum Teletubbyland flachreden will. Schön wäre, wenn man sagen könnte, dass sie sich gegenüberliegen wie Himmel und Hölle. Es sind aber beides Höllen. Quelle: Süddeutsche Zeitung
Von Hans Klumbies